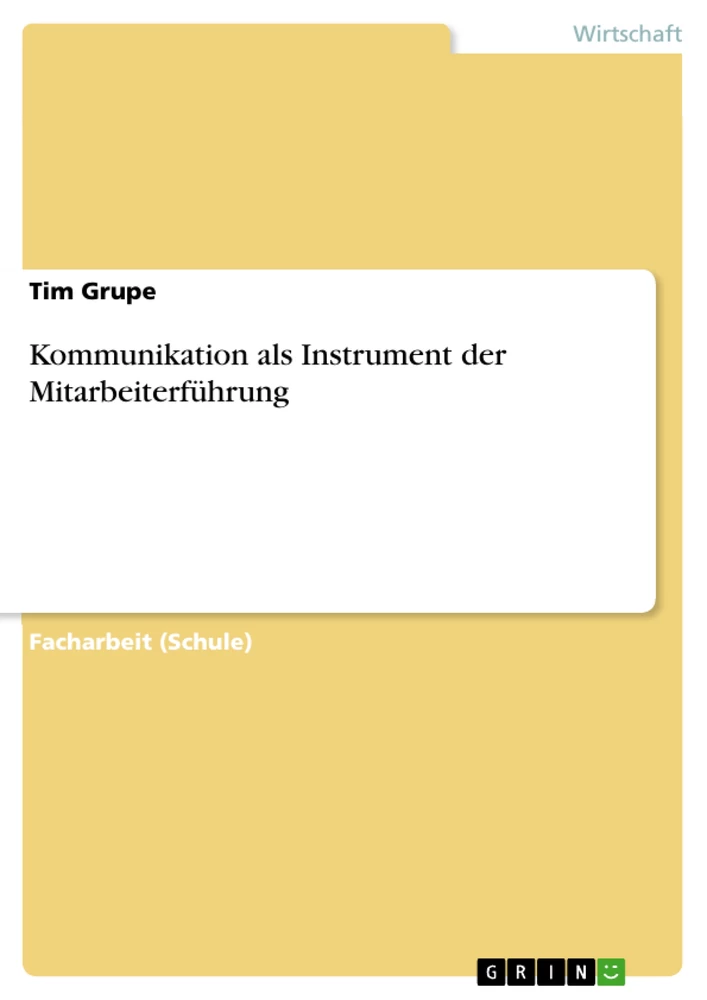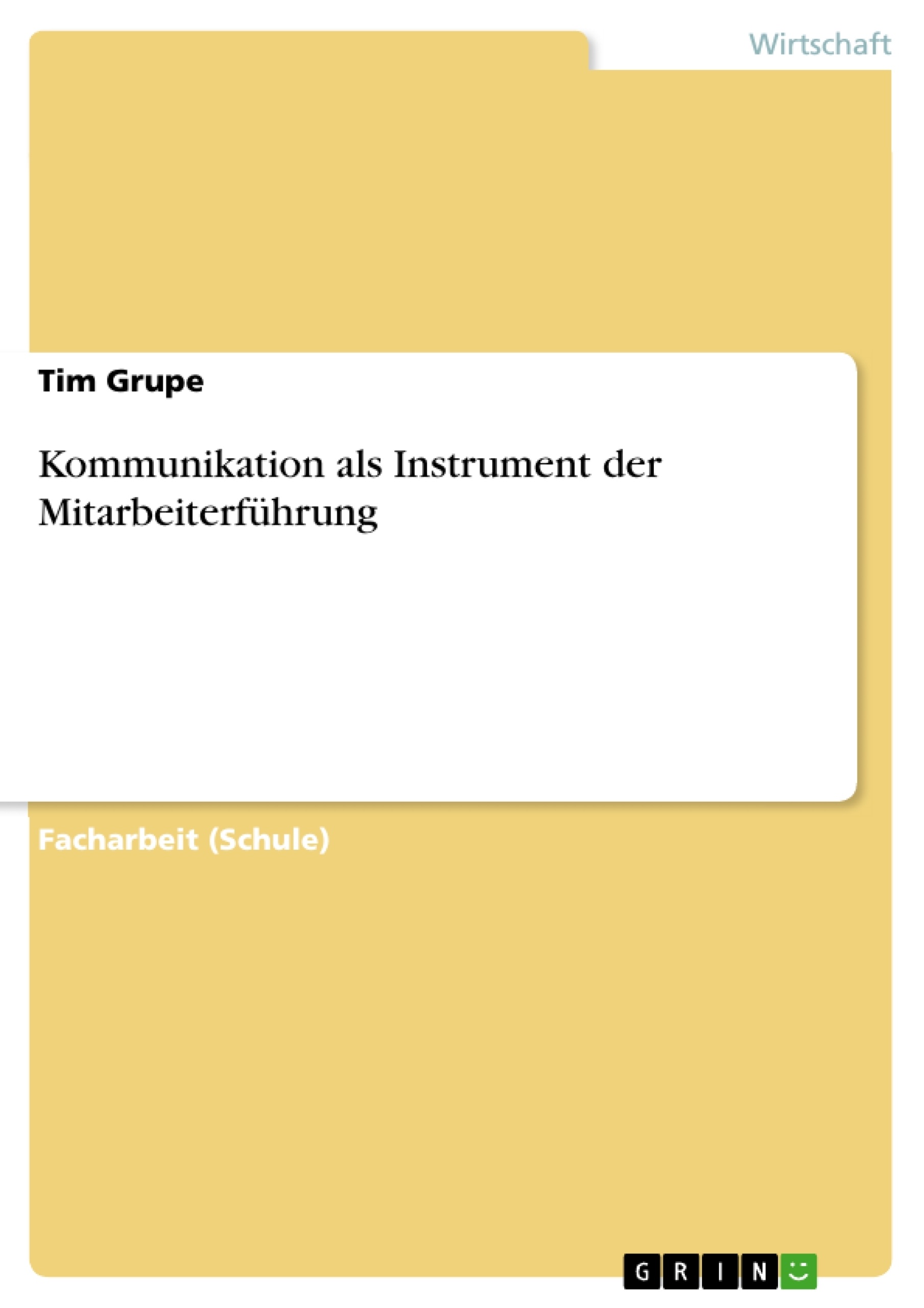Zehn Jahre ist es her, seit dem Start der beruflichen Karriere des Autors dieser
Ausarbeitung. Im Jahr 2008 startete die Ausbildung zum Altenpfleger, in einer familiär
geführten Pflegeeinrichtung und die Welt der Pflege schien so sinnvoll, wie einfach.
Pflegende helfen den zu Pflegenden bei dessen zu verrichtenden Alltagsaufgaben in den
Bereichen Körperpflege, Ernährung, Mobilität und in dem Bereich der sozialen Interaktion,
heute besser bekannt unter dem großen Themenfeld der Beschäftigung. Die Fassade einer
heilen, friedvollen Welt, in der sich beruflich pflegende begaben, fing jedoch schnell an zu
bröckeln. So wurden die Auszubildenden doch schnell damit konfrontiert, dass praktische
und theoretische Grundlagen nicht unbedingt zueinander passen und sich der Pflegealltag
doch gänzlich anders gestaltet als es von der damaligen theoretischen Grundausstattung für
die Pflegeschüler gefordert wurde. Es wurde zu einer Koexistenz zweier, eigentlich
zueinander gehörenden, wichtigen Grundpfeiler der Wissensvermittlung, doch liegt aber die
Umsetzung Theorie und Praxis weit auseinander. Das erzeugte zeitweise einen surrealen
Blick auf die Arbeit der professionell Pflegenden. Beruflich Pflegende könnten mit größter
Wahrscheinlichkeit auch gute Anekdoten schreiben, allerdings nur für begrenztes Publikum,
denn um zu verstehen welchen humoristischen Hintergrund Begutachtungen bzw.
Überprüfungen des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen kurz MDK, Heimaufsicht
oder auch Anleitungssituationen bzw. Sichtstunden von Lehrern der Pflegeschulen mit
Auszubildenden mit sich bringen benötigt man fundiertes Hintergrundwissen aus dem
beruflichen Alltag einer Pflegekraft. In diesen Momenten wird der gesamte ausgelagerte und
nicht für wichtig empfundene theoretische Anteil der Pflegewelt in den praktischen
Arbeitsalltag integriert. In diesen kurzen Momenten oder auch Phasen ist es möglich, dass
die Theorie mit der Praxis verschmilzt, um dann nach Beendigung der „besonderen“
Situationen auch zeitnah wieder getrennt zu werden. Natürlich dürfen Sie als Leser dieser
Ausarbeitung dem Autor jetzt der Schwarzmalerei bezichtigen und verständlicherweise
müsste dann zugegeben werden, dass es auch sehr viele positive Aspekte der Ausbildung
und der beruflichen Laufbahn gegeben hat, die die Arbeit als berufliche Pflegekraft mit sich
brachte. Die Qualität und Güte der Ausbildung in der anfänglich vom Autor beschriebenen
Pflegeeinrichtung...
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Führung
- 2.1 Führung als soziales Phänomen
- 2.2 Führung nicht ohne Sinn
- 2.3 Führung benötigt Macht
- 2.4 Führung und Hierarchie
- 3. Kommunikation
- 3.1 Paul Watzlawick
- 3.1.1 Die Unmöglichkeit nicht zu kommunizieren
- 3.1.2 Die Inhalts- und Beziehungsaspekte von Kommunikation
- 3.1.3 Die Interpunktion von Ereignisfolgen
- 3.1.4 Digitale und analoge Kommunikation
- 3.1.5 Symmetrische und komplementäre Kommunikation
- 3.2 Friedemann Schulz von Thun
- 3.2.1 Der vierfache Gehalt einer Äußerung: das Kommunikationsquadrat
- 3.3 Fazit
- 3.1 Paul Watzlawick
- 4. Führungskompetenz
- 4.1 Ethik
- 4.1.1 Moral
- 4.1.2 Werte und Normen
- 4.1.3 Ethisches Dilemma
- 4.1 Ethik
- 5. Kommunikation als Instrument der Mitarbeiterführung
- 5.1 Regeln für gelingende Kommunikation nach Rogers
- 5.2 Die Kunst des Fragens
- 5.2.1 Fragen
- 5.2.2 Fragentypen
- 5.2.3 Die Idee systemischer Fragen
- 5.3 Mitarbeitergespräche
- 5.3.1 Ziele und Inhalte von Mitarbeitergesprächen
- 5.3.2 Das Mitarbeitergespräch als Führungsinstrument
- 5.3.3 Formen der Mitarbeitergespräche - Regelmäßig und/oder anlassbedingt
- 6. Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Facharbeit befasst sich mit der Bedeutung von Kommunikation im Kontext der Mitarbeiterführung. Sie beleuchtet die Herausforderungen und Möglichkeiten, die Kommunikation im Berufsalltag mit sich bringt, und fokussiert auf die Rolle der Kommunikation als Werkzeug zur Gestaltung einer erfolgreichen und motivierenden Führung.
- Führung als soziales Phänomen und ihre Auswirkungen auf Mitarbeiterbeziehungen
- Kommunikationstheorien von Paul Watzlawick und Friedemann Schulz von Thun
- Die Bedeutung ethischen Verhaltens in der Führung
- Die Kunst des Fragens als Instrument der Mitarbeiterführung
- Die Bedeutung von Mitarbeitergesprächen für eine effektive Zusammenarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt den persönlichen Bezug des Autors zur Arbeit in der Pflege dar. Kapitel 2 beleuchtet die verschiedenen Facetten von Führung und stellt die Bedeutung von Führung in sozialen Zusammenhängen heraus. Kapitel 3 konzentriert sich auf die Kommunikationstheorien von Paul Watzlawick und Friedemann Schulz von Thun, die wichtige Erkenntnisse für die Interaktion von Menschen in der Arbeitswelt liefern. Kapitel 4 widmet sich dem Thema Führungskompetenz und beleuchtet die ethischen Aspekte, die bei der Führung von Mitarbeitern zu beachten sind. Kapitel 5 geht detailliert auf die Bedeutung der Kommunikation als Instrument der Mitarbeiterführung ein und analysiert die Kunst des Fragens sowie die Rolle von Mitarbeitergesprächen.
Schlüsselwörter
Mitarbeiterführung, Kommunikation, Führungstheorie, Ethische Aspekte, Mitarbeitergespräche, Gesprächskultur, Interaktion, Watzlawick, Schulz von Thun, Fragenstellen, Führungsinstrument.
- Arbeit zitieren
- Tim Grupe (Autor:in), 2018, Kommunikation als Instrument der Mitarbeiterführung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/504460