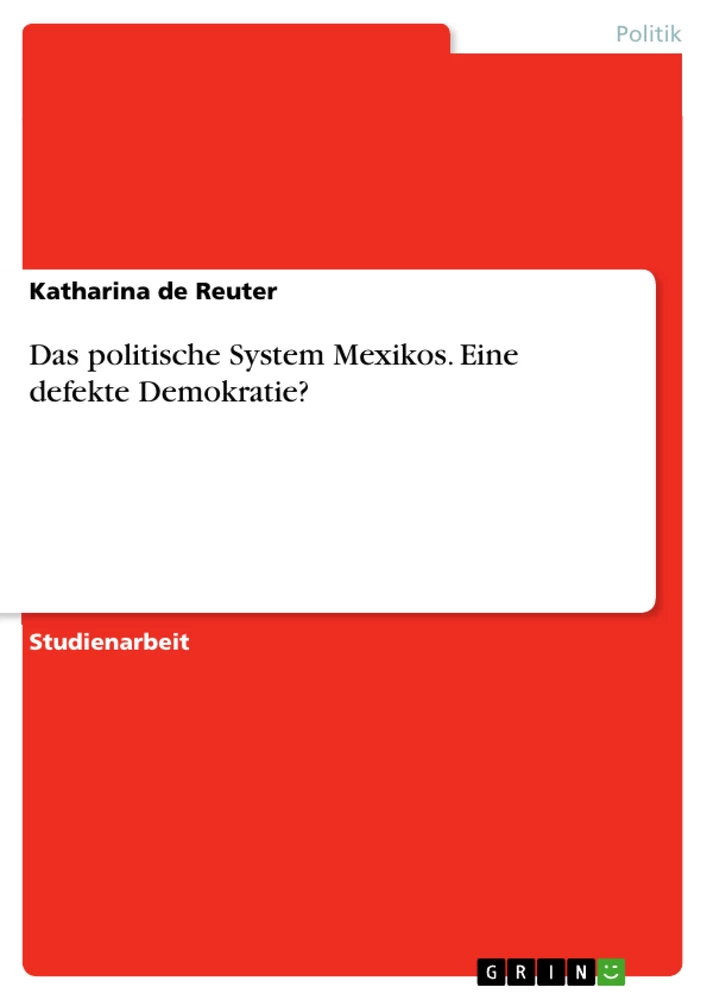Die folgende Arbeit beschäftigt sich mit dem politischen System Mexikos und geht dabei spezifisch auf die Frage ein, ob Mexiko eine defekte Demokratie ist oder nicht. Für das Verständnis soll die Arbeit vorerst einen kurzen historischen Überblick geben. Der Fokus soll auf bedeutenden Ereignissen in der Geschichte liegen, welche Mexikos Gegenwart geprägt haben. Aufbauend auf diesem Wissen soll das politische System dargestellt werden, indem auf die Verfassung, die Institutionen, das Wahlsystem sowie auf die Parteien eingegangen wird. Anschließend gibt die Arbeit Aufschluss über die Problematik der Drogenkartelle in Mexiko, da diese große Auswirkungen auf das politische System haben. Daraufhin folgt der Schwerpunkt der Arbeit und die Beantwortung der Frage, ob Mexiko ein defekt demokratisches System ist und wenn ja, welchen Typus einer defekten Demokratie es darstellt. Abschließend soll ein Zukunftsausblick folgen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Transformationsprozesse Mexikos
- 3. Mexikos politisches System
- 3.1 Verfassung und Gewaltenteilung
- 3.2 Parteien und Präsidenten
- 3.3 Wahlfälschung
- 4. Drogenkartelle und Korruption in Mexiko
- 5. Mexiko - Eine defekte Demokratie?
- 6. Zukunftsausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem politischen System Mexikos und untersucht, ob es sich um eine defekte Demokratie handelt. Hierzu wird zunächst ein kurzer historischer Überblick gegeben, der die bedeutendsten Ereignisse in der Geschichte Mexikos beleuchtet und deren Einfluss auf die Gegenwart herausstellt. Darauf aufbauend wird das politische System Mexikos analysiert, wobei die Verfassung, die Institutionen, das Wahlsystem und die Parteien im Fokus stehen. Anschließend wird die Problematik der Drogenkartelle in Mexiko beleuchtet, da diese erhebliche Auswirkungen auf das politische System haben. Im Zentrum der Arbeit steht die Beantwortung der Frage, ob Mexiko ein defekt demokratisches System ist und wenn ja, um welchen Typus einer defekten Demokratie es sich handelt. Abschließend wird ein Zukunftsausblick gegeben.
- Transformationsprozesse in der Geschichte Mexikos
- Analyse des politischen Systems Mexikos
- Auswirkungen der Drogenkartelle auf das politische System
- Defekte Demokratie in Mexiko: Definition und Analyse
- Zukunftsperspektive für Mexiko
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und skizziert den Aufbau und die zentralen Fragestellungen.
2. Transformationsprozesse Mexikos
Dieses Kapitel bietet einen kurzen historischen Überblick über bedeutende Ereignisse, die das heutige Mexiko geprägt haben, wie z.B. die Eroberung durch die Spanier, den Unabhängigkeitskrieg und die Revolution von 1910.
3. Mexikos politisches System
In diesem Kapitel wird das politische System Mexikos im Detail analysiert, wobei die Verfassung, die Gewaltenteilung, die Parteien und das Wahlsystem beleuchtet werden.
4. Drogenkartelle und Korruption in Mexiko
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Problematik der Drogenkartelle in Mexiko und deren Einfluss auf das politische System.
5. Mexiko - Eine defekte Demokratie?
In diesem Kapitel wird die Frage, ob Mexiko eine defekte Demokratie ist, untersucht und analysiert.
Schlüsselwörter
Mexiko, politisches System, Demokratie, Transformationsprozesse, Drogenkartelle, Korruption, Verfassung, Gewaltenteilung, Parteien, Wahlsystem, Geschichte, Gegenwart, Zukunftsausblick
Häufig gestellte Fragen
Ist Mexiko eine defekte Demokratie?
Die Arbeit analysiert, ob Mexiko aufgrund von Problemen wie Korruption und Gewalt als defekte Demokratie einzustufen ist und welcher spezifische Typus dort vorliegt.
Welchen Einfluss haben Drogenkartelle auf Mexikos Politik?
Drogenkartelle untergraben die staatliche Souveränität, beeinflussen Wahlen durch Gewalt und fördern die Korruption innerhalb der Sicherheitsorgane und Institutionen.
Wie ist die Gewaltenteilung in Mexiko geregelt?
Die mexikanische Verfassung sieht eine klassische Aufteilung in Exekutive (Präsident), Legislative und Judikative vor, wobei der Präsident historisch eine sehr starke Stellung einnimmt.
Was waren wichtige Wendepunkte in Mexikos Transformationsprozess?
Bedeutende Ereignisse sind die Revolution von 1910, die lange Vorherrschaft der PRI-Partei und die schrittweise Demokratisierung gegen Ende des 20. Jahrhunderts.
Welche Rolle spielt Wahlfälschung in Mexiko?
Die Arbeit beleuchtet die historische Problematik der Wahlfälschung, die lange Zeit ein Hindernis für eine echte demokratische Entwicklung war.
- Citar trabajo
- Katharina de Reuter (Autor), 2019, Das politische System Mexikos. Eine defekte Demokratie?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/505160