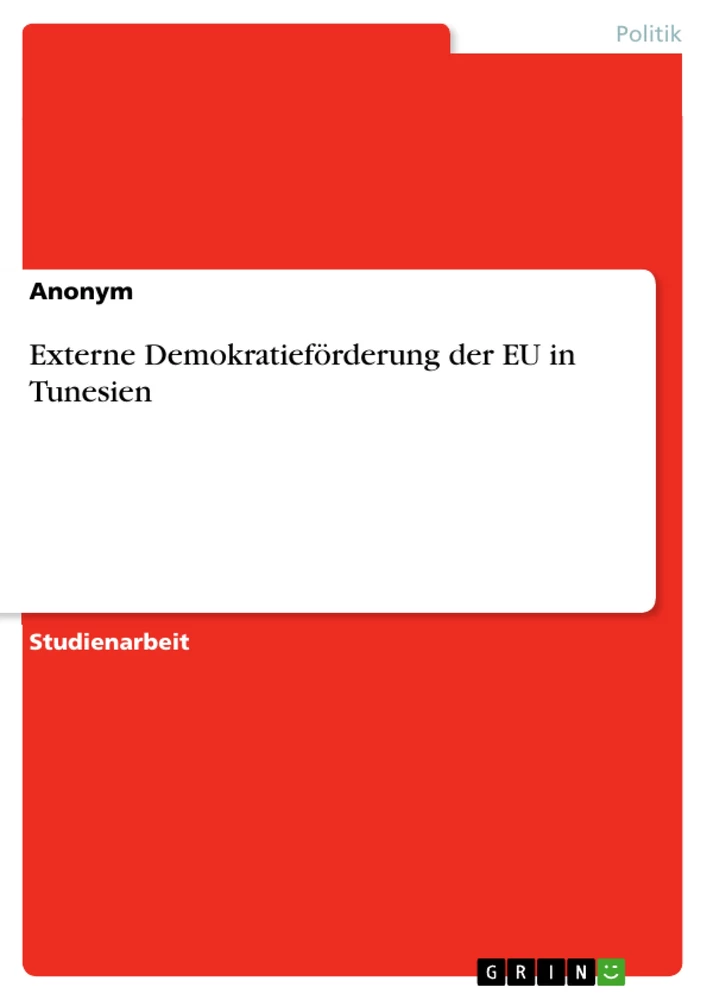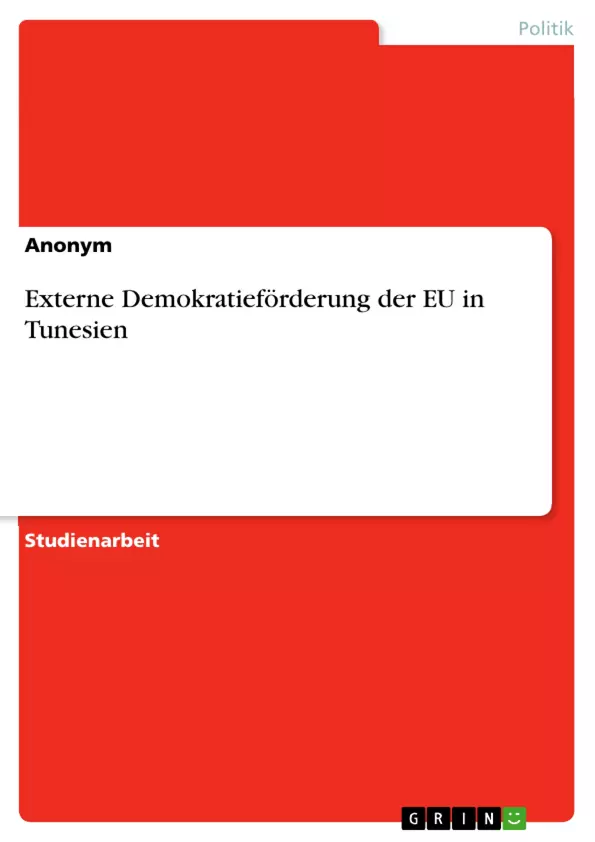Als Ursprungsland der arabischen Aufstände im Jahr 2011 gilt Tunesien acht Jahre später als einziger und letzter Hoffnungsträger für demokratische Entwicklung. Während in anderen arabischen Staaten wie Marokko und Ägypten weiterhin, bzw. wieder, autokratische Regimes regieren, konnte in Tunesien mit der neuen Verfassung von 2014 eine Demokratie aufgebaut werden, die jedoch nicht als konsolidiert gilt.
Seit der Verabschiedung der neuen Verfassung und den ersten freien Parlamentswahlen Tunesiens im Jahr 2014 hat das Land zwar viele Schritte der demokratischen Konsolidierung gemacht, jedoch steht die junge Demokratie aktuell vor großen Schwierigkeiten und Herausforderungen. Tunesien leidet seit langem unter mangelndem wirtschaftlichem Wachstum und es herrscht eine hohe Arbeitslosigkeit, vor allem unter der jungen Bevölkerung. Korruption ist weiterhin allgegenwärtig und wichtige politische Reformen wurden nicht durchgeführt. So wurde bis heute kein Verfassungsgericht eingerichtet, obwohl die neue Verfassung von 2014 dies vorsieht. Die Regierung der nationalen Einheit, die eine Form der Machtteilung primär zwischen der islamistischen Ennahda und der säkularen Partei Nidaa Tounes darstellt, ist gefährdet, da gut die Hälfte der Abgeordneten von Nidaa Tounes die Partei verlassen haben und sich teilweise der neu gegründeten Partei Coalition Nationale angeschlossen haben. Zu all diesen Entwicklungen kommt eine zunehmende Unzufriedenheit und mangelndes Vertrauen der Bevölkerung in die Politik. Vor diesem Hintergrund stellen die im September 2019 anstehenden Parlamentswahlen ein wichtiges Ereignis für die Demokratie Tunesiens dar.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Dokumentenanalyse
- 3. Die tunesische Systemtransformation
- 3.1 Systemtransformation nach Merkel
- 3.2 Tunesiens Entwicklung seit 2011 und Einordnung in die Transformationsphasen
- 4. Externe Demokratieförderung in Tunesien durch die EU
- 4.1 Modelle der Demokratieförderung der EU nach Lavenex und Schimmelfennig
- 4.2 Demokratieförderung durch die EU in Tunesien
- 4.2.1 Die EU und das Ben-Ali-Regime
- 4.2.2 Die Reaktion der EU auf Transition und Demokratisierung
- 4.3 Wahrnehmungen der EU-Demokratieförderung durch tunesische Akteure
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Beitrag der externen Demokratieförderung der EU zum tunesischen Demokratisierungsprozess seit 2011 im Rahmen der Europäischen Nachbarschaftspolitik (ENP).
- Einstufung Tunesiens in eine der Demokratisierungsphasen nach Merkels Theorie der Systemtransformation
- Analyse der EU-Demokratieförderung in Tunesien anhand der Modelle von Lavenex und Schimmelfennig (Linkage, Leverage, Governance)
- Bewertung der Wirksamkeit der EU-Demokratieförderung in Tunesien anhand der Wahrnehmung tunesischer Akteure
- Untersuchung des Einflusses der EU-Demokratieförderung auf die Bewältigung wichtiger Konflikte in Tunesien, insbesondere die Spaltung zwischen säkularen und religiösen Gruppierungen
- Analyse der Interessen der EU in Tunesien und deren Auswirkungen auf die Demokratieförderung
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
Die Einleitung stellt Tunesien als den einzigen Hoffnungsträger für demokratische Entwicklung nach den arabischen Aufständen 2011 vor. Sie skizziert die Herausforderungen, denen die junge tunesische Demokratie gegenübersteht, wie Wirtschaftsprobleme, Korruption und politische Instabilität. Außerdem wird die Rolle der EU als externer Akteur im tunesischen Demokratisierungsprozess beleuchtet.
- Kapitel 2: Dokumentenanalyse
Dieses Kapitel erläutert die Methodik der Forschungsarbeit, die auf einer Dokumentenanalyse basiert. Es werden die verwendeten Quellen, wie wissenschaftliche Aufsätze, Studien, Zeitungsartikel und andere Dokumente, vorgestellt.
- Kapitel 3: Die tunesische Systemtransformation
Kapitel 3 analysiert die aktuelle politische Situation in Tunesien und ordnet das Land anhand von Merkels Theorie der Systemtransformation in eine der Demokratisierungsphasen ein.
- Kapitel 4: Externe Demokratieförderung in Tunesien durch die EU
Dieses Kapitel untersucht die Demokratieförderung der EU in Tunesien im Rahmen der ENP. Es werden verschiedene Modelle der EU-Demokratieförderung nach Lavenex und Schimmelfennig vorgestellt und auf Tunesien angewendet. Weiterhin wird die Wahrnehmung der EU-Demokratieförderung durch tunesische Akteure beleuchtet.
Schlüsselwörter
Externe Demokratieförderung, Europäische Union, Europäische Nachbarschaftspolitik (ENP), Tunesien, Demokratisierungsprozess, Systemtransformation, Modell von Merkel, Modelle von Lavenex und Schimmelfennig (Linkage, Leverage, Governance), Wahrnehmung, Konfliktlinien, Säkularismus, Religion, Stabilisierung
Häufig gestellte Fragen
Wie wird der Stand der Demokratie in Tunesien nach 2011 bewertet?
Tunesien gilt als einziger Hoffnungsträger des Arabischen Frühlings. Trotz der Verfassung von 2014 ist die Demokratie jedoch nicht konsolidiert und steht vor Herausforderungen wie Korruption und wirtschaftlicher Instabilität.
Welche Modelle nutzt die EU zur Demokratieförderung?
Die Arbeit analysiert die Förderung anhand der Modelle von Lavenex und Schimmelfennig, die zwischen Linkage (Verflechtung), Leverage (Hebelwirkung) und Governance unterscheiden.
Was sind die größten Hindernisse für Tunesiens Demokratie?
Dazu zählen mangelndes Wirtschaftswachstum, hohe Jugendarbeitslosigkeit, das Fehlen eines Verfassungsgerichts und die politische Spaltung zwischen säkularen und religiösen Kräften (Ennahda vs. Nidaa Tounes).
Wie nehmen tunesische Akteure die Hilfe der EU wahr?
Die Arbeit untersucht die Wirksamkeit der EU-Maßnahmen aus der Perspektive lokaler Akteure, wobei oft ein Spannungsfeld zwischen Demokratieförderung und den Stabilitätsinteressen der EU besteht.
Welche Rolle spielt die Europäische Nachbarschaftspolitik (ENP)?
Die ENP bildet den rechtlichen und strategischen Rahmen, in dem die EU versucht, durch finanzielle Unterstützung und Kooperation demokratische Standards in Tunesien zu etablieren.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2019, Externe Demokratieförderung der EU in Tunesien, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/506066