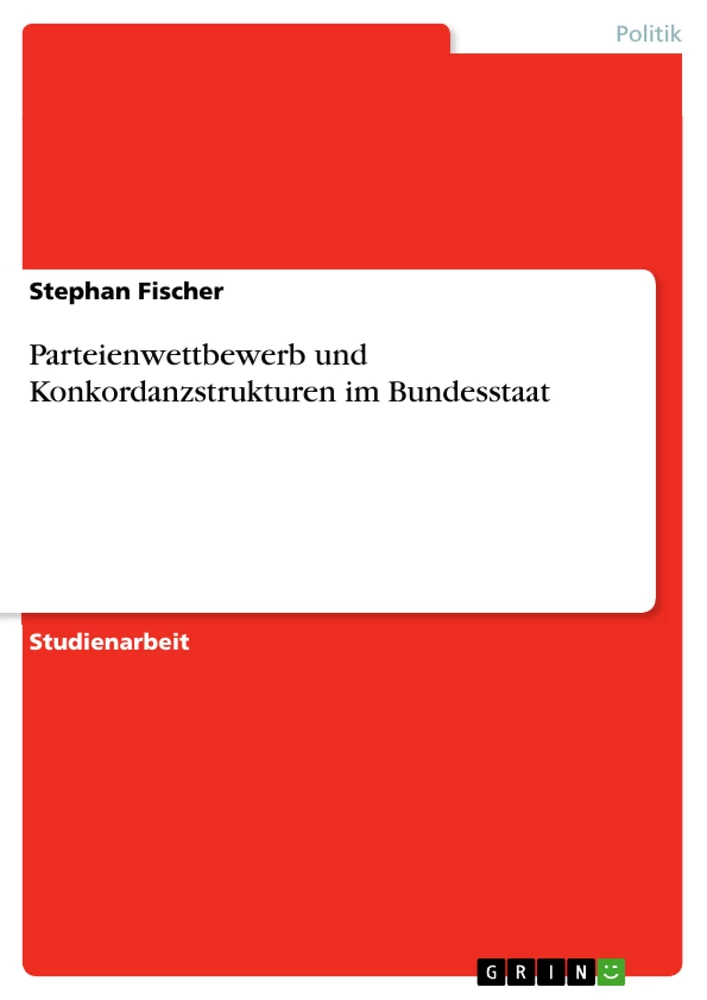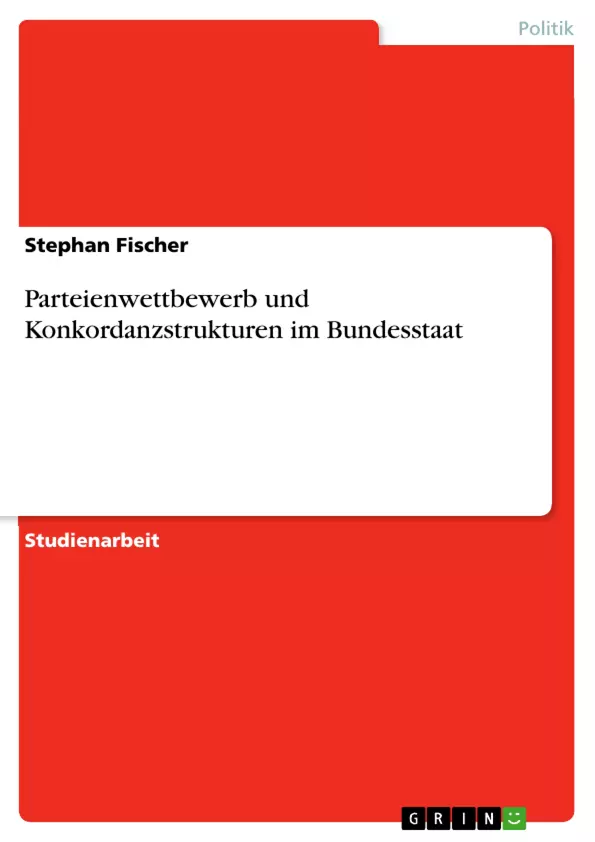Im Jahre 1976 konstatiert Gerhard Lehmbruch, dass die politische Entwicklung in Deutschland durch einen sich verschärfenden Gegensatz zwischen bundesstaatlichen Prinzipien und Parteienwettbewerb gekennzeichnet sei. Diese Entwicklung ist durch eine „zunehmende Inkongruenz zweier Subsysteme, also einem Strukturbruch, charakterisiert: Im Parteiensystem setzt sich ein Modell der Konfliktregelung durch, das gegenläufig zu den hergebrachten R egeln der Konfliktaustragung im Bundesstaat ist. Darin zeigt sich eine partielle Diskontinuität der politischen Strukturen: Der Föderalismus der Bundesrepublik Deutschland verdankt der bismarckischen Staatsgründung nicht nur wichtige Elemente der institutionellen Konstruktion, sondern hat auch charakteristische Regeln der Konfliktaustragung von daher überno mmen. In starkem Gegensatz zu dieser ausgeprägten Kontinuität steht die Entwicklung es Parteiensystems. Hier haben sich nach 1945 erhebliche strukturelle Wandlungen vollzogen, und als Folge dieser Wandlungen haben sich neue Strategien der Konfliktregelung durchgesetzt, die dem Parteiensystem des Kaiserreichs und der Weimarer Republik ziemlich fremd waren. Diese neuen Strategien aber konkurrieren nun mit den überkommenen Regeln bundesstaatlicher Entscheidungsprozesse.“ Klaus von Beyme gelangt zu einem ähnlichen Urteil. Für ihn sind die politischen Parteien zentralisierende Kräfte, während der Föderalismus darauf ausgerichtet sei, die politische und administrative Macht zwischen dem Zentralstaat und den Gliedstaaten aufzuteilen. Die föderativen Strukturen in der Bundesrepublik Deutschland werden von der Entscheidungslogik einer Verhandlungsdemokratie bestimmt, während das Parteiensystem durch die Entsche idungslogik einer Konkurrenzdemokratie charakterisiert ist. Daraus resultieren immer wieder systemische Einordnungsprobleme der Bundesrepublik Deutschland. Trägt die Bundesrepublik eher parlamentarisch- parteienstaatlichmehrheitsdemokratische Züge oder ve rfügt das politische System eher über proporz- bzw. konkordanzdemokratische Eigenschaften?
Inhaltsverzeichnis
- Hauptteil
- Einleitung
- Die Idealtypen der Konkurrenz- und Konkordanzdemokratie
- Das politische System der Bundesrepublik Deutschland zwischen Konkurrenz und Konkordanz
- Die Bundesrepublik als Konkurrenzdemokratie und die Logik des Parteiensystems
- Die Bundesrepublik als Konkordanzdemokratie
- Der deutsche Föderalismus
- Die Koalitionsregierungen
- Der deutsche Korporatismus
- Weitere konkordanzdemokratische Elemente und Verzerrungen
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Spannungen zwischen föderativen Strukturen und Parteienwettbewerb im politischen System der Bundesrepublik Deutschland. Sie analysiert die Rolle der Konkordanzdemokratie im Kontext des deutschen Föderalismus und des Parteiensystems.
- Der Gegensatz zwischen bundesstaatlichen Prinzipien und Parteienwettbewerb in Deutschland
- Die Charakteristika der Konkurrenz- und Konkordanzdemokratie
- Der Einfluss des deutschen Föderalismus auf die Entscheidungslogik
- Die Auswirkungen von Koalitionsregierungen und Korporatismus auf das politische System
- Die Einstufung der Bundesrepublik als "Zwitterding" zwischen Konkurrenz- und Konkordanzdemokratie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung legt den Fokus auf die Kontroverse zwischen föderativen Strukturen und dem Wettbewerb der Parteien in Deutschland. Sie führt den Begriff der "Diskontinuität" der politischen Strukturen ein und beleuchtet die unterschiedlichen Entwicklungslinien des Parteiensystems und des Bundesstaates.
Das erste Kapitel stellt die Idealtypen der Konkurrenz- und Konkordanzdemokratie vor. Es werden die jeweiligen Entscheidungsmechanismen und Integrationsmöglichkeiten der beiden Demokratietypen beschrieben, wobei besonders die Logik der Konfliktlösung und die Integration von Minderheiten betrachtet werden.
Das zweite Kapitel analysiert die Bundesrepublik Deutschland als ein System, das sowohl Merkmale der Konkurrenz- als auch der Konkordanzdemokratie aufweist. Es untersucht die Rolle des deutschen Föderalismus, die Besonderheiten von Koalitionsregierungen und die Bedeutung des deutschen Korporatismus für die Entstehung eines konkordanzdemokratischen Systems.
Schlüsselwörter
Konkurrenzdemokratie, Konkordanzdemokratie, Parteienwettbewerb, Föderalismus, Koalitionsregierungen, Korporatismus, Verhandlungsdemokratie, Mehrheitsdemokratie, Proporzdemokratie, Bundesrepublik Deutschland, Bundesstaat, politische Strukturen, Konfliktlösung, Integration, Minderheiten
Häufig gestellte Fragen
Warum stehen Föderalismus und Parteienwettbewerb in Deutschland im Konflikt?
Der Föderalismus basiert auf Verhandlungen und Proporz (Konkordanz), während das Parteiensystem auf Wettbewerb und Mehrheitsentscheidungen (Konkurrenz) ausgerichtet ist.
Was ist der Unterschied zwischen Konkurrenz- und Konkordanzdemokratie?
In der Konkurrenzdemokratie entscheidet die Mehrheit über die Minderheit. In der Konkordanzdemokratie werden Minderheiten durch Verhandlungen und Kooperationen in den Entscheidungsprozess einbezogen.
Warum wird die Bundesrepublik Deutschland oft als „Zwitterding“ bezeichnet?
Weil sie sowohl Merkmale einer Mehrheitsdemokratie (Parteienwettbewerb) als auch einer Verhandlungsdemokratie (Bundesrat, Koalitionen, Korporatismus) in sich vereint.
Welche Rolle spielt der Korporatismus im deutschen System?
Der deutsche Korporatismus ist ein konkordanzdemokratisches Element, bei dem organisierte Interessen (z.B. Verbände) eng in politische Entscheidungsprozesse eingebunden sind.
Wie beeinflussen Koalitionsregierungen die Entscheidungslogik?
Koalitionen zwingen die Parteien dazu, von der reinen Konkurrenzlogik abzuweichen und Kompromisse im Sinne einer Konkordanz zu finden.
- Quote paper
- Stephan Fischer (Author), 2003, Parteienwettbewerb und Konkordanzstrukturen im Bundesstaat, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/50612