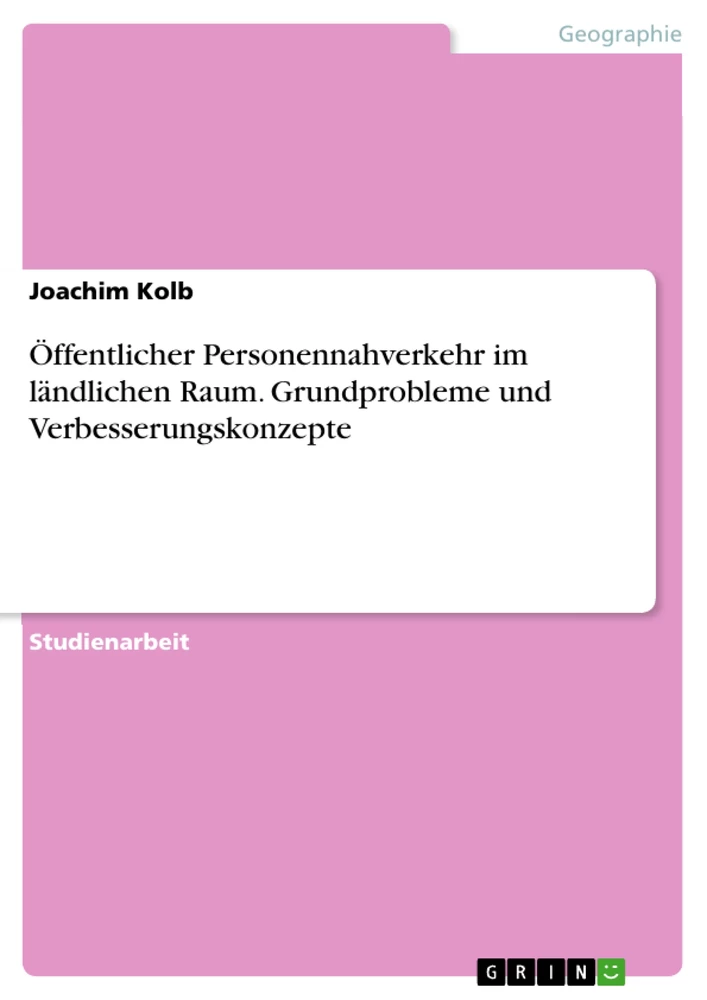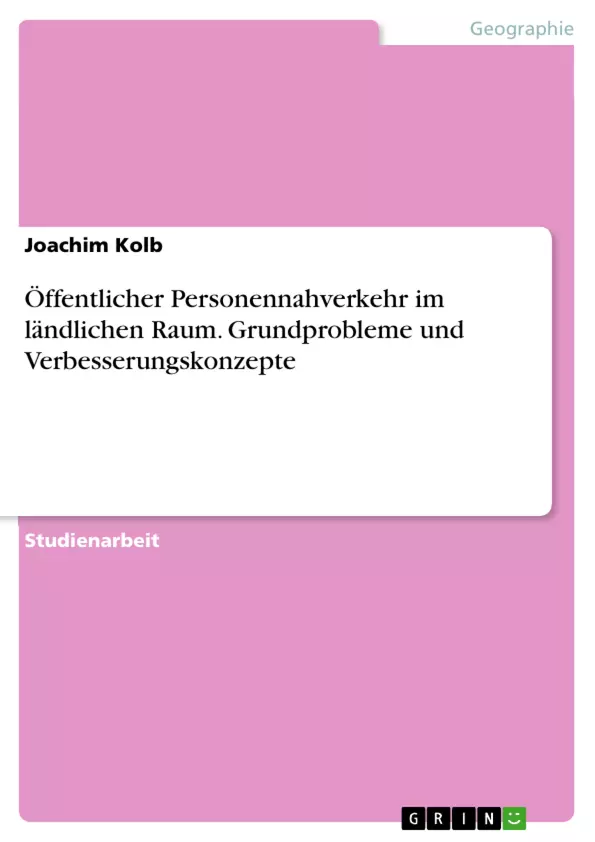Diese Arbeit befasst sich mit der Situation und Problemen des öffentlichen Personennahverkehrs und stellt Verbesserungsvorschläge vor. Man unterscheidet zwei Arten der Verkehrsteilnahme. Eine Möglichkeit, am Verkehr teilzunehmen, ist der Individualverkehr, den man noch in den motorisierten (PKW) und den nicht-motorisierten Individualverkehr (zu Fuß, Fahrrad) untergliedern kann. Die andere Möglichkeit ist die Nutzung des öffentlichen Personenverkehrs. Hier wird zwischen dem öffentlichen Personenfernverkehr und dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) unterschieden. Um nun den ÖPNV vom Fernverkehr abzugrenzen, hat man den ÖPNV als genehmigten Linienverkehr innerhalb einer Gemeinde oder einer Beförderungsstrecke von unter 50 km festgelegt.
Das vorherrschende Organisationsprinzip des öffentlichen Personenverkehrs ist die Eigentümerabhängigkeit und -haftung. Den Ordnungsrahmen für den ÖPNV bildet das Personenbeförderungsgesetz, welches ein Linienkonzessionssystem mit dem Ziel der Eigenwirtschaftlichkeit des ÖPNVs vorschreibt. Der ÖPNV ist, obwohl Bundesbahn und -post sowie kommunale Verkehrsbetriebe den öffentlichen Personennahverkehr durchführen, nicht als öffentliche Aufgabe der Daseinsversorgung geregelt.
Grundprobleme im ländlichen Raum sind erstens eine geringe Bevölkerungsdichte und zweitens disperse Siedlungsstrukturen, die beide als kosten- und risikobezogene Infrastrukturkriterien gelten. Weitere Probleme sind das Fehlen leistungsfähiger Oberzentren sowie die periphere Lage zu den Hauptwirtschaftszentren und Verdichtungsräumen des Bundesgebietes. Dies wird noch durch die fehlende oder nicht ausreichende Anbindung an das Fernverkehrsnetz verstärkt. Aus den erwähnten Grundproblemen des ländlichen Raumes ergeben sich auch Probleme für den ÖPNV, da durch die geringe Verdichtung die Zugänglichkeit der Verkehrsbedienung durch Massenverkehrsmittel erschwert wird. Massenverkehrsmittel sind aus technischen und ökonomischen Gründen auf die Bündelung der Nachfrage angewiesen. Daraus folgt, dass im ländlichen Raum der flexiblere Individualverkehr begünstigt wird und daher die individuelle Motorisierung im ländlichen Raum auch stärker ausgeprägt ist als in Ballungsgebieten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition
- Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
- Ländlicher Raum
- Historische Entwicklung
- Die Entwicklung des ÖPNV`s bis zum Ersten Weltkrieg
- Die Entwicklung des ÖPNV`s nach dem Ersten Weltkrieg
- Aktuelle Situation des ÖPNV`s im ländlichen Raum
- Grundprobleme des ÖPNV`s im ländlichen Raum
- Vorhandenes ÖPNV-Netz
- Konzepte zur Verbesserung des vorhandenen ÖPNV-Netzes
- Verkehrsverbünde
- Großräumige Verkehrsgemeinschaften
- Konzepte zur Verbesserung des vorhandenen ÖPNV-Netzes
- Rahmenbedingungen des ÖPNV's
- Finanzierung
- Rechtliche Grundlagen
- Konzeptionelle Überlegungen einer Neuordnung des ÖPNV`s im ländlichen Raum
- Alternative Formen der Verkehrsbedienung
- Das mehrstufige differenzierte Bedienungsmodell
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der aktuellen Situation des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) im ländlichen Raum. Sie untersucht die historische Entwicklung, die bestehenden Herausforderungen und die Konzepte zur Verbesserung des ÖPNV-Angebots in ländlichen Gebieten.
- Historische Entwicklung des ÖPNV
- Herausforderungen des ÖPNV im ländlichen Raum
- Konzepte zur Verbesserung des ÖPNV-Netzes
- Rahmenbedingungen des ÖPNV im ländlichen Raum
- Alternative Formen der Verkehrsbedienung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert den Zusammenhang zwischen Grund-Daseinsfunktionen und der Nutzung des ÖPNV. Kapitel 2 definiert die Begriffe „ÖPNV“ und „ländlicher Raum“. Kapitel 3 beleuchtet die historische Entwicklung des ÖPNV, beginnend mit der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg bis zur Entwicklung nach dem Ersten Weltkrieg. Kapitel 4 analysiert die aktuelle Situation des ÖPNV im ländlichen Raum. Hier werden die Grundprobleme des ÖPNV und das vorhandene ÖPNV-Netz untersucht. Das Kapitel befasst sich außerdem mit Konzepten zur Verbesserung des vorhandenen ÖPNV-Netzes, einschließlich Verkehrsverbünden und großräumigen Verkehrsgemeinschaften. Zu den Rahmenbedingungen des ÖPNV gehören die Finanzierung und die rechtlichen Grundlagen, die ebenfalls in Kapitel 4 erörtert werden. Kapitel 5 beschäftigt sich mit konzeptionellen Überlegungen einer Neuordnung des ÖPNV im ländlichen Raum. Es werden alternative Formen der Verkehrsbedienung und das mehrstufige differenzierte Bedienungsmodell vorgestellt.
Schlüsselwörter
Öffentlicher Personennahverkehr, ländlicher Raum, Grund-Daseinsfunktionen, historische Entwicklung, aktuelle Situation, Konzepte zur Verbesserung, Verkehrsverbünde, großräumige Verkehrsgemeinschaften, Finanzierung, rechtliche Grundlagen, alternative Formen der Verkehrsbedienung, mehrstufige differenzierte Bedienungsmodelle.
Häufig gestellte Fragen
Was definiert den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)?
Der ÖPNV ist rechtlich als genehmigter Linienverkehr definiert, der innerhalb einer Gemeinde stattfindet oder eine Beförderungsstrecke von unter 50 km umfasst.
Warum ist der ÖPNV im ländlichen Raum besonders schwierig?
Geringe Bevölkerungsdichte und disperse Siedlungsstrukturen machen Massenverkehrsmittel unrentabel, da diese auf eine Bündelung der Nachfrage angewiesen sind.
Welche Rolle spielt das Personenbeförderungsgesetz?
Es bildet den Ordnungsrahmen und schreibt ein Linienkonzessionssystem vor, das primär auf das Ziel der Eigenwirtschaftlichkeit ausgerichtet ist.
Was sind alternative Formen der Verkehrsbedienung?
Dazu gehören flexible Modelle wie Rufbusse, Sammeltaxis oder mehrstufige Bedienungsmodelle, die besser auf die geringe Nachfrage im ländlichen Raum reagieren können.
Wie beeinflusst der Individualverkehr den ÖPNV auf dem Land?
Da der ÖPNV oft unzureichend ist, ist die individuelle Motorisierung (Pkw) im ländlichen Raum stärker ausgeprägt, was die Nachfrage nach öffentlichen Mitteln weiter sinken lässt.
- Quote paper
- Joachim Kolb (Author), 1994, Öffentlicher Personennahverkehr im ländlichen Raum. Grundprobleme und Verbesserungskonzepte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/506754