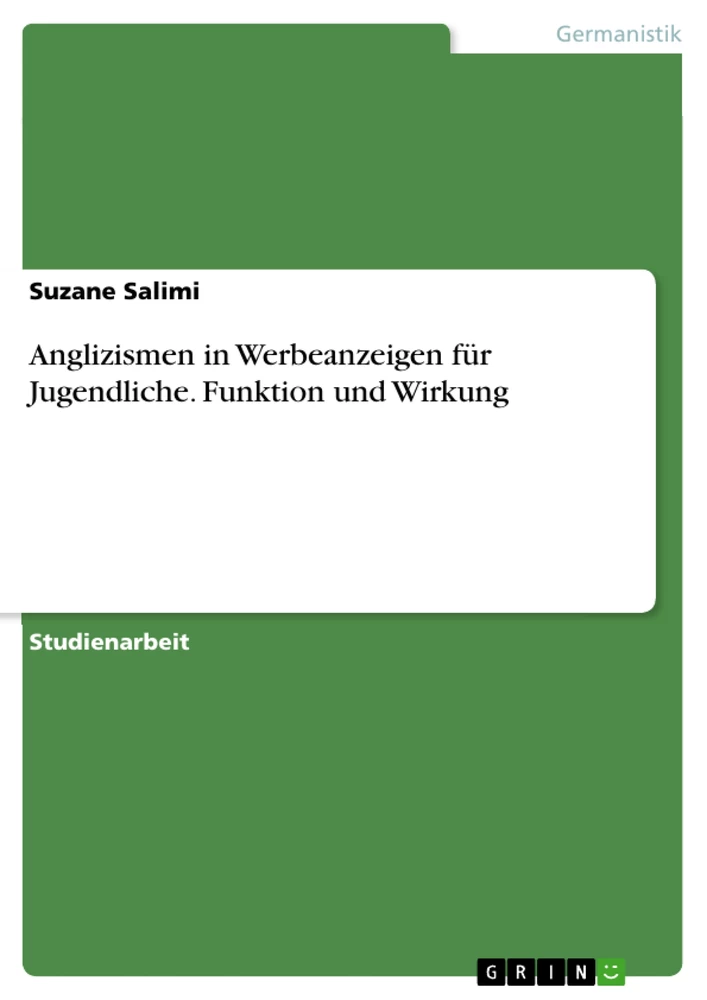Diese Arbeit klärt, in welcher Form und aus welchen Gründen Anglizismen in Werbungen integriert werden, die sich an Jugendliche richten. Im heutigen Informationszeitalter ist Werbung im alltäglichen Leben allgegenwärtig. Neben traditionellen Formen der Werbung wie beispielsweise Anzeigen-, Plakat- oder Fernsehwerbungen, sind auch modernere Arten der Werbung, wie personalisierte Anzeigen auf Social-Media-Plattformen oder als redaktionelle Inhalte getarnte Werbetexte auf Internetseiten und in Printmedien, längst weit verbreitet. Jugendkultur und Medienkonsum sind im heutigen medialen Zeitalter eng verknüpft. Diese omnipräsente Reiz- und Informationsüberflutung fordert immer neue Strategien von Werbetreibenden, um so effektiv wie möglich auf ihr Produkt aufmerksam zu machen. Dies äußert sich nicht zuletzt in der speziell an junge Zielgruppen angepassten sprachlichen Gestaltung von Werbungen. Anzeigen, die sich an Jugendliche richten, werden mit jugendsprachlichen Ausdrücken und Stilmitteln ausgeschmückt, um ein Produkt besonders für diese Altersgruppe attraktiver erscheinen zu lassen. Dabei sind gerade Anglizismen ein oft verwendetes Instrument der Werbekommunikation mit einer jungen Zielgruppe.
Einerseits kann die Verwendung von Fremdwörtern in der Sprache der Werbung Schwierigkeiten in sich bergen, weil Verständlichkeit und Identifizierbarkeit der Werbeaussage leiden können. Andererseits ist es unter werbepsychologischen Aspekten sinnvoll, Fremdwörter zu gebrauchen, beispielsweise in Form von Produktnamen oder bei anderen Bezeichnungen, die auf die unverwechselbare Markierung der Produktherkunft abzielen. Zunächst soll ermittelt werden, welchen Stellenwert Anglizismen generell in kommerziellen Werbetexten einnehmen. Die Funktion und Integration von englischsprachigen Ausdrücken in der Werbekommunikation soll hier hinsichtlich stilistischer Wirkung und Pragmatik betrachtet werden.
Inhalt
1. Einleitung
2. Allgemeine Funktionen und Integration von Anglizismen in der Werbung
2.1. Anglizismen als Stilmittel
2.2. Pragmatische Funktionen
3. Jugendliche als Werbezielgruppe
4. Analyse ausgewählter Beispiele
4.1„Garnier Skin Active“ – Anzeige aus der Aktuellen „Bravo“
4.1.1. Aufbau und Zielgruppenrelevanz
4.1.2. Englischsprachige Elemente
4.2 Anzeige für eine E-Paper Version des Magazins aus der aktuellen „Popcorn“
4.2.1 Aufbau und Zielgruppenrelevanz
4.2.2 Englischsprachige Elemente
4.3 Im redaktionellen Inhalt integrierte Werbung aus der aktuellen „Mädchen“
4.3.1 Aufbau und Zielgruppenrelevanz
4.3.2 Englischsprachige Elemente
5. Fazit
6. Anhang
7. Quellen
-
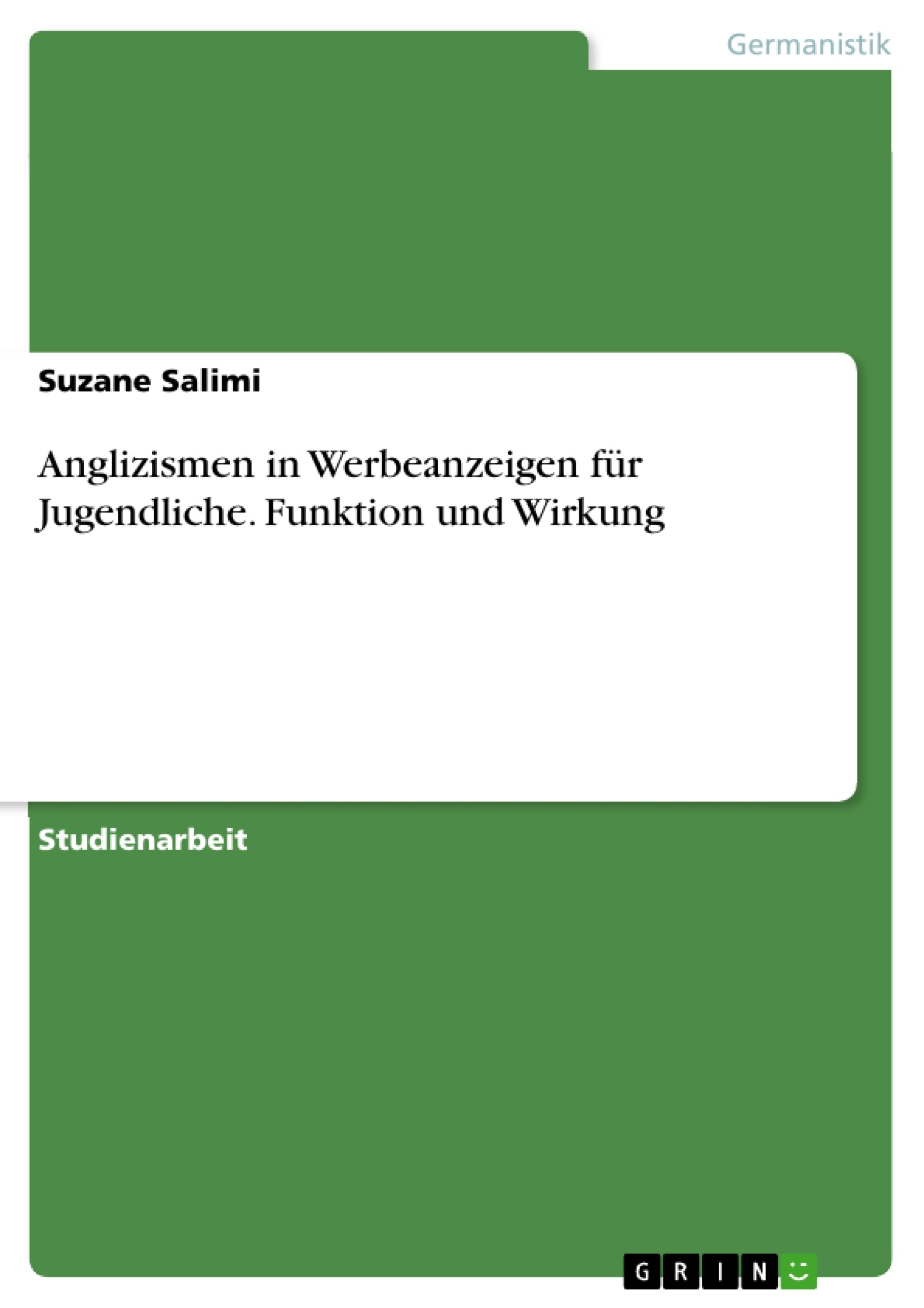
-

-

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen.