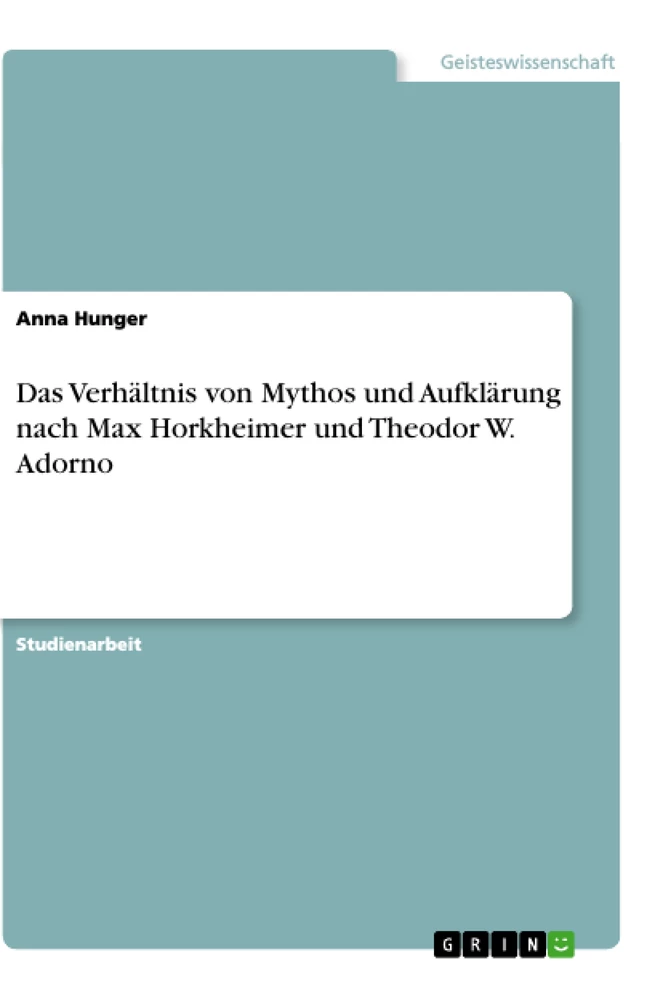Im Folgenden soll rekonstruiert werden, wie Max Horkheimer und Theodor W. Adorno das Verhältnis von Mythos und Aufklärung bestimmen.
In dem Werk "Dialektik der Aufklärung" von Adorno und Horkheimer gehen die Verfasser auf die Frage ein, warum die Menschheit, anstatt in einen wahrhaft menschlichen Zustand einzutreten, in eine neue Art von Barbarei versinkt, indem sie den Begriff der Aufklärung radikaler Kritik unterziehen. Das Buch entstand zwischen 1939 und 1944 im kalifornischen Exil, zu dem die Verfasser aufgrund der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland gezwungen waren. Es zählt zu den grundlegendsten Werken der Kritischen Theorie der Frankfurter Schule.
-
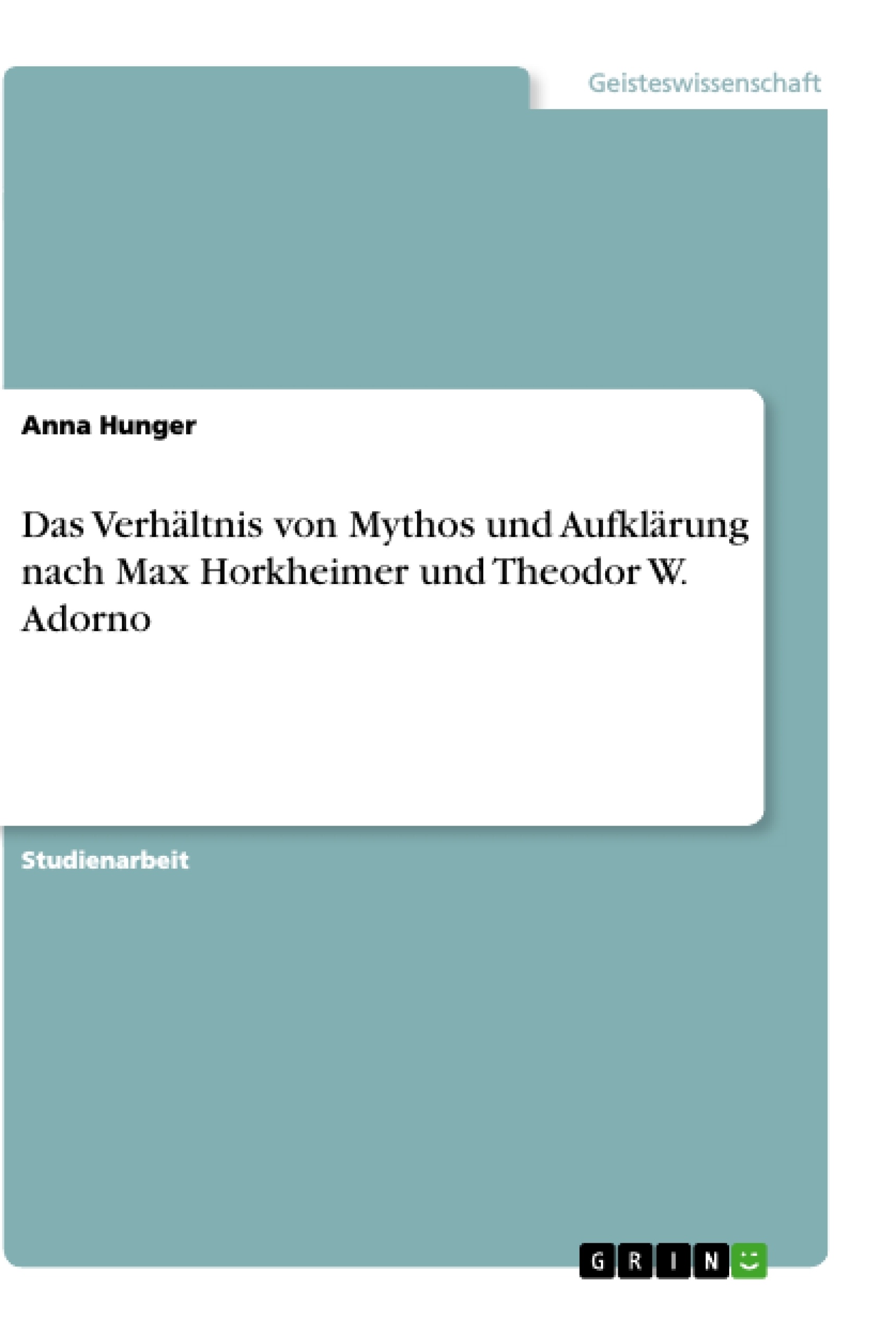
-

-

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen.