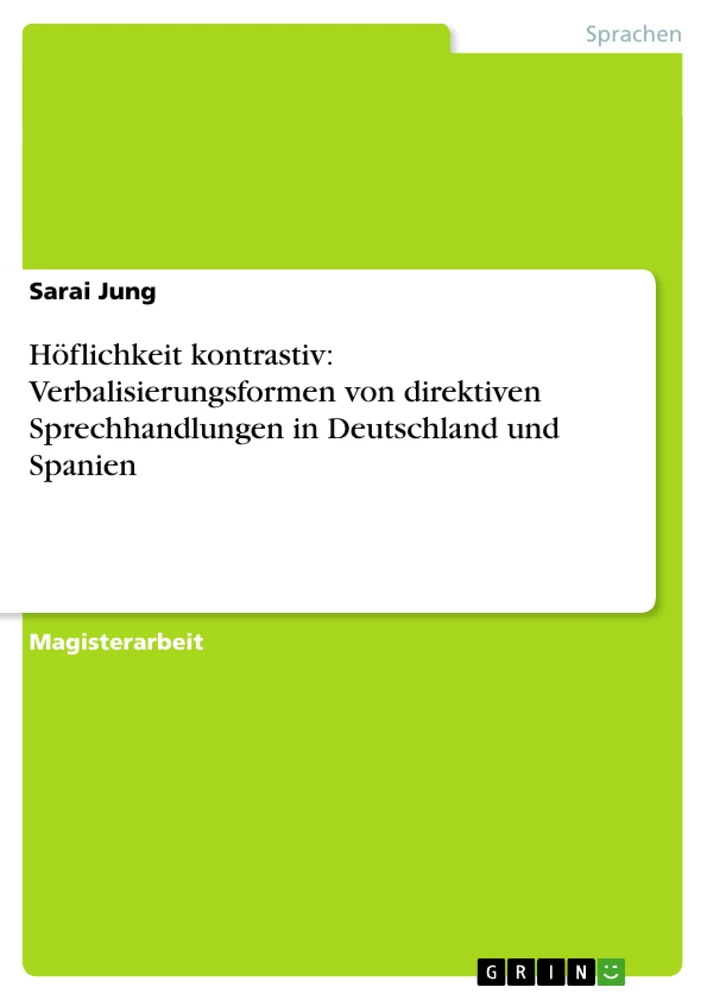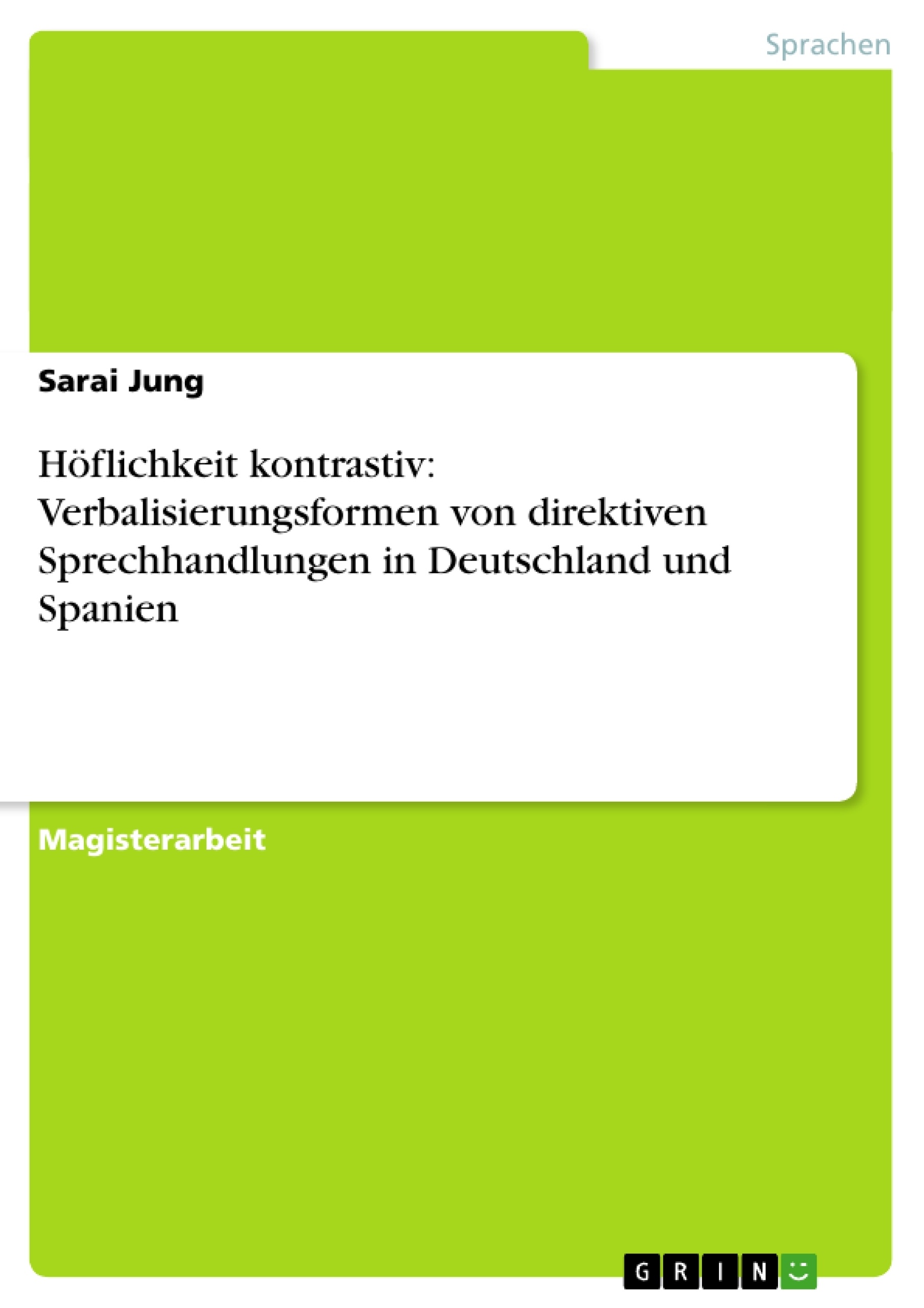Wenn auch in unterschiedlicher Weise, so findet sich Höflichkeit doch in allen Gesellschaftsformen. Sie verfolgt das übergeordnete Ziel einer Gesellschaft, das soziale Miteinader einzelner Individuen auf der Basis von gemeinsamen Wertstrukturen zu sichern und so reibungslos wie möglich zu gestalten. In allen Kulturen haben sich dabei über Jahrhunderte hinweg Prioritäten hinsichtlich wegweisender Werte herauskristallisiert, die in ihrer Gesamtheit für den Inhalt spezifischer sozialer Normen verantwortlich sind. Sie haben zur Herausbildung sprachlicher Routinen und Konventionen, sowie zu kulturell bedingten Erwartungshaltungen und Interpretationsschemata geführt.
Die vorliegende Arbeit versucht, einen ersten Ansatz für eine kontrastive Betrachtung des Deutschen und des Spanischen zu liefern. Die Grundlage für die Untersuchung bilden vor allem die klassischen Höflichkeitsmodelle von Lakoff (1973), Leech (1983), Brown & Levinson (1987) und Blum-Kulka et al. (1989) und die neueren Arbeiten im Rahmen der interkulturellen Forschung von Held (1994), Trosborg (1995) und Wierzbicka (1991). Diese theoretischen Grundlagen werden im ersten Teil ausführlich dargelegt. Zentrum der Arbeit bildet jedoch die Auswertung einer Untersuchung der tatsächlichen Sprachverwendung anhand einer Fragebogenerhebung, die an zwei Universitäten (Würzburg, Cádiz) durchgeführt wurde. Sie versucht einen eingehenden, aber sicherlich nicht erschöpfenden Einblick in sprachspezifische Realisierungsweisen der Bitte anhand von deutschen und spanischen Sprachdaten zu geben. Dabei wird zum einen das linguistische Repertoire gesammelt, zum anderen wird untersucht, ob sich klare kulturspezifische Differenzen und Präferenzen im Hinblick auf deren Verwendung zeigen, die Hinweise darauf geben könnten, dass sprachliche Strategien und Realisierungsweisen in den beiden untersuchten Sprechergruppen nicht das gleiche ‚höfliche’ Potential besitzen und grundlegend anderen Interpretationsschemata unterliegen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Sprachliche Höflichkeit: eine Annäherung
- 1.1.1. Höflichkeit als positive Beziehungsgestaltung
- 1.1.2. Höflichkeit als Konfliktvermeidung
- 1.1.3. Normen, Wertstrukturen und interkulturelle Differenzen
- 1.2. Methode, Gegenstand und Zielsetzung der vorliegenden Arbeit
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1. Grundlagen der Höflichkeitsforschung
- 2.1.1. Die Sprechakttheorie
- 2.1.2. Grice und das Kooperationsprinzip
- 2.1.3. Goffmans soziologische Betrachtungen
- 2.2.3.1. Der 'face' Begriff bei Brown & Levinson
- 2.2. Die klassischen Höflichkeitsmodelle
- 2.2.1. Lakoff
- 2.2.2. Leech
- 2.2.3. Brown & Levinson
- 2.2.3.2. 'Negative' und 'positive politeness'
- 2.2.3.3. Das Konzept der 'face threatening acts' (FTA)
- 2.2.3.4. Sprachliche Strategien zur Reduzierung des Konfliktpotentials
- 2.2.3.5. Kalkulation des Konfliktpotentials
- 2.2.3.6. Kritische Betrachtung
- 2.3. Interkulturelle Ansätze
- 2.3.1. Sprechakte interkulturell
- 2.3.2. 'Face' und 'face-work' interkulturell
- 2.3.2.1. Gruppenorientierte 'face'-Bedürfnisse
- 2.3.2.2. Soziale Nähe
- 2.3.2.3. Betonung von Gegenseitigkeit und Interdependenz
- 2.3.2.4. Herzlichkeit und Emotionalität
- 2.3.3. Höflichkeit, Soziale Harmonie und Konfliktvermeidung
- 2.3.4. Zusammenfassung und Ausblick
- 3. Auswertung der Antworten
- 3.1. Schwerpunkte der Analyse
- 3.1.1. 'Negative politeness' vs. 'positive politeness'
- 3.1.2. Struktur- und Handlungsebene
- 3.1.3. Einbettung
- 3.1.4. Interne Modalisierung
- 3.1.5. Analyse des Direktheitsgrades
- 3.1.6. Der Satzmodus
- 3.2. Direktheitsskala
- 3.2.1 Vergleich und Interpretation der Antworten
- 3.2.2. Perspektive: Vergleich und Interpretation
- 3.3. Strategien der 'negative politeness'
- 3.3.1. Abschwächung auf der Struktur- und Handlungsebene
- 3.3.1.1. Vorbereitende Phase
- 3.3.1.2. Argumentation und Hauptsprechhandlung
- 3.3.1.3. Nachbereitende Phase
- 3.3.2. Interne Modalisierung: Minimalisierung
- 3.3.2.1. Herabsetzung der Verantwortung
- 3.3.2.2. Entaktualisierung
- 3.3.2.2.1. Das Modalverbsystem
- 3.3.2.2.2. Tempus- und Modusverschiebung
- 3.3.2.2.3. Einschränkung der Gültigkeit
- 3.3.2.2.3. Präsequenzen
- 3.3.2.2.4. Vergleich und Interpretation
- 3.3.2.3. Kostensenkende und modifizierende Handlungsdarstellung
- 3.4. Strategien der 'positive politeness'
- 3.4.1. Maximalisierungstechniken
- 3.4.1.1. Temporale Angaben, Adverbien und Adjektive
- 3.4.1.2. Quantitative Adverbien und Gradpartikel Qualifizierung
- 3.4.1.3. Deontische Modalverben
- 3.4.1.4. Die Negation
- 3.4.1.5. Verpflichtung zur Gültigkeit der Äußerung
- 3.4.2. Verstärkung auf der Struktur- und Handlungsebene
- 3.4.2.1. Vorbereitende Phasen
- 3.4.2.2. Hauptsprechhandlung
- 3.4.2.3. Illokutionsindizierende Gesprächswörter
- 3.4.2.4. Argumentation
- 3.4.2.4.1. Notwendigkeit
- 3.4.2.4.2. Appell an das Gewissen
- 3.4.2.4.3. Wünsche und Pläne des Sprechers
- 3.4.2.4.5. Beziehungsdefinition
- 3.4.2.4.5. Vergleich und Interpretation der Antworten
- 3.4.3. Explizite Beziehungsgestaltung
- 3.4.3.1. Zuwendungsstrategien
- 3.4.3.1.1. Anredesystem
- 3.4.3.1.2. Nominale Anrede
- 3.4.3.1.3. Pronomina
- 3.4.3.2. Direkte Einbeziehung des Partners
- 3.4.3.2.1. Der Einsatz von 'cajolern'
- 3.4.3.2.2. Der Einsatz von 'appealern'
- 3.4.3.2.3. Evokation von geteiltem Wissen
- 3.4.3.2.4. Emotionalisierung
- 3.4.3.2.5. Vergleich und Interpretation der Ergebnisse
- 3.4.3.3. Beziehungsorientierte Nebensprechhandlungen
- 3.4.3.3.1. Entwaffnende Sprechhandlungen
- 3.4.3.3.2. Darlegung der beziehungsstärkenden Konsequenzen
- 3.4.3.4. Zusammenfassung und vergleichende Interpretation
- Die sprachlichen Formen von Höflichkeit in direktiven Sprechakten
- Die Unterschiede in der sprachlichen Umsetzung von Höflichkeit im Deutschen und Spanischen
- Die Bedeutung des kulturellen und sozialen Kontexts für die Verwendung von Höflichkeitsformen
- Die Rolle des 'face'-Konzepts bei der Gestaltung von Höflichkeitsstrategien
- Die Auswirkungen von interkulturellen Unterschieden auf die Kommunikation
- Kapitel 1: Einleitung
- Kapitel 2: Theoretische Grundlagen
- Kapitel 3: Auswertung der Antworten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Arbeit befasst sich mit dem Vergleich von sprachlichen Höflichkeitsstrategien in direktiven Sprechakten im Deutschen und Spanischen. Ziel ist es, die unterschiedlichen sprachlichen Formen der Höflichkeit in den beiden Sprachen zu analysieren und die zugrundeliegenden kulturellen und sozialen Faktoren zu beleuchten.
Zusammenfassung der Kapitel
Diese Einleitung führt den Leser in das Thema der sprachlichen Höflichkeit ein und beleuchtet die Bedeutung der pragmatischen Perspektive in der Linguistik. Die Kapitel 1.1 und 1.1.1 befassen sich mit verschiedenen Definitionsansätzen von Höflichkeit, wobei der Fokus auf der Gestaltung harmonischer zwischenmenschlicher Beziehungen liegt. Kapitel 1.1.2 stellt Höflichkeit als ein Mittel zur Konfliktvermeidung dar und unterstreicht den höheren Stellenwert von Höflichkeit im Vergleich zu Grice's Klarheitsprinzip. Abschließend wird in Kapitel 1.2 die Methode, der Gegenstand und die Zielsetzung der Arbeit vorgestellt.
In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen der Höflichkeitsforschung erörtert. Es werden die Sprechakttheorie, Grice's Kooperationsprinzip und Goffmans soziologische Betrachtungen zum 'face'-Konzept vorgestellt. Darüber hinaus werden die klassischen Höflichkeitsmodelle von Lakoff, Leech und Brown & Levinson mit ihren verschiedenen Ansätzen zur 'positive' und 'negative politeness' sowie zur Reduzierung von Konfliktpotential analysiert. Kapitel 2.3 widmet sich interkulturellen Ansätzen und untersucht die Bedeutung von 'face' und 'face-work' in verschiedenen Kulturen.
Dieses Kapitel analysiert die Ergebnisse der durchgeführten Untersuchung. Es werden die Schwerpunkte der Analyse, wie 'negative politeness' vs. 'positive politeness', Struktur- und Handlungsebene, Einbettung, interne Modalisierung, Direktheitsgrad und Satzmodus, detailliert erörtert. Die Ergebnisse werden anhand einer Direktheitsskala verglichen und interpretiert. Es werden die Strategien der 'negative politeness', wie Abschwächung und Minimalisierung, und die Strategien der 'positive politeness', wie Maximalisierung und Verstärkung, sowie die Auswirkungen auf die Beziehungsgestaltung untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Begriffen der sprachlichen Höflichkeit, direktiven Sprechakten, 'face', 'face-work', 'negative politeness', 'positive politeness', Konfliktvermeidung, interkulturelle Unterschiede, Deutlichkeitsskala, und die Analyse der sprachlichen Formen von Höflichkeit im Deutschen und Spanischen.
Häufig gestellte Fragen
Wie unterscheidet sich Höflichkeit in Deutschland und Spanien?
Die Arbeit untersucht kulturspezifische Präferenzen, wobei im Spanischen oft Strategien der „positive politeness“ (Nähe, Herzlichkeit) dominieren, während im Deutschen oft „negative politeness“ (Distanz, Sachlichkeit) genutzt wird.
Was sind direktive Sprechhandlungen?
Es handelt sich um Sprechakte wie Bitten oder Aufforderungen, bei denen der Sprecher den Hörer dazu bewegen möchte, eine Handlung auszuführen.
Was besagt das „Face“-Konzept von Brown & Levinson?
Es unterscheidet zwischen dem positiven Gesicht (Wunsch nach Anerkennung) und dem negativen Gesicht (Wunsch nach Unabhängigkeit), die durch Höflichkeitsstrategien geschützt werden.
Was ist der Unterschied zwischen interner und externer Modalisierung?
Interne Modalisierung nutzt sprachliche Mittel innerhalb des Satzes (z.B. Konjunktiv), während externe Modalisierung Begründungen oder Vorbereitungen um den Sprechakt herum nutzt.
Warum führen kulturelle Unterschiede zu Missverständnissen?
Da Höflichkeitsstrategien in verschiedenen Kulturen unterschiedliche Potenziale haben, kann eine direkte Bitte in einer Kultur als effizient, in einer anderen jedoch als unhöflich wahrgenommen werden.
- Quote paper
- Sarai Jung (Author), 2005, Höflichkeit kontrastiv: Verbalisierungsformen von direktiven Sprechhandlungen in Deutschland und Spanien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/50875