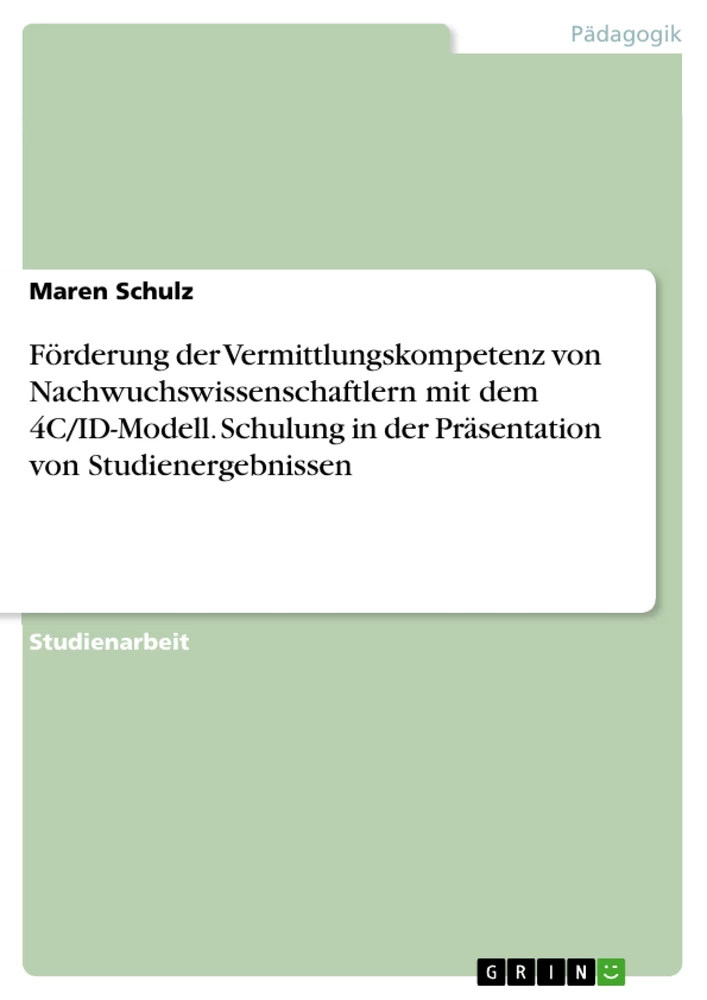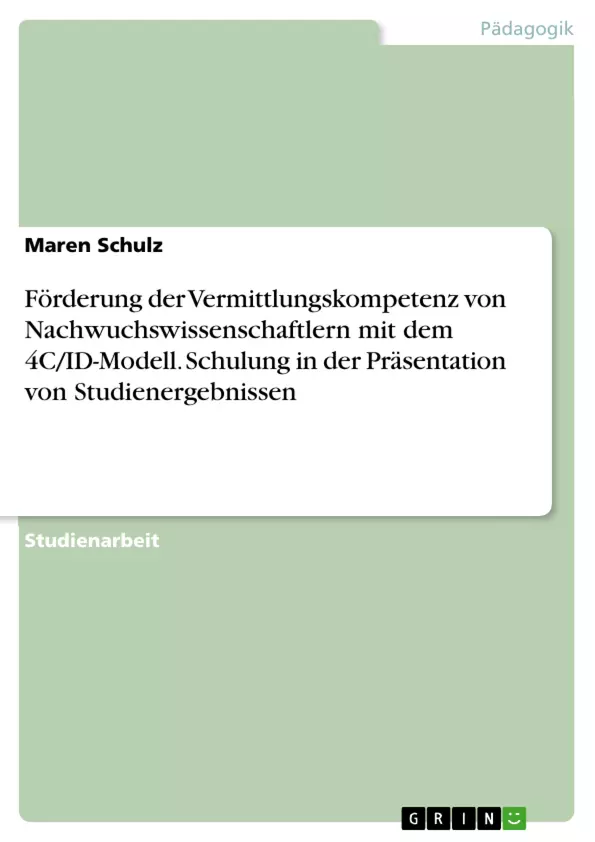Ziel der Arbeit ist, Lehrmaterialentwicklern, die über Grundkenntnisse des 4C/ID-Modells verfügen, anwendungsorientierte Unterstützung bei der Schulung von Master-Absolventen zu geben. Die Zielkompetenz der von den Trainern durchzuführenden Schulung ist: "Als Nachwuchswissenschaftler Studienergebnisse im Rahmen einer Konferenz vorstellen". Absolventen des Masterstudiengangs Biotechnologie arbeiten während des Studiums an Forschungsprojekten. Bei einer Nachwuchswissenschaftler-Konferenz sollen die Ergebnisse vor großem Auditorium präsentiert werden. Dazu bedarf es besonderer Fähigkeiten. Ein Experteninterview erbrachte, dass viele Nachwuchsforscher auf der Ebene des wissenschaftlichen Arbeitens sehr leistungsfähig seien, die Vermittlungs- und Selbstkompetenz oft defizitär. Das Phänomen tritt verstärkt auf bei praxisorientierten Studiengängen. Ziel ist, Nachwuchswissenschaftlern Fertigkeiten zu vermitteln, die sie brauchen, um einen Vortrag zu entwickeln, durchzuführen und zu evaluieren, der insgesamt ihrem wissenschaftlichen Niveau entspricht.
Das 4C/ID-Modell ist ein Handlungsleitfaden zur systematischen Entwicklung von Lernmaterial für das Erlernen komplexer Zielkompetenzen. Zentrale Charakteristika sind vier Komponenten, die in wechselseitiger Beziehung stehen. Zunächst sind dies die Lernaufgaben. Die Lebensnähe der Lernaufgaben dient der Motivation der Lernenden, verinnerlichtes Wissen zur Lösung komplexer Probleme heranzuziehen und zu transferieren. Lernaufgaben dienen dazu, beim Lernenden für non-rekurrente Teilfertigkeiten ein kognitives Schema aufzubauen. Für rekurrente Fertigkeiten sollte durch Regel-Aufbau ein Automatismus erreicht werden. Zweitens unterstützende Informationen: Diese sollen das Lernen nicht-rekurrenter Lernaufgaben fördern und eine Brücke zwischen Vorwissen und Lernaufgaben bilden. Just-In-Time-Informationen (JIT) drittens sind Informationen, die eine notwendige Voraussetzung für das Erlernen und Durchführen der rekurrenten Anteile der Lernaufgaben sind. Viertens: Part-Task-Practice, das heißt praktische Elemente, die dem Lernenden angeboten werden, um den Aufbau eines Regel-Netzwerkes für einzelne rekurrente Fähigkeiten zu fördern, die im Bedarfsfall automatisch abgerufen werden können (Automatisiertes Handeln). Das 4C/ID-Modell eignet sich für die zu schulende Zielgruppe, weil es analytisch ist und Problemlösungskompetenzen schult, die für die wissenschaftliche Karriere hilfreich sind.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Exkurs
- 2.1. Pfadabhängigkeit
- 2.2. Unterschied zwischen Didaktik und Instruktionsdesign
- 3. Hierarchische Kompetenzanalyse
- 4. Bildung von Aufgabenklassen
- 5. Entwicklung von Lernaufgaben
- 6. Prozedurale und unterstützende Informationen
- 7. Part-task Practice
- 8. Didaktische Szenarien
- 9. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, Lehrmaterialentwicklern an Hochschulen, die mit dem 4C/ID-Modell vertraut sind, anwendungsorientierte Unterstützung bei der Schulung von Master-Absolventen zu bieten. Konkret geht es um die Vermittlung von Fähigkeiten, die Nachwuchswissenschaftlern die Präsentation von Studienergebnissen auf Konferenzen ermöglichen. Die Arbeit adressiert Defizite in der Vermittlungs- und Selbstkompetenz, die oft bei praxisorientierten Studiengängen auftreten.
- Anwendung des 4C/ID-Modells in der Lehrmaterialentwicklung
- Kompetenzanalyse und -entwicklung für wissenschaftliche Präsentationen
- Gestaltung von Lernaufgaben zur Verbesserung der Präsentationsfähigkeiten
- Integration von prozeduralen und unterstützenden Informationen
- Einsatz von Part-Task-Practice im Training
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Zielsetzung der Arbeit, welche darin besteht, Lehrmaterialentwicklern an Hochschulen Unterstützung bei der Schulung von Master-Absolventen im Bereich der Präsentation wissenschaftlicher Ergebnisse auf Konferenzen zu geben. Es wird auf das Problem mangelnder Vermittlungs- und Selbstkompetenz bei Nachwuchswissenschaftlern, insbesondere in praxisorientierten Studiengängen, hingewiesen. Das 4C/ID-Modell wird als theoretischer Rahmen eingeführt.
2. Theoretischer Exkurs: Dieser Abschnitt legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es werden Konzepte wie Pfadabhängigkeit und der Unterschied zwischen Didaktik und Instruktionsdesign erläutert. Dies bildet die Basis für das Verständnis der im weiteren Verlauf beschriebenen Methoden und Ansätze zur Entwicklung von Lehrmaterialien.
3. Hierarchische Kompetenzanalyse: Dieses Kapitel befasst sich mit der systematischen Analyse der Kompetenzen, die für eine erfolgreiche wissenschaftliche Präsentation notwendig sind. Es wird eine hierarchische Struktur dieser Kompetenzen vorgestellt, die als Grundlage für die Entwicklung zielgerichteter Lernaufgaben dient. Die Analyse dient der Identifizierung von Lernzielen und deren Strukturierung.
4. Bildung von Aufgabenklassen: Hier wird die Methode zur Bildung von Aufgabenklassen erläutert, welche die Grundlage für die Gestaltung der Lernaufgaben bildet. Dieser Abschnitt fokussiert die Strukturierung und Sequenzierung der Lerninhalte, um einen effektiven Lernprozess zu gewährleisten. Die Aufgabenklassen bauen aufeinander auf und unterstützen den schrittweisen Kompetenzaufbau.
5. Entwicklung von Lernaufgaben: Dieser Abschnitt beschreibt detailliert den Prozess der Entwicklung von Lernaufgaben, die auf die identifizierten Kompetenzen und die gebildeten Aufgabenklassen abgestimmt sind. Der Fokus liegt auf der Gestaltung von praxisrelevanten und lebensnahen Lernaufgaben, die den Lernerfolg maximieren sollen. Die konkrete Umsetzung der Konzepte aus den vorherigen Kapiteln wird hier praktisch dargestellt.
6. Prozedurale und unterstützende Informationen: In diesem Kapitel werden verschiedene Arten von Informationen betrachtet, die den Lernprozess unterstützen. Es geht um die Bereitstellung von prozeduralen Informationen (Anleitungen, Schritt-für-Schritt-Anweisungen) und unterstützenden Informationen, die den Lernenden helfen, die Lernaufgaben zu bewältigen und ihr Vorwissen zu aktivieren. Der Fokus liegt auf der optimalen Bereitstellung von Informationen zum richtigen Zeitpunkt.
7. Part-task Practice: Hier wird die Methode der Part-task Practice erläutert, bei der einzelne Teilfertigkeiten separat geübt werden, bevor sie im Ganzen zusammengeführt werden. Die Vorteile dieser Methode für den Kompetenzaufbau werden diskutiert und deren Anwendung im Kontext der wissenschaftlichen Präsentationen erläutert. Der Fokus liegt auf der effektiven Übung und Automatisierung einzelner Fertigkeiten.
8. Didaktische Szenarien: Dieser Abschnitt stellt verschiedene didaktische Szenarien vor, die die Anwendung des entwickelten Lehrmaterials in der Praxis zeigen. Es werden konkrete Beispiele und Anwendungssituationen dargestellt, um die praktische Umsetzung der entwickelten Konzepte zu verdeutlichen. Der Fokus liegt auf der Anwendung und der Anpassung an verschiedene Lernsituationen.
Schlüsselwörter
4C/ID-Modell, Kompetenzanalyse, Lernaufgaben, Präsentationsfähigkeiten, Nachwuchswissenschaftler, Wissenschaftskommunikation, Hochschuldidaktik, Instruktionsdesign, Part-task Practice.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Anwendungsorientierte Unterstützung bei der Schulung von Master-Absolventen
Was ist der Hauptfokus dieses Dokuments?
Das Dokument bietet Lehrmaterialentwicklern an Hochschulen anwendungsorientierte Unterstützung bei der Schulung von Master-Absolventen im Bereich der Präsentation wissenschaftlicher Ergebnisse auf Konferenzen. Es konzentriert sich auf die Verbesserung der Vermittlungs- und Selbstkompetenz von Nachwuchswissenschaftlern, insbesondere in praxisorientierten Studiengängen.
Welches Modell wird als theoretischer Rahmen verwendet?
Das 4C/ID-Modell dient als theoretischer Rahmen für die Entwicklung und Gestaltung der Lehrmaterialien.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt Themen wie Kompetenzanalyse und -entwicklung für wissenschaftliche Präsentationen, die Gestaltung von Lernaufgaben zur Verbesserung der Präsentationsfähigkeiten, die Integration prozeduraler und unterstützender Informationen, den Einsatz von Part-Task-Practice im Training und die Anwendung des 4C/ID-Modells in der Lehrmaterialentwicklung.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument ist in Kapitel unterteilt, beginnend mit einer Einleitung, gefolgt von einem theoretischen Exkurs, der die Grundlagen der verwendeten Methoden erläutert. Es folgen Kapitel zur hierarchischen Kompetenzanalyse, zur Bildung von Aufgabenklassen, zur Entwicklung von Lernaufgaben, zur Rolle prozeduraler und unterstützender Informationen, zur Part-task Practice und zur Darstellung didaktischer Szenarien. Das Dokument schließt mit einem Fazit.
Welche Kompetenzen werden analysiert?
Es wird eine hierarchische Kompetenzanalyse durchgeführt, um die für eine erfolgreiche wissenschaftliche Präsentation notwendigen Kompetenzen systematisch zu identifizieren und zu strukturieren. Diese Analyse dient als Grundlage für die Entwicklung zielgerichteter Lernaufgaben.
Wie werden die Lernaufgaben gestaltet?
Die Lernaufgaben werden praxisrelevant und lebensnah gestaltet und auf die identifizierten Kompetenzen und die gebildeten Aufgabenklassen abgestimmt. Sie sollen den Lernerfolg maximieren und den schrittweisen Kompetenzaufbau unterstützen.
Welche Rolle spielen prozedurale und unterstützende Informationen?
Prozedurale Informationen (Anleitungen, Schritt-für-Schritt-Anweisungen) und unterstützende Informationen helfen den Lernenden, die Lernaufgaben zu bewältigen und ihr Vorwissen zu aktivieren. Die optimale Bereitstellung dieser Informationen zum richtigen Zeitpunkt ist entscheidend.
Was ist Part-task Practice und wie wird sie angewendet?
Part-task Practice ist eine Methode, bei der einzelne Teilfertigkeiten separat geübt werden, bevor sie im Ganzen zusammengeführt werden. Diese Methode wird angewendet, um den Kompetenzaufbau zu optimieren und einzelne Fertigkeiten effektiv zu üben und zu automatisieren.
Welche didaktischen Szenarien werden vorgestellt?
Das Dokument stellt verschiedene didaktische Szenarien vor, um die praktische Umsetzung der entwickelten Konzepte und die Anwendung des Lehrmaterials in verschiedenen Lernsituationen zu verdeutlichen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Dokuments?
Schlüsselwörter sind: 4C/ID-Modell, Kompetenzanalyse, Lernaufgaben, Präsentationsfähigkeiten, Nachwuchswissenschaftler, Wissenschaftskommunikation, Hochschuldidaktik, Instruktionsdesign, Part-task Practice.
- Quote paper
- Maren Schulz (Author), 2015, Förderung der Vermittlungskompetenz von Nachwuchswissenschaftlern mit dem 4C/ID-Modell. Schulung in der Präsentation von Studienergebnissen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/508774