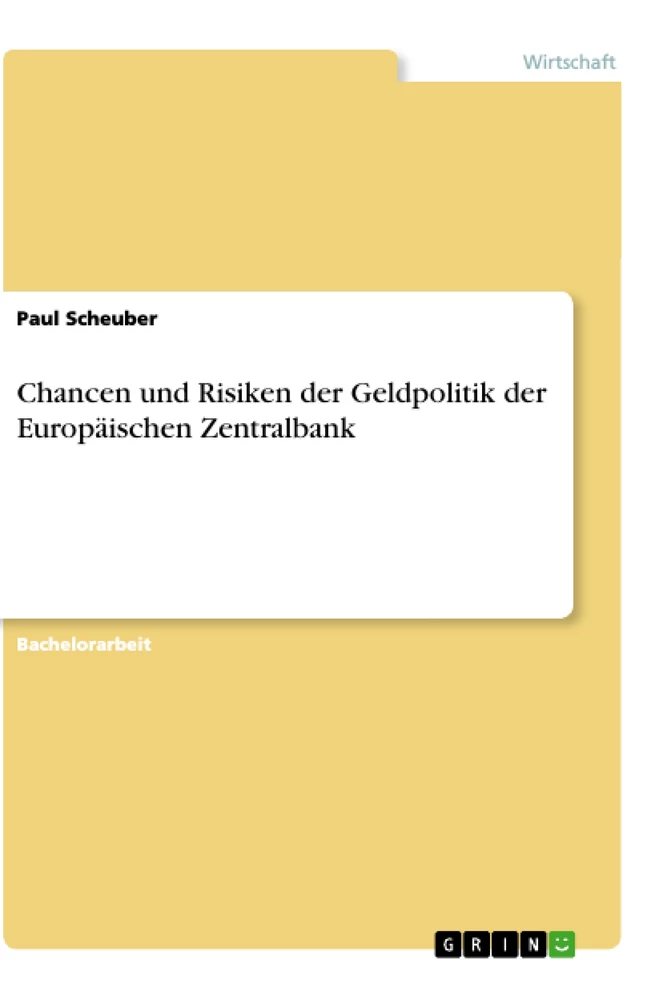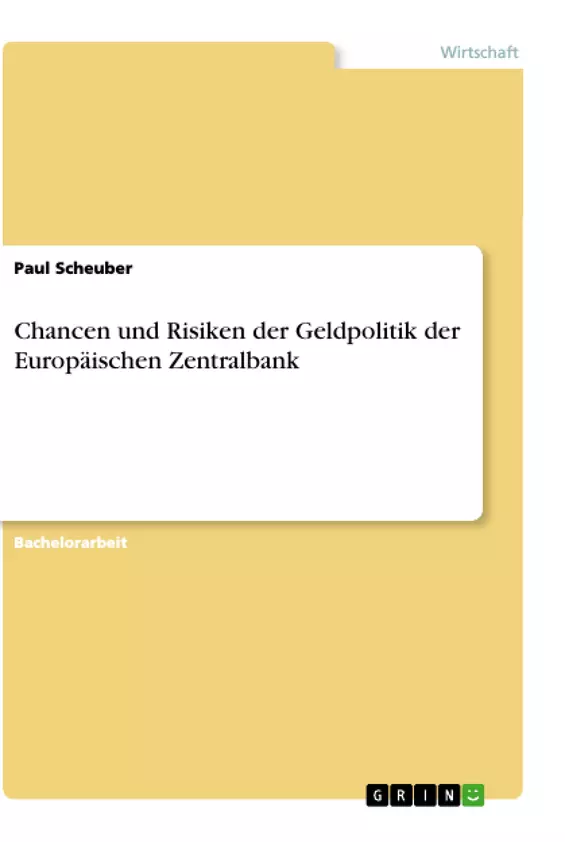Die Untersuchungen im Rahmen dieser Arbeit sollen positive und negative Konsequenzen wichtiger geldpolitischer Entscheidungen der Vergangenheit und Gegenwart abwägen und sich daraus ergebende, mögliche Strategien für die Zukunft aufzeigen. Dabei werden auch sehr grundlegende Aspekte mit Bezug zur Geldpolitik der EZB, wie ihre Zielsetzung, ihre geldpolitische Strategie und der Euroraum als Währungsraum, hinterfragt. Im März 2016 senkte die Europäische Zentralbank den Leitzins erstmals in ihrer Geschichte auf 0 Prozent herab. Diese Entscheidung ging konform mit dem bereits seit mehreren Jahren eingeschlagenen Kurs der Zinssenkungen und der immer billigeren Vergabe von Krediten an Geschäftsbanken. Mit einem Einlagesatz von -0,4 Prozent ist man bereits im Bereich der Negativzinsen angekommen und greift damit zunehmend auf geldpolitische Mittel zurück, zu denen man in der Geschichte noch kaum Erfahrungen sammeln konnte.
Als Reaktion auf die Finanzkrise 2008 und die drohende Staatspleite Griechenlands kaufte die EZB erstmals Staatsanleihen von Mitgliedsstaaten und begab sich damit in eine rechtliche Grauzone. Diese ungewöhnliche Geldpolitik provozierte viel Kritik aus der Öffentlichkeit, trug aber möglicherweise auch dazu bei, dass sich noch kein EU-Mitgliedsstaat vom Euro getrennt hat. Befürworter der Geldpolitik der EZB sprechen ihr daher eine wichtige Rolle in der Erhaltung der Integrität eines gemeinsamen Währungsraums zu. Die von der EZB verfolgten Strategien haben weitreichende wirtschaftliche und soziale Folgen für die Menschen Europas. Die Tragweite der Entscheidungen und der Mangel an Erfahrungen mit den, von der EZB in den letzten Jahren verwendeten, geldpolitischen Mitteln, machen fundierte Untersuchungen zu möglichen Chancen und Risiken deshalb umso wichtiger.
Zunächst dient die Arbeit mit Hintergrundinforationen zum Aufbau und der Funktionsweise der EZB. Ein Ziel des darauffolgenden Abschnitts ist es, Ansätze zur Geldwertbestimmung und anhand dieser die Ursachen von Geldwertveränderungen im Allgemeinen zu zeigen. Mit einer Analyse der Folgen von Geldwertveränderungen wird anschließend das Inflationsziel der EZB bewertet. Danach sollen die Niedrigzinspolitik der EZB bewertet und Motive aufgezeigt werden, die den geldpolitischen Kurs im Zusammenhang der Niedrigzinspolitik geprägt haben könnten. Abschließend werden Chancen und Risiken der Staatsanleihen-Käufe durch die EZB aufgewogen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die EZB
- Rechtliche Rahmenbedingungen
- Organe
- Das Europäische System der Zentralbanken
- Das Eurosystem
- Das EZB-Direktorium
- Der EZB-Rat
- Abstimmungsverfahren
- Unabhängigkeit
- Politische Unabhängigkeit
- Personelle Unabhängigkeit
- Funktionelle Unabhängigkeit
- Finanzielle Unabhängigkeit
- Organe
- Ziele
- Das geldpolitische Instrumentarium
- Offenmarktgeschäfte
- Ständige Fazilitäten
- Die Mindestreserve
- Rechtliche Rahmenbedingungen
- Der Wert des Geldes
- Grundlagen
- Definitionen
- Geld und Güter
- Geldpolitik und Fiskalpolitik
- Die Funktionen von Geld
- Geld als Recheneinheit
- Tausch- und Zahlungsmittelfunktion
- Wertaufbewahrungsfunktion
- Definitionen
- Ansätze zur Bestimmung des Geldwerts
- 2-Säulen-Strategie
- Quantitätstheorie
- Angebot und Nachfrage
- Folgen von Veränderungen des Geldwertes
- Folgen von Inflation
- Chancen von Inflation
- Risiken von Inflation
- Distributionseffekt
- Ressourcenfehlallokation
- Folgen von Deflation
- Risiken von Deflation
- Zurückhaltung von Ausgaben
- Distributionseffekt
- Chancen von Deflation
- Risiken von Deflation
- Folgen von Inflation
- Grundlagen
- Niedrigzinspolitik
- Motive
- Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009
- Taylor-Zins und US-Geldpolitik
- Indirekte monetäre Staatsfinanzierung
- Risiken
- Enteignung der Sparer
- Bildung von Vermögenspreisblasen
- Chancen
- Deflationsbekämpfung
- Kreditvergaben an Unternehmen
- Kreditvergabe an Staaten und Privathaushalte
- Empirische Belege
- Stärkung der Konjunktur
- Setzung von Anreizen
- Vermeidung von Einkommenskonzentration
- Finanzierung von Staaten
- Deflationsbekämpfung
- Motive
- Kauf von Staatsanleihen
- Motive
- Störungen im Transmissionsmechanismus
- Europa als Währungsraum
- Chancen
- Risiken
- Inflation
- Aufblähung einer Staatsanleihen-Blase
- Moral Hazard
- Motive
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) und analysiert die Chancen und Risiken ihrer geldpolitischen Maßnahmen. Die Arbeit beleuchtet insbesondere die Niedrigzinspolitik und den Ankauf von Staatsanleihen durch die EZB.
- Rechtliche Rahmenbedingungen und Ziele der EZB
- Der Wert des Geldes und die Folgen von Inflation und Deflation
- Niedrigzinspolitik: Motive, Chancen und Risiken
- Kauf von Staatsanleihen: Motive, Chancen und Risiken
- Der Einfluss der EZB-Geldpolitik auf die europäische Wirtschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung Dieses Kapitel führt in die Thematik der Arbeit ein und erläutert die Relevanz der Geldpolitik der EZB für die europäische Wirtschaft. Es werden die zentralen Fragestellungen der Arbeit definiert und der Aufbau der Arbeit skizziert.
- Kapitel 2: Die EZB In diesem Kapitel werden die rechtlichen Rahmenbedingungen der EZB sowie ihre Ziele und geldpolitischen Instrumente vorgestellt. Es werden die Organe der EZB, das Abstimmungsverfahren und die Unabhängigkeit der EZB detailliert beschrieben.
- Kapitel 3: Der Wert des Geldes Dieses Kapitel befasst sich mit den Grundlagen des Geldwerts und den Folgen von Veränderungen des Geldwerts. Es werden Definitionen des Geldes und seine Funktionen erläutert. Zudem werden verschiedene Ansätze zur Bestimmung des Geldwerts vorgestellt, wie die 2-Säulen-Strategie, die Quantitätstheorie und die Angebot- und Nachfrage-Theorie. Die Folgen von Inflation und Deflation werden analysiert, wobei sowohl Chancen als auch Risiken betrachtet werden.
- Kapitel 4: Niedrigzinspolitik Dieses Kapitel befasst sich mit der Niedrigzinspolitik der EZB, ihren Motiven, Chancen und Risiken. Es werden die Hintergründe der Niedrigzinspolitik, wie die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009, der Taylor-Zins und die indirekte monetäre Staatsfinanzierung, erläutert. Die Risiken der Niedrigzinspolitik, wie die Enteignung der Sparer und die Bildung von Vermögenspreisblasen, werden analysiert. Zudem werden die Chancen der Niedrigzinspolitik, wie die Deflationsbekämpfung und die Stärkung der Konjunktur, diskutiert.
- Kapitel 5: Kauf von Staatsanleihen In diesem Kapitel werden die Motive, Chancen und Risiken des Kaufs von Staatsanleihen durch die EZB untersucht. Es werden die Störungen im Transmissionsmechanismus und die Besonderheiten Europas als Währungsraum beleuchtet. Die Chancen des Ankaufs von Staatsanleihen werden erörtert, ebenso wie die Risiken, wie die Inflation, die Aufblähung einer Staatsanleihen-Blase und der Moral Hazard.
Schlüsselwörter
EZB, Geldpolitik, Niedrigzinspolitik, Staatsanleihen, Inflation, Deflation, Chancen, Risiken, Euro, Währungsunion, Finanzkrise, Transmissionsmechanismus, Moral Hazard, Vermögenspreisblase
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptziele der Europäischen Zentralbank (EZB)?
Das vorrangige Ziel der EZB ist die Gewährleistung der Preisstabilität im Euroraum, um den Wert der Währung zu sichern.
Welche Risiken birgt die Niedrigzinspolitik?
Zu den Risiken gehören die potenzielle "Enteignung" der Sparer, die Bildung von Vermögenspreisblasen und langfristige Instabilitäten im Finanzsektor.
Warum kauft die EZB Staatsanleihen?
Dies dient dazu, Störungen im Transmissionsmechanismus der Geldpolitik zu beheben und die Integrität des Währungsraums in Krisenzeiten zu schützen.
Was ist der Unterschied zwischen Inflation und Deflation?
Inflation bezeichnet den Anstieg des allgemeinen Preisniveaus (Geldentwertung), während Deflation einen anhaltenden Rückgang der Preise beschreibt, was oft zu Konsumzurückhaltung führt.
Wie unabhängig ist die EZB?
Die EZB ist politisch, personell, funktionell und finanziell unabhängig, um ihre geldpolitischen Entscheidungen ohne Einflussnahme durch Regierungen treffen zu können.
- Citation du texte
- Paul Scheuber (Auteur), 2017, Chancen und Risiken der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/510684