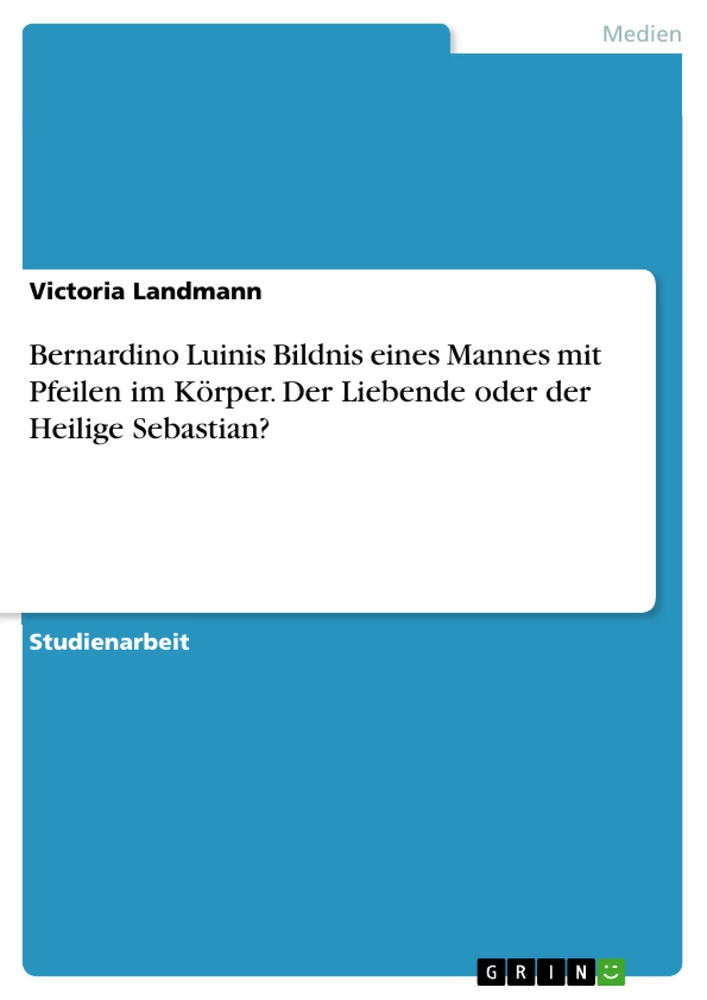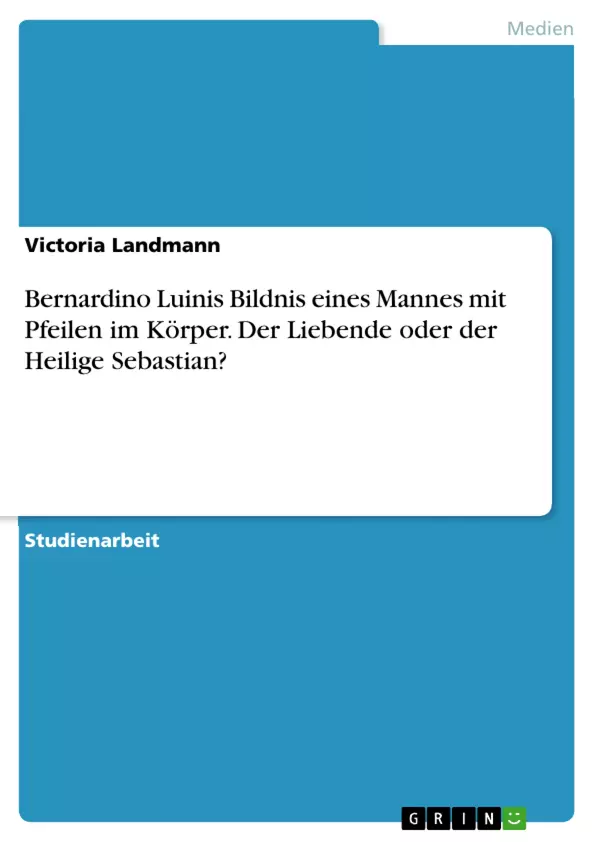Diese Arbeit untersucht das Bildnis eines Mannes mit Pfeilen im Körper von Bernardino Luini unter der Fragestellung, ob es einem eher sakralen oder profanen Zweck dient. Das Spiel zwischen profaner und sakraler Kunst ist in der Zeit des 15. und 16. Jahrhunderts ein in der italienischen Renaissance verbreitetes Phänomen. Die Künstler des Cinquecento verleihen ihrer Kreativität Ausdruck, indem sie sakrale Bildsujets mit scheinbar profanen, erotisierenden Bildelementen vermischen. Diesem Kuriosum folgt auch ein Schüler Leonardo Da Vincis namens Bernardino Luini, der jenem Spiel mit seinem Gemälde eines Mannes mit Pfeilen im Körper zu Beginn des 16. Jahrhunderts Ausdruck verleiht. In der folgenden Arbeit soll demnach untersucht werden, inwiefern jenes Gemälde einem sakralen oder aber eher profanen Zweck dient. Hierzu ist es notwendig, das Werk, welches zuerst Leonardo Da Vinci zugeschrieben wurde, genauer zu durchleuchten und das Wechselspiel zwischen christlicher Thematik und erotischer Erscheinungsform unter Einbeziehung des zu jener Zeit gängigen Liebesdiskurses darzulegen.
In der Forschung wird Luinis Gemälde eines Mannes mit Pfeilen im Körper als Heiliger Sebastian tituliert. Diese Feststellung gilt es jedoch im Folgenden genauer zu durchleuchten: Der Sage nach war Sebastian ein Offizier in der Leibgarde des Kaisers Diokletian in Mailand. Durch sein Bekenntnis zum Christentum am kaiserlichen Hof ließ ihn der Kaiser an einen Pfahl binden und mit Pfeilen beschießen, bis er tot zu sein schien. Von der Witwe Irene gesund gepflegt, ging Sebastian wiederum zum Kaiser und bekannte sich erneut zum Christentum, woraufhin ihn dieser mit Knüppeln erschlagen ließ.
Inhaltsverzeichnis
- Luinis Heiliger Sebastian – ein sakrales oder profanes Werk?
- Das Spiel zwischen Profaner und Sakraler Kunst
- Beschreibung des Bildes
- Der Mann in Luinis Gemälde – der Heilige Sebastian?
- Das Martyrium der Liebe
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Bernardino Luinis Gemälde eines Mannes mit Pfeilen im Körper. Ziel ist es, die Funktion des Bildes zu klären: Dient es einem sakralen oder einem profanen Zweck? Die Analyse beleuchtet das Wechselspiel zwischen christlicher Thematik und erotischer Darstellung im Kontext des damaligen Liebesdiskurses.
- Das Spannungsfeld zwischen sakraler und profaner Kunst in der italienischen Renaissance
- Die ikonographische Analyse von Luinis Gemälde
- Die Deutung des Bildes im Kontext des zeitgenössischen Liebesdiskurses
- Vergleich mit anderen Darstellungen des Heiligen Sebastian
- Die Frage nach der Identität der dargestellten Person
Zusammenfassung der Kapitel
Luinis Heiliger Sebastian – ein sakrales oder profanes Werk?: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach der sakralen oder profanen Funktion von Luinis Gemälde eines Mannes mit Pfeilen in den Körper. Sie führt in die Thematik des Spiels zwischen sakralen und profanen Elementen in der Kunst des 15. und 16. Jahrhunderts ein und kündigt die detaillierte Analyse des Bildes an, die den Fokus auf das Wechselspiel zwischen christlicher Symbolik und erotischer Darstellung legt, unter Berücksichtigung des zeitgenössischen Liebesdiskurses.
Das Spiel zwischen Profaner und Sakraler Kunst: Dieses Kapitel beginnt mit einer detaillierten Beschreibung des Bildes: Ein bärtiger Mann, an einen Baumstumpf gebunden und mit Pfeilen getroffen, wird dargestellt. Der Fokus liegt auf der idealisierten Schönheit der Figur, der Positionierung der Pfeile, der Inschrift auf einer Tafel ("Gedenke, wie gerne ich um deiner Liebe willen die süßen Pfeile ertrage") und dem aufwändig drapierten Lendenschutz. Die Beschreibung legt bereits die Ambivalenz des Bildes zwischen sakraler und profaner Bedeutung nahe.
Der Mann in Luinis Gemälde – der Heilige Sebastian?: Dieses Kapitel untersucht die These, dass es sich bei der dargestellten Figur um den Heiligen Sebastian handelt. Ein Vergleich mit anderen Darstellungen des Heiligen Sebastian (z.B. Mantegna) zeigt signifikante Unterschiede in der Anzahl der Pfeile, der Abwesenheit von Märtyrersymbolen und der idealisierten Schönheit der Figur. Diese Unterschiede stellen die Identifizierung der Figur als Heiliger Sebastian in Frage.
Das Martyrium der Liebe: Dieses Kapitel erörtert die Möglichkeit einer profanen Interpretation des Gemäldes. Es wird die Entwicklung der Darstellung des Heiligen Sebastian im Laufe der Zeit betrachtet, von der Darstellung eines alten Mannes im Mittelalter zu einem schönen Jüngling der Renaissance, der zunehmend mit erotischen Konnotationen verbunden wurde. Die Inschrift auf der Tafel und die fast nackte Darstellung des Mannes werden als Hinweise auf eine Interpretation des Gemäldes als Darstellung eines Liebesmartyriums interpretiert. Die Kapitel verbindet die Frage nach der möglichen Verbindung des Heiligen Sebastian mit der Homosexualität, was im Kontext des Cinquecento diskutiert wird.
Schlüsselwörter
Bernardino Luini, Heiliger Sebastian, Renaissance, sakrale Kunst, profane Kunst, Liebesdiskurs, ikonographie, Bildanalyse, Cinquecento, Erotik, Martyrium.
Häufig gestellte Fragen zu "Luinis Heiliger Sebastian – ein sakrales oder profanes Werk?"
Was ist der Gegenstand der Untersuchung in diesem Text?
Der Text untersucht Bernardino Luinis Gemälde eines Mannes mit Pfeilen im Körper. Die zentrale Forschungsfrage lautet: Handelt es sich um ein sakrales oder ein profanes Werk?
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt das Spannungsfeld zwischen sakraler und profaner Kunst in der italienischen Renaissance, die ikonographische Analyse von Luinis Gemälde, die Deutung des Bildes im Kontext des zeitgenössischen Liebesdiskurses, einen Vergleich mit anderen Darstellungen des Heiligen Sebastian und die Frage nach der Identität der dargestellten Person. Es wird insbesondere das Wechselspiel zwischen christlicher Thematik und erotischer Darstellung beleuchtet.
Welche Kapitel umfasst der Text und worum geht es in ihnen?
Der Text gliedert sich in die Kapitel "Luinis Heiliger Sebastian – ein sakrales oder profanes Werk?", "Das Spiel zwischen Profaner und Sakraler Kunst", "Der Mann in Luinis Gemälde – der Heilige Sebastian?" und "Das Martyrium der Liebe". Das erste Kapitel stellt die Forschungsfrage und den Kontext vor. Das zweite beschreibt detailliert das Gemälde. Das dritte Kapitel untersucht, ob die dargestellte Person der Heilige Sebastian ist, und das vierte Kapitel erörtert eine profane Interpretation des Gemäldes als Darstellung eines Liebesmartyriums, auch im Kontext der möglichen Verbindung des Heiligen Sebastian mit der Homosexualität im Cinquecento.
Welche Schlussfolgerung zieht der Text?
Die Schlussfolgerung wird im Kapitel "Fazit" gezogen (obwohl der exakte Inhalt des Fazits in der Preview nicht explizit dargestellt ist). Der Text deutet jedoch an, dass die Interpretation des Bildes ambivalent ist und sowohl sakrale als auch profane Aspekte beinhaltet. Die Identität der dargestellten Person als Heiliger Sebastian wird hinterfragt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind: Bernardino Luini, Heiliger Sebastian, Renaissance, sakrale Kunst, profane Kunst, Liebesdiskurs, Ikonographie, Bildanalyse, Cinquecento, Erotik, Martyrium.
Welche Zielsetzung verfolgt der Text?
Ziel des Textes ist die Klärung der Funktion von Luinis Gemälde: Dient es einem sakralen oder einem profanen Zweck? Die Analyse soll das Wechselspiel zwischen christlicher Thematik und erotischer Darstellung im Kontext des damaligen Liebesdiskurses beleuchten.
- Citar trabajo
- Victoria Landmann (Autor), 2014, Bernardino Luinis Bildnis eines Mannes mit Pfeilen im Körper. Der Liebende oder der Heilige Sebastian?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/511814