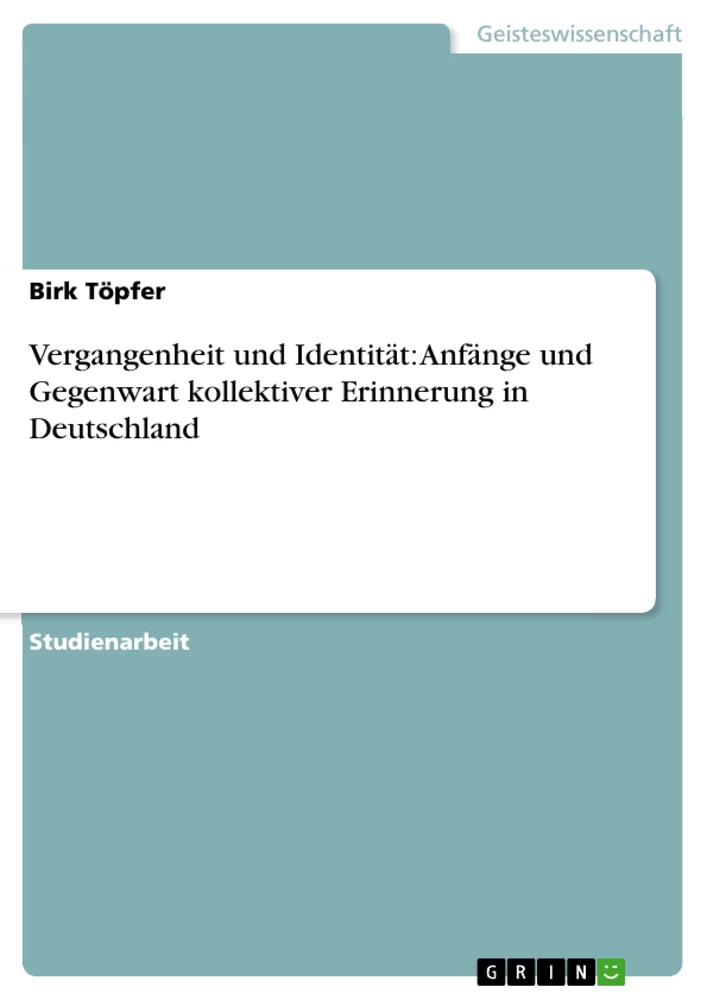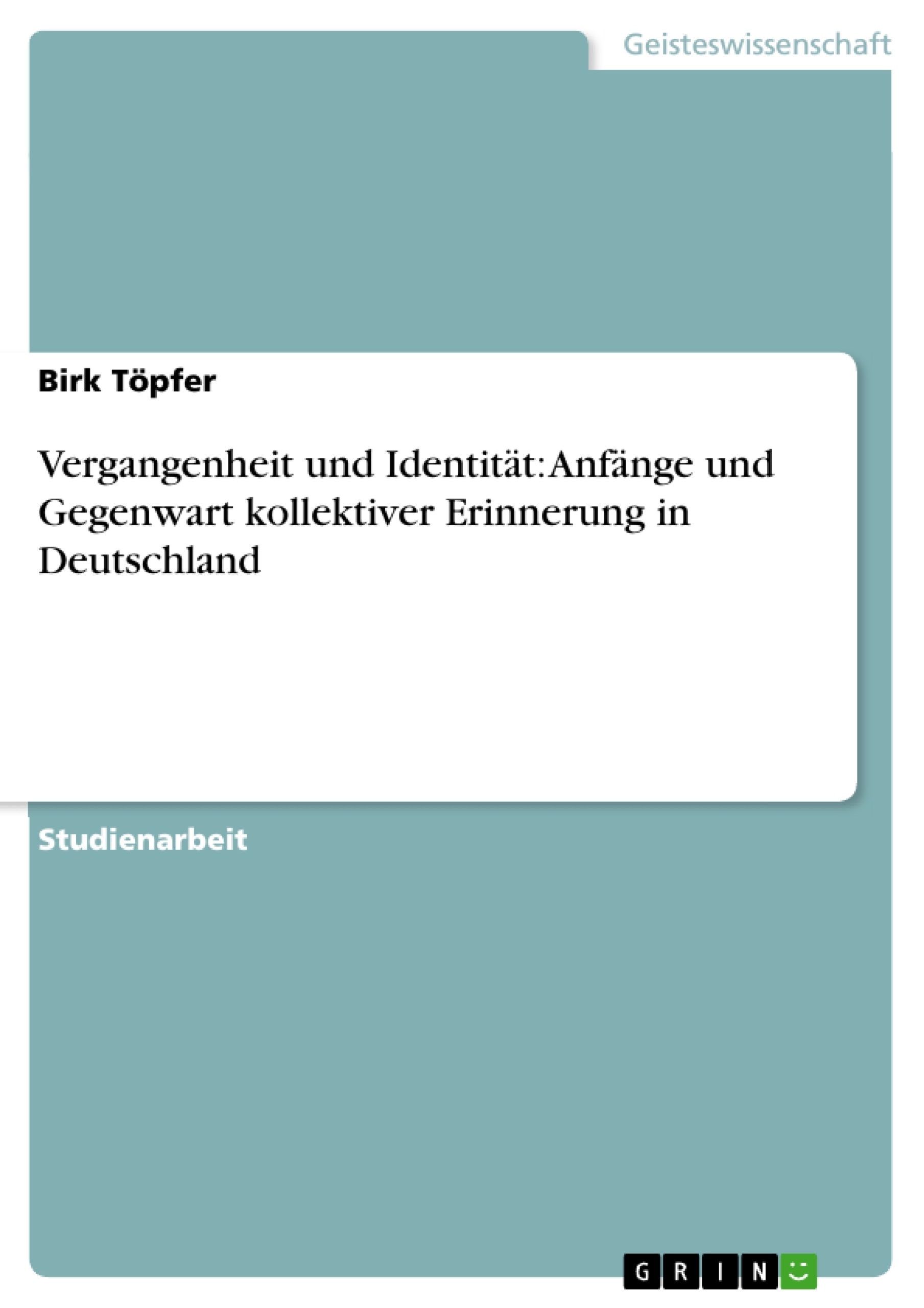In der vorliegenden Arbeit soll nachgezeichnet werden wie es um eine deutsche kollektive oder nationale Identität bestellt ist. Die zentrale Bedeutung des Geschichtsbildes für eine solche Identität anerkennend, wird die Vergangenheitspolitik Deutschlands den Rahmen bilden, an dem dargestellt werden kann, wie sich Geschichtsbilder verändern, wie sie im Laufe der Zeit festgeschrieben werden und sich identitätsbildend auswirken. Das beherrschende Thema deutscher Vergangenheits- und Erinnerungspolitik ist natürlich das Nationalsozialistische Regime unter dessen Regie sich die schlimmsten Verbrechen des vergangenen Jahrhunderts ereignet haben. Die sich in diesem Zusammenhang aufdrängenden Fragen sind: wie eine solche Vergangenheit überhaupt Gegenstand von Identitätsstiftung sein kann und wenn ja, wie Geschichte in Deutschland gelesen wurde, um eine gemeinsame Identität nicht zu gefährden.In einem ersten Teil sollen die anfänglichen Anstrengungen der fünfziger und sechziger Jahre dargestellt und in einem weiteren Abschnitt die aktuelle Lage umrissen werden. Ein theoretischer Exkurs wird sich mit der Bedeutung von Gedächtnis als Grundlage von Erinnerung auseinandersetzen und damit inwieweit diese einen gemeinsamen kulturellen Wahrnehmungsrahmen produziert und/oder von ihm abhängt. Im letzten vergleichenden Teil wird eine Konklusion versucht, wie spezifisch deutsche Erinnerungspolitik eine deutsche Identität herausgebildet hat und an welchen Punkten eine solche immer noch als problematisch empfunden wird. Die dabei leitende These soll sein, dass auf Grund der schweren historischen Hypothek, die auf den Deutschen lastet, ein Identität weniger an der Geschichte und dem Bild davon festgemacht wird, sondern sich vielmehr an dem spezifischen Umgang damit konstituiert Bei allen Betrachtungen um kollektive, historische oder nationale Identität darf nicht übersehen werden, dass der Identitätsbegriff keineswegs ein homogener ist. Im Rahmen der personalen Identität ist er noch am klarsten umrissen, bei der Gruppen- oder kulturellen Identität fehlt nahezu deutliche Klärung dessen was er umschreiben soll. Die folgende Arbeit orientiert sich im wesentlichen an dem Begriff des kollektiven Gedächtnisses oder historischen Identität, wie er sich in der jüngeren historischen Wissenschaft herausgebildet hat.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Die Anfänge der Vergangenheitspolitik
- II.1. Antinazistische Normsetzung
- II.2. Schuld und Sühne
- II.3. Gedächtnis und Erinnerung in den 50er Jahren
- III. Vergangenheitspolitik heute
- IV. Kollektives Gedächtnis – Exkurs
- IV.1. Gedächtnis
- IV.2. Erinnerung
- V. Kollektive Erinnerung in Deutschland
- VI. Vergangenheit und Identität
- VII. Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die deutsche Vergangenheitspolitik und ihre Auswirkungen auf die nationale Identität. Durch die Analyse der Entwicklungen in der Vergangenheitspolitik, beginnend mit den Anfängen in den 50er und 60er Jahren bis hin zur Gegenwart, wird untersucht, wie sich Geschichtsbilder verändern, im Laufe der Zeit festigen und identitätsbildend wirken. Dabei wird der Schwerpunkt auf die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und die Frage gelegt, wie eine solche Vergangenheit zur Identitätsstiftung beitragen kann. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung des Gedächtnisses als Grundlage der Erinnerung und untersucht, inwieweit diese einen gemeinsamen kulturellen Wahrnehmungsrahmen produziert oder von ihm abhängt.
- Vergangenheitspolitik und nationale Identität
- Entwicklungen der Vergangenheitspolitik in Deutschland
- Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus
- Bedeutung des Gedächtnisses und der Erinnerung für die Identität
- Spezifische Herausforderungen und Kontroversen in der deutschen Erinnerungspolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung der Erzählung von Geschichte für die Bildung von kollektiven Identitäten. Sie stellt die zentrale Frage nach der deutschen kollektiven oder nationalen Identität und wie sich diese durch die Vergangenheitspolitik entwickelt hat. Im zweiten Kapitel werden die Anfänge der Vergangenheitspolitik in den 50er und 60er Jahren betrachtet. Dabei wird die Rolle der antinazistischen Normsetzung im Kontext der Integration ehemaliger Nationalsozialisten beleuchtet.
Schlüsselwörter
Vergangenheitspolitik, nationale Identität, Kollektives Gedächtnis, Erinnerung, Geschichtsbild, Nationalsozialismus, Integration, Antinazistische Normsetzung, Deutschland
Häufig gestellte Fragen
Wie wird die deutsche nationale Identität in dieser Arbeit definiert?
Die Identität wird stark durch das Geschichtsbild und die deutsche Vergangenheitspolitik, insbesondere den Umgang mit dem Nationalsozialismus, geprägt.
Welche Rolle spielt der Nationalsozialismus für die kollektive Erinnerung?
Er ist das beherrschende Thema der Erinnerungspolitik und stellt die Frage, wie eine verbrecherische Vergangenheit dennoch identitätsstiftend wirken kann.
Was ist die zentrale These zur deutschen Identitätsbildung?
Aufgrund der historischen Last wird Identität weniger am Bild der Geschichte selbst, sondern vielmehr am spezifischen (kritischen) Umgang damit festgemacht.
Was geschah in der Vergangenheitspolitik der 50er Jahre?
Diese Zeit war geprägt von antinazistischer Normsetzung, aber auch von der Integration ehemaliger Nationalsozialisten und Fragen von Schuld und Sühne.
Was ist der Unterschied zwischen Gedächtnis und Erinnerung?
Ein theoretischer Exkurs der Arbeit klärt Gedächtnis als Grundlage der Erinnerung und wie daraus ein gemeinsamer kultureller Wahrnehmungsrahmen entsteht.
Welche Begriffe aus der historischen Wissenschaft werden genutzt?
Die Arbeit orientiert sich an Konzepten wie dem kollektiven Gedächtnis und der historischen Identität.
- Arbeit zitieren
- M.A. Birk Töpfer (Autor:in), 2001, Vergangenheit und Identität: Anfänge und Gegenwart kollektiver Erinnerung in Deutschland, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/51380