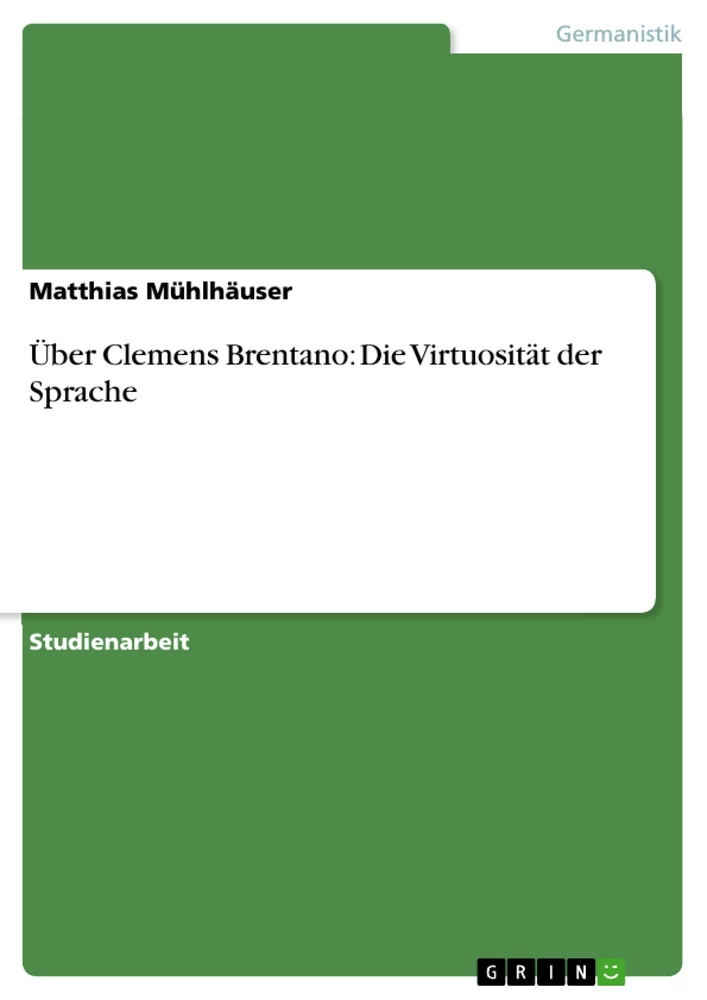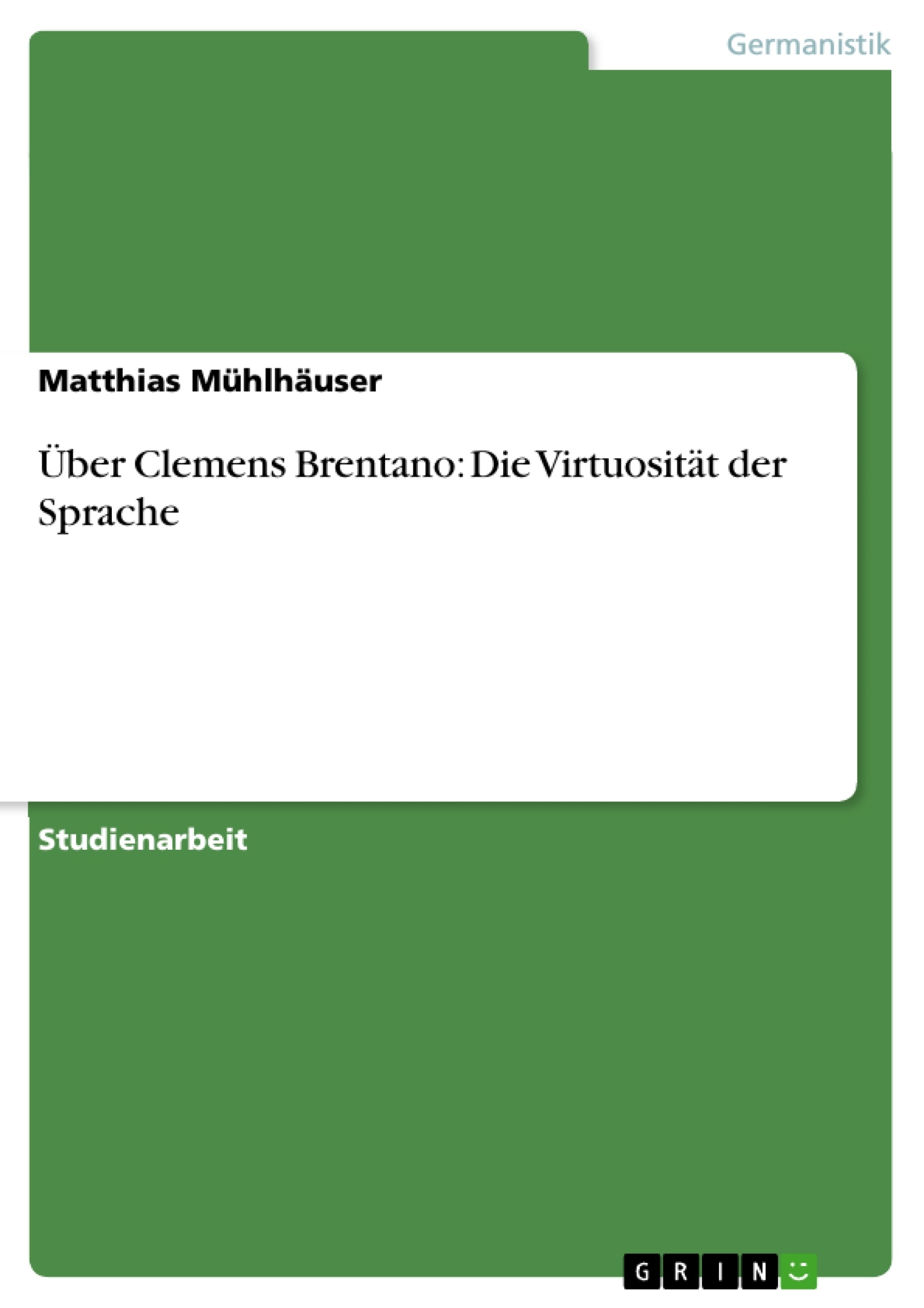Clemens Brentano kam am 9. September 1778 in Ehrenbreitstein nahe Koblenz zur Welt. Obgleich aus einer reichen Frankfurter Kaufmannsfamilie stammend, mag bereits dem Vater Peter Anton die Poesie im Blut gelegen haben: Clemens erinnerte sich im Alter daran, diesen immer so feierlichen Papa auch einmal beobachtet zu haben, wie er [...] mit dem halblauten Skandieren italienischer Verse beschäftigt erregt im Zimmer umherlief.1
Clemens Großmutter, Sophie von La Roche, war bereits sehr erfolgreich dichterisch tätig gewesen; u.a. war 1771 ihr Roman „Die Geschichte des Fräuleins von Sternheim“ publiziert worden. Wie dem jungen Dichter Wieland Sophiens Jugendliebe gegolten hatte, so war 1772 der junge Goethe deren sechzehnjähriger Tochter Maximiliane, Clemens Mutter, leidenschaftlich zugeneigt. In Goethes 1774 niedergeschriebenen Roman „Die Leiden des jungen Werthers“ weist denn Lotte auch Züge von Maximiliane auf. So war dichterische Anlage bereits in das Blut von Clemens und seinen Geschwistern gelegt. Es mag einen entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung des kleinen Clemens gehabt haben, dass seine Erziehung bereits 1784 in die Hände der strengen Tante Möhn in Koblenz gelegt wurde. Die Trennung von den Eltern und deren früher Tod im Abstand von nur vier Jahren sowie das Unverständnis, mit welchem der Regung seiner Phantasie und der frühen Neigung zum Lesen sämtlicher Romane, die ihm unter die Hände kamen, begegnet wurde, begünstigten schnell das Hervorbrechen jener Traumwelt, in die sich Brentano Zeit seines Lebens phasenweise flüchten sollte.
Inhaltsverzeichnis
- Anlage und Veranlagung
- Die Verfügung der Sprache
- Die poetische Sprache der Liebe
- Die poetische Sprache der Schwermut
- Vergleichung und Exkurs: Die poetische Sprache Eichendorffs
- Die Sprache im Märchen
- Die Sprache im Drama
- Die Sprache im Brief
- Schluss:,,Brentanos Poetik“ und ihre Wirkung bis heute
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die poetische Sprache Clemens Brentanos. Ziel ist es, Brentanos einzigartige sprachliche Virtuosität zu analysieren und seine poetischen Ausdrucksmittel im Kontext seiner Biografie und seines Werkes zu beleuchten.
- Brentanos biografischer Hintergrund und seine dichterische Anlage
- Die besondere Beziehung Brentanos zur Sprache und deren Einfluss auf sein Schaffen
- Die Darstellung von Liebe und Schwermut in Brentanos poetischer Sprache
- Vergleichende Analyse von Brentanos Sprache mit der Sprache anderer Dichter (z.B. Eichendorff)
- Die Verwendung der Sprache in verschiedenen literarischen Gattungen (Märchen, Drama, Brief)
Zusammenfassung der Kapitel
Anlage und Veranlagung: Dieses Kapitel beleuchtet Brentanos frühen Lebensumstände und deren Einfluss auf seine dichterische Entwicklung. Es beschreibt seine Herkunft aus einer künstlerisch geprägten Familie (Vater mit poetischem Interesse, Großmutter Sophie von La Roche als erfolgreiche Schriftstellerin, Mutter mit Verbindung zu Goethe), die bereits eine künstlerische Veranlagung nahelegt. Die strenge Erziehung bei seiner Tante und der frühe Tod der Eltern führten zu einer frühen Flucht in eine eigene Traumwelt, die sich in seinem Werk widerspiegelt. Brentanos frühe literarische Beschäftigung, beispielsweise das Verfassen von reimenden Geschäftsbriefen, und die Schaffung eines Rückzugsorts ("Vaduz") werden ebenfalls hervorgehoben, gezeigt als Ausdruck seines früh erkannten poetischen Talents und Bedürfnisses nach künstlerischer Freiheit. Ein Zitat aus Goethes Stammbuch unterstreicht die besondere Beziehung zwischen Realität und innerer, poetischer Welt Brentanos.
Die Verfügung der Sprache: Dieses Kapitel analysiert Brentanos Umgang mit Sprache anhand von Emil Staigers Ausführungen. Im Gegensatz zu einem aktiven "Beherrschen" der Sprache beschreibt Staiger Brentanos Verhältnis zur Sprache als ein passives "Mitgerissenwerden". Die Sprache selbst bestimmt den Ausdruck, den poetischen Fluss und die entrückte Traumwelt, die in Brentanos Lyrik ersichtlich ist. Staiger betont das "eigentümliche Gleiten" der Sprache, ein Merkmal, das durch ein zitiertes Gedicht veranschaulicht wird. Das Kapitel hebt somit die besondere, fast unkontrollierbare Kraft und Dynamik von Brentanos poetischer Sprache hervor.
Die poetische Sprache der Liebe: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Verwendung der Sprache in Brentanos Liebeslyrik, insbesondere in Bezug auf seine Beziehung zu Emilie Lindner. Brentano verwendet ihren Namen und verwandte Wörter für poetische Sprachspiele, um die Intensität seiner Gefühle auszudrücken. Die "Lindheit" Emilies und ihre "lindernde" Wirkung auf ihn werden als zentrale Symbole analysiert. Das Kapitel beleuchtet also, wie Brentano Sprache nicht nur zur Beschreibung von Emotionen, sondern auch zur Gestaltung und Vermittlung von Gefühlen einsetzt, in diesem Fall die Liebe.
Schlüsselwörter
Clemens Brentano, Poetische Sprache, Sprachvirtuosität, Romantik, Biografie, Liebe, Schwermut, Emil Staiger, Lyrik, Märchen, Drama, Brief.
Häufig gestellte Fragen zu: Clemens Brentanos Poetische Sprache
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die poetische Sprache Clemens Brentanos, seine sprachliche Virtuosität und seine poetischen Ausdrucksmittel im Kontext seiner Biografie und seines Werkes.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Brentanos biografischen Hintergrund und dessen Einfluss auf sein dichterisches Schaffen, seine besondere Beziehung zur Sprache, die Darstellung von Liebe und Schwermut in seiner poetischen Sprache, einen Vergleich mit anderen Dichtern (z.B. Eichendorff) und die Verwendung der Sprache in verschiedenen literarischen Gattungen (Märchen, Drama, Brief).
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu: Anlage und Veranlagung, Die Verfügung der Sprache, Die poetische Sprache der Liebe, Die poetische Sprache der Schwermut, Vergleichung und Exkurs: Die poetische Sprache Eichendorffs, Die Sprache im Märchen, Die Sprache im Drama, Die Sprache im Brief und Schluss:,,Brentanos Poetik“ und ihre Wirkung bis heute.
Wie wird Brentanos Verhältnis zur Sprache beschrieben?
Brentanos Verhältnis zur Sprache wird nach Emil Staiger als passives "Mitgerissenwerden" beschrieben, im Gegensatz zu einem aktiven "Beherrschen". Die Sprache selbst bestimmt den Ausdruck und den poetischen Fluss.
Wie wird die Liebe in Brentanos Sprache dargestellt?
In Brentanos Liebeslyrik, insbesondere in Bezug auf seine Beziehung zu Emilie Lindner, werden deren Name und verwandte Wörter für poetische Sprachspiele verwendet, um die Intensität seiner Gefühle auszudrücken. "Lindheit" und "lindernde" Wirkung werden als zentrale Symbole analysiert.
Welche Rolle spielt Brentanos Biografie in der Analyse?
Brentanos Biografie spielt eine entscheidende Rolle, da seine frühen Lebensumstände (künstlerisch geprägte Familie, strenge Erziehung, früher Tod der Eltern) seine dichterische Entwicklung beeinflusst haben. Seine frühe literarische Beschäftigung und die Schaffung eines Rückzugsorts werden als Ausdruck seines poetischen Talents und Bedürfnisses nach künstlerischer Freiheit interpretiert.
Welche weiteren literarischen Gattungen werden untersucht?
Neben der Lyrik werden auch Brentanos Sprache im Märchen, im Drama und im Brief untersucht, um die Vielseitigkeit seines sprachlichen Ausdrucks zu beleuchten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Clemens Brentano, Poetische Sprache, Sprachvirtuosität, Romantik, Biografie, Liebe, Schwermut, Emil Staiger, Lyrik, Märchen, Drama, Brief.
Welche Zusammenfassung der Kapitel wird gegeben?
Die Arbeit bietet Kapitelzusammenfassungen, die jeweils die zentralen Themen und Argumentationslinien der einzelnen Kapitel kurz und prägnant beschreiben. Diese Zusammenfassungen liefern einen Überblick über den Inhalt und die Ergebnisse der einzelnen Analysen.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke gedacht und dient der Analyse von Themen in einer strukturierten und professionellen Weise.
- Quote paper
- Matthias Mühlhäuser (Author), 2005, Über Clemens Brentano: Die Virtuosität der Sprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/51386