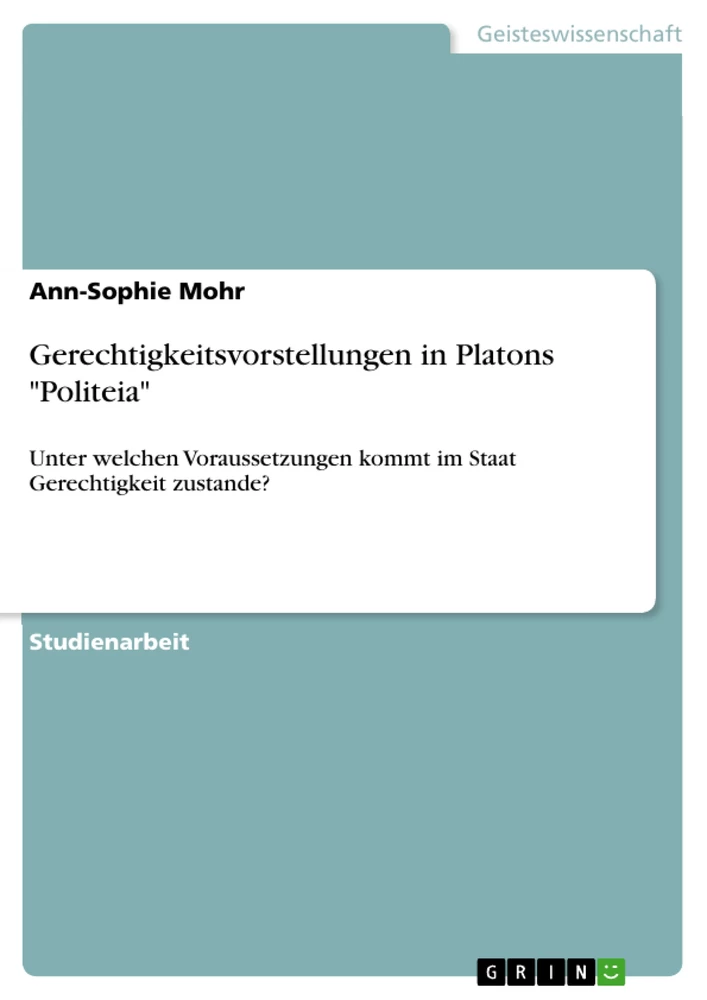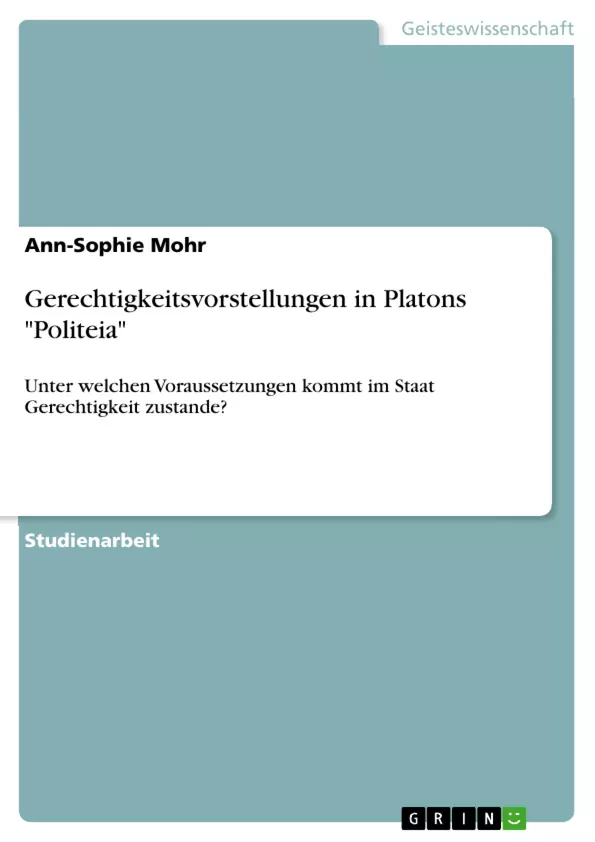Diese Arbeit setzt sich mit den Gerechtigkeitsvorstellungen in den Dialogen der Politeia und den Voraussetzungen, wie Gerechtigkeit in einem Staat zustande kommt, auseinander. Auf Grund der Dialogstruktur der Politeia ist es nur schwer möglich zu unterscheiden was Sokrates selbst vertreten hat und was Platon ihm in den Mund gelegt hat, deshalb wird Sokrates als Überbringer der platonischen Ansichten gesehen.
In dieser Ausarbeitung wird kein Unterschied zwischen der Figur des Sokrates und dem Autor Platon gemacht, beide Personen werden als synonym angesehen. Zunächst sollen die ersten Vorstellungen über Gerechtigkeit der Gesprächspartner des Sokrates Kephalos, Polemarchos, Thrasymachos und des Glaukon erläutert werden, da diese Auswirkung auf die Entwicklung von Sokrates Definition der Gerechtigkeit Einfluss nehmen.
Seit der Antike ist die Frage nach der Gerechtigkeit Gegenstand philosophischer Erörterungen und wird seid jeher als eine menschliche Tugend bezeichnet. Doch wenn wir versuchen eine Definition zu finden, was denn nun ganz genau gerecht ist wird es schnell kompliziert. Wie setzt man eine Grenze zwischen gerecht und ungerecht? Gerechtigkeit ist etwas, was das Ergebnis eines Denk- oder Urteilsprozesses ist. Letztendlich gibt es nicht die eine Definition von Gerechtigkeit. Jeder Mensch hat eigene Vorstellungen darüber was nun gerecht ist und was nicht. Wenn wir heute von Gerechtigkeit sprechen meinen wir meistens soziale Gerechtigkeit, also wie fair unter Menschen zum Beispiel Ressourcen, Möglichkeiten oder Rechte verteilt sind.
Aktuell beschäftigen sich die Menschen in Deutschland mit der Frage der Gerechtigkeit beim Thema Arm und Reich. Es wird sich gefragt, wie gerecht es ist, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer. Weltweit macht man sich Gedanken darüber, wie man Gerechtigkeit für alle schaffen kann, ein großes Thema bei dem der Gegensatz zur Gerechtigkeit, die Ungerechtigkeit, eine wichtige Rolle spielt, ist die aktuelle Debatte um den Klimawandel. Inwiefern ist es ungerecht, dass heute lebende Generationen die Zukunft der Nachkommen zerstören? Das Thema Gerechtigkeit wirft eine Menge an Fragen und Gedanken in unsere Gesellschaft und in jeden einzelnen Menschen, es ist sehr komplex und es scheint als würde man niemals auf die eine Lösung kommen, die für alle gerecht ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Erste Vorstellungen von Gerechtigkeit
- 2.1 Dialoge mit Kephalos und Polemarchos
- 2.2 Die Gegenargumentation des Thrasymachos
- 2.3 Die Erwartungen des Glaukon
- 3. Der Aufbau des Platonischen Staates
- 3.1 Entstehung des Staates
- 3.2 Die Gruppe der Wächter und Herrscher
- 4. Die Anwendung des Staatsmodells zur Bestimmung von Gerechtigkeit
- 4.1 Gerechtigkeit im Staat
- 4.2 Gerechtigkeit im Menschen
- 4.3 Die vier Ungerechten Staaten und Menschen
- 5. Übertragung der Gerechtigkeitsdefinition auf heute
- 5.1 Übertragung der Staatenbildung
- 6. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Platons Gerechtigkeitsvorstellungen in der Politeia und die Voraussetzungen für Gerechtigkeit im Staat. Der Fokus liegt auf den Büchern 1-4, 7 und 8. Die Arbeit analysiert die unterschiedlichen Gerechtigkeitsauffassungen der Gesprächspartner Sokrates' und untersucht die Entwicklung von Sokrates' eigener Gerechtigkeitsdefinition. Das platonische Staatsmodell wird auf die Bestimmung von Gerechtigkeit angewendet und schließlich die Übertragbarkeit der Definition auf die Gegenwart geprüft.
- Entwicklung von Gerechtigkeitsvorstellungen bei Platon
- Das platonische Staatsmodell und seine Beziehung zu Gerechtigkeit
- Gerechtigkeit im Staat versus Gerechtigkeit im Individuum
- Platons Konzept der ungerechten Staatsformen
- Übertragbarkeit von Platons Gerechtigkeitskonzept auf die Moderne
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Gerechtigkeit ein und beschreibt deren Komplexität und Vielschichtigkeit. Sie stellt die Bedeutung von Gerechtigkeit in der Philosophie und im gesellschaftlichen Diskurs heraus und beleuchtet aktuelle Debatten um soziale Gerechtigkeit und den Klimawandel als Beispiele für die anhaltende Relevanz des Themas. Platons Politeia wird als zentrale Quelle für die Untersuchung der Gerechtigkeitsvorstellungen vorgestellt, und der Fokus der Arbeit auf die Bücher 1-4, 7 und 8 wird begründet. Schließlich wird die methodische Vorgehensweise skizziert, wobei die Synonymität von Sokrates und Platon als Autor betont wird.
2. Erste Vorstellungen von Gerechtigkeit: Dieses Kapitel analysiert die unterschiedlichen Gerechtigkeitskonzepte, die Sokrates’ Gesprächspartner Kephalos, Polemarchos und Thrasymachos im ersten Buch der Politeia präsentieren. Es zeigt, wie Sokrates diese Konzepte durch argumentative Auseinandersetzung widerlegt und somit den Weg für seine eigene Gerechtigkeitsdefinition ebnet. Die unterschiedlichen Perspektiven illustrieren die Schwierigkeit, eine umfassende und allgemein akzeptierte Definition von Gerechtigkeit zu finden. Die Diskussion dient als Ausgangspunkt für Sokrates’ weiterführende Überlegungen zum Thema.
3. Der Aufbau des Platonischen Staates: Dieses Kapitel beschreibt Platons Konzept des idealen Staates, welches die Grundlage seiner Gerechtigkeitsauffassung bildet. Die Entstehung und die Struktur des Staates werden erläutert, wobei besonderes Augenmerk auf die Rolle der Wächter und Herrscher gelegt wird. Die Beschreibung des Staatsaufbaus ist essentiell, um zu verstehen, wie Platon Gerechtigkeit im politischen Kontext verwirklichen will. Die Kapitel beleuchtet den Zusammenhang zwischen der Struktur des idealen Staates und Platons Vorstellung von Gerechtigkeit.
4. Die Anwendung des Staatsmodells zur Bestimmung von Gerechtigkeit: In diesem Kapitel wird Platons Staatsmodell angewendet, um seine Definition von Gerechtigkeit zu konkretisieren. Es wird die Unterscheidung zwischen Gerechtigkeit im Staat und Gerechtigkeit im Individuum herausgearbeitet und die vier ungerechten Staatsformen nach Platon beschrieben. Die Analyse zeigt, wie Platon Gerechtigkeit als Harmonie und Ordnung in der Seele des Menschen und im Staat versteht, wobei jede Gruppe ihre spezifische Rolle einnehmen muss. Die vier ungerechten Staatsformen dienen als Gegenbeispiele zu Platons idealem Staat und verdeutlichen die Konsequenzen von Ungerechtigkeit.
5. Übertragung der Gerechtigkeitsdefinition auf heute: Dieses Kapitel untersucht die Übertragbarkeit von Platons Gerechtigkeitskonzept auf die Gegenwart. Es wird analysiert, inwiefern Platons Ideen zur Staatsbildung und zur Gerechtigkeit in der heutigen Zeit relevant sind und welche Herausforderungen sich bei der Anwendung seiner Konzepte stellen. Die Übertragbarkeit wird im Kontext der heutigen politischen und sozialen Verhältnisse diskutiert.
Schlüsselwörter
Gerechtigkeit, Platon, Politeia, idealer Staat, Staatsmodell, Gerechtigkeitstheorien, Ungerechtigkeit, Wächter, Herrscher, Seele, Harmonie, Soziale Gerechtigkeit, Moderne.
Häufig gestellte Fragen zu Platons Gerechtigkeitsvorstellungen in der Politeia
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Platons Gerechtigkeitsvorstellungen in der Politeia, insbesondere in den Büchern 1-4, 7 und 8. Sie untersucht die verschiedenen Gerechtigkeitsauffassungen der Gesprächspartner Sokrates' im ersten Buch, die Entwicklung von Sokrates' eigener Definition, die Anwendung des platonischen Staatsmodells auf die Bestimmung von Gerechtigkeit und die Übertragbarkeit dieser Definition auf die Gegenwart. Die Arbeit beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Entwicklung von Gerechtigkeitsvorstellungen bei Platon, das platonische Staatsmodell und seine Beziehung zu Gerechtigkeit, Gerechtigkeit im Staat versus Gerechtigkeit im Individuum, Platons Konzept der ungerechten Staatsformen und die Übertragbarkeit von Platons Gerechtigkeitskonzept auf die Moderne.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung (Einführung in die Thematik und Methodik), Erste Vorstellungen von Gerechtigkeit (Analyse der Gerechtigkeitskonzepte von Kephalos, Polemarchos und Thrasymachos), Der Aufbau des Platonischen Staates (Beschreibung des idealen Staates und der Rolle von Wächtern und Herrschern), Die Anwendung des Staatsmodells zur Bestimmung von Gerechtigkeit (Unterscheidung von Gerechtigkeit im Staat und Individuum, Beschreibung ungerechter Staatsformen), Übertragung der Gerechtigkeitsdefinition auf heute (Übertragbarkeit von Platons Ideen auf die Gegenwart) und Schluss.
Wie wird Platons Gerechtigkeitsdefinition bestimmt?
Platons Gerechtigkeitsdefinition wird durch die Analyse der Dialoge mit Kephalos, Polemarchos und Thrasymachos im ersten Buch der Politeia entwickelt. Das platonische Staatsmodell, mit seiner Beschreibung des idealen Staates und der Rollenverteilung (Wächter, Herrscher), dient als Grundlage zur Konkretisierung der Definition. Gerechtigkeit wird als Harmonie und Ordnung in der Seele des Menschen und im Staat verstanden.
Welche Rolle spielt das platonische Staatsmodell?
Das platonische Staatsmodell ist zentral für die Bestimmung von Gerechtigkeit. Es liefert ein konkretes Beispiel für die Verwirklichung von Gerechtigkeit im politischen Kontext. Die Struktur des Staates, insbesondere die Rollen von Wächtern und Herrschern, spiegelt Platons Vorstellung von der harmonischen Ordnung in der Gesellschaft wider.
Wie relevant ist Platons Gerechtigkeitskonzept für die Gegenwart?
Die Arbeit untersucht die Übertragbarkeit von Platons Gerechtigkeitskonzept auf die heutige Zeit. Es wird analysiert, inwiefern Platons Ideen zur Staatsbildung und Gerechtigkeit in der heutigen politischen und sozialen Realität relevant sind und welche Herausforderungen sich bei der Anwendung seiner Konzepte stellen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Gerechtigkeit, Platon, Politeia, idealer Staat, Staatsmodell, Gerechtigkeitstheorien, Ungerechtigkeit, Wächter, Herrscher, Seele, Harmonie, Soziale Gerechtigkeit, Moderne.
Wer sind die wichtigsten Gesprächspartner Sokrates'?
Die wichtigsten Gesprächspartner Sokrates' im ersten Buch der Politeia, die unterschiedliche Gerechtigkeitsauffassungen vertreten, sind Kephalos, Polemarchos und Thrasymachos.
Welche ungerechten Staatsformen beschreibt Platon?
Die Arbeit erwähnt die vier ungerechten Staatsformen nach Platon, die als Gegenbeispiele zum idealen Staat dienen und die Konsequenzen von Ungerechtigkeit verdeutlichen. Die genaue Beschreibung dieser Staatsformen findet sich im Kapitel 4.
- Quote paper
- Ann-Sophie Mohr (Author), 2019, Gerechtigkeitsvorstellungen in Platons "Politeia", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/514052