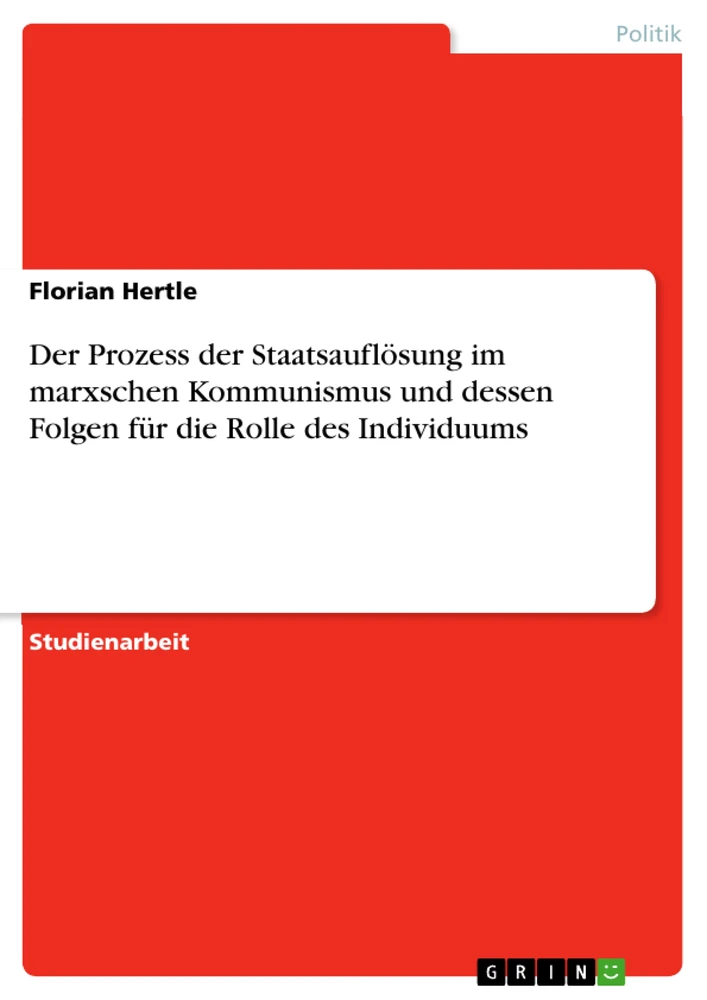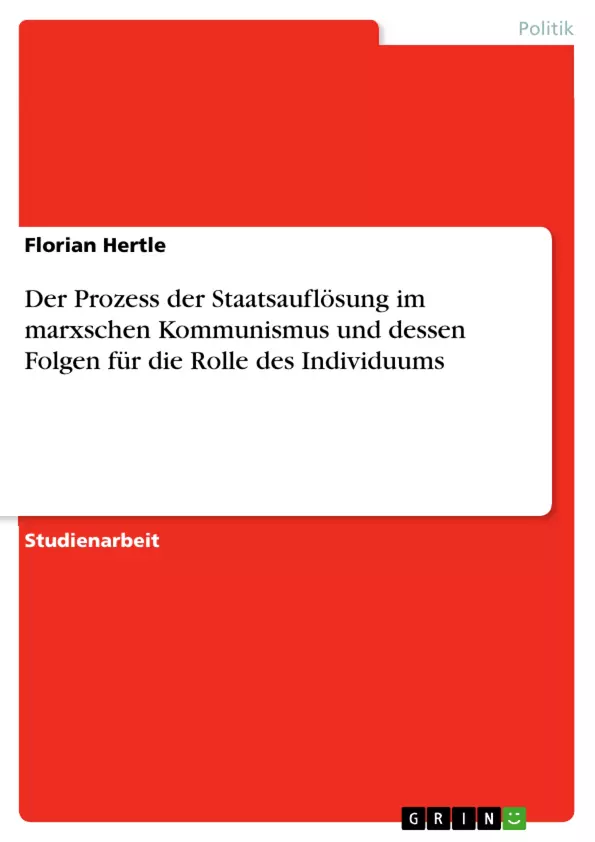Karl Marx wurde zeit seines Lebens mit Einschränkungen seiner Freiheit konfrontiert. Um Freiheit zu verwirklichen, hat sich Marx während seiner Schaffensphase unter anderem ausführlich mit dem Staat, seiner Funktion und dessen Perspektive auseinandergesetzt. Seine Staatstheorie liegt jedoch in keiner geschlossenen Darstellung in einem Werk vor und hat deshalb eher fragmentarischen Charakter.
Ziel dieser Arbeit ist es zu prüfen, welche Auswirkung die von Marx konstruierte Gesellschafts- und Staatsvorstellung auf das Individuum hat und ob es durch diese der von Marx gewünschten Freiheit näherkommt. Hierzu wird zunächst aufgezeigt, wie Marx die Rolle des Individuums im vorkommunistischen Zustand darstellt. Im Folgenden wird das marxsche Staatsbild und seine staatspolitischen Forderungen analysiert, bevor der nach Marx erdachte Prozess des Übergangs und der Ausformung des Kommunismus beleuchtet wird. Schließlich werden die aus den vorhergehenden Kapiteln gewonnen Erkenntnisse dazu genutzt, um zu erörtern, welche Rolle dem Individuum im vollendeten Kommunismus zukommt. Hierbei werden die Aufgaben, Freiheitsräume und die Bedeutung und Position des einzelnen Individuums im marxschen Kommunismus herausgestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Rolle des Individuums im vorkommunistischen Zustand nach Marx
- Die wirtschaftlichen Verhältnisse im vorkommunistischen Zustand
- Die persönliche und gesellschaftliche Selbstentfremdung
- Marx Staatsbild und seine staatspolitischen Forderungen
- Generelles Staatsbild von Marx
- Religions- und Freiheitsrechte und die wahre Emanzipation
- Verhältnis von Staat und Gesellschaft und die Rolle der Demokratie
- Der Prozess des Übergangs in den Kommunismus
- Die Herausbildung des Kommunismus
- Die Kommune als Instrument zur Einführung des Kommunismus
- Die Rolle des Individuums im vollendeten Kommunismus
- Aufgaben
- Freiheitsräume und Entfaltungsmöglichkeiten
- Bedeutung und Position im System des Kommunismus
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Auswirkungen der von Karl Marx konstruierten Gesellschafts- und Staatsvorstellung auf das Individuum und untersucht, ob diese der von Marx gewünschten Freiheit näherbringt.
- Die Rolle des Individuums im vorkommunistischen Zustand
- Das marxsche Staatsbild und seine staatspolitischen Forderungen
- Der Prozess des Übergangs in den Kommunismus
- Die Rolle des Individuums im vollendeten Kommunismus
- Die Kritik an der kapitalistischen Produktionsweise und die Rolle der Mehrwertgewinnung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Einschränkungen der Freiheit, die Marx selbst erlebt hat, beleuchtet und den Hintergrund seiner Auseinandersetzung mit Staat und Gesellschaft darstellt. Im zweiten Kapitel wird die Rolle des Individuums in der kapitalistischen Gesellschaft, also dem vorkommunistischen Zustand, betrachtet. Hier werden die wirtschaftlichen Verhältnisse im Kapitalismus und die persönliche und gesellschaftliche Entfremdung analysiert.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit dem marxschen Staatsbild und seinen staatspolitischen Forderungen. Hier wird das generelle Staatsbild von Marx erläutert sowie die Rolle von Religions- und Freiheitsrechten und das Verhältnis von Staat und Gesellschaft im Kontext der Demokratie beleuchtet.
Kapitel 4 beschreibt den nach Marx erdachten Prozess des Übergangs und der Ausformung des Kommunismus, wobei die Herausbildung des Kommunismus und die Kommune als Instrument zur Einführung des Kommunismus näher betrachtet werden.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind die Marxsche Staatstheorie, die Rolle des Individuums in vorkommunistischem und kommunistischem Kontext, die Kritik an der kapitalistischen Produktionsweise, die Entfremdung im Kapitalismus, die Bedeutung von Produktionsverhältnissen und die Herausbildung des Kommunismus.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Marx unter der „Staatsauflösung“?
Marx geht davon aus, dass der Staat im vollendeten Kommunismus überflüssig wird und abstirbt, da es keine Klassenunterschiede mehr gibt, die er unterdrücken müsste.
Wie definiert Marx die Rolle des Individuums im Kapitalismus?
Im vorkommunistischen Zustand leidet das Individuum unter persönlicher und gesellschaftlicher Selbstentfremdung durch die kapitalistischen Produktionsverhältnisse.
Was ist das Ziel des marxschen Kommunismus für den Einzelnen?
Ziel ist die Erlangung wahrer Freiheit und Emanzipation, bei der die Entfaltungsmöglichkeiten des Individuums nicht mehr durch wirtschaftlichen Zwang eingeschränkt sind.
Welche Rolle spielt die „Kommune“ im Übergangsprozess?
Die Kommune wird als Instrument betrachtet, um den Übergang vom Kapitalismus zum Kommunismus politisch und organisatorisch zu gestalten.
Gibt es bei Marx eine geschlossene Staatstheorie?
Nein, seine Überlegungen zum Staat liegen nicht in einem einzelnen Werk vor, sondern haben eher einen fragmentarischen Charakter über sein Gesamtwerk verteilt.
Was bedeutet „wahre Emanzipation“ im Gegensatz zu bloßer politischer Freiheit?
Wahre Emanzipation bedeutet für Marx die Befreiung von allen entfremdenden Verhältnissen, nicht nur die formale Gleichheit vor dem Gesetz.
- Quote paper
- Florian Hertle (Author), 2019, Der Prozess der Staatsauflösung im marxschen Kommunismus und dessen Folgen für die Rolle des Individuums, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/515013