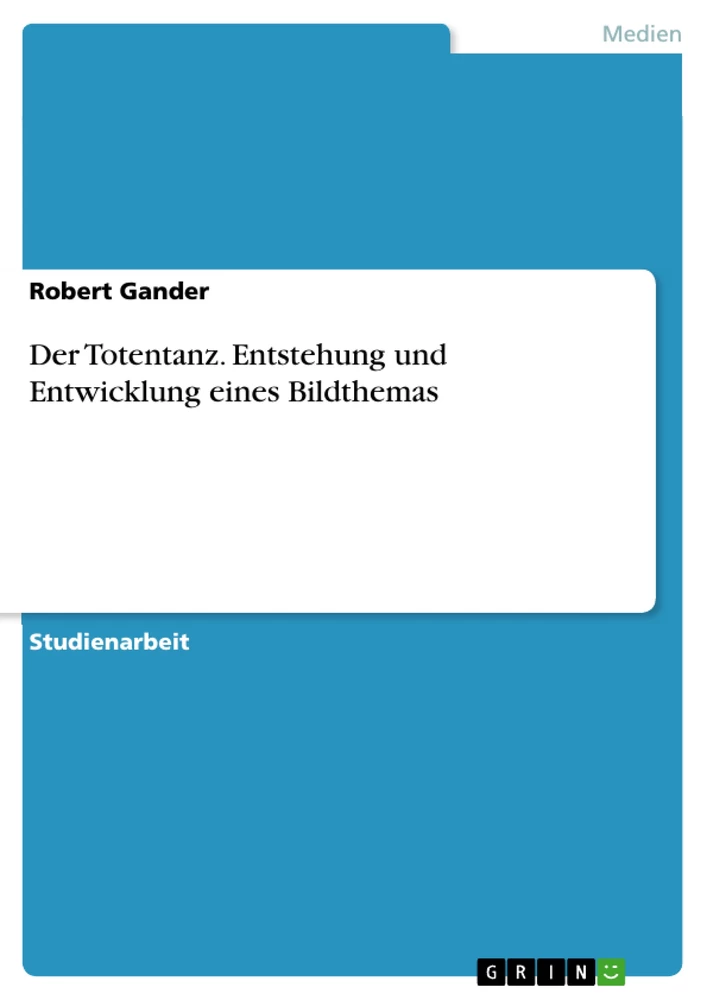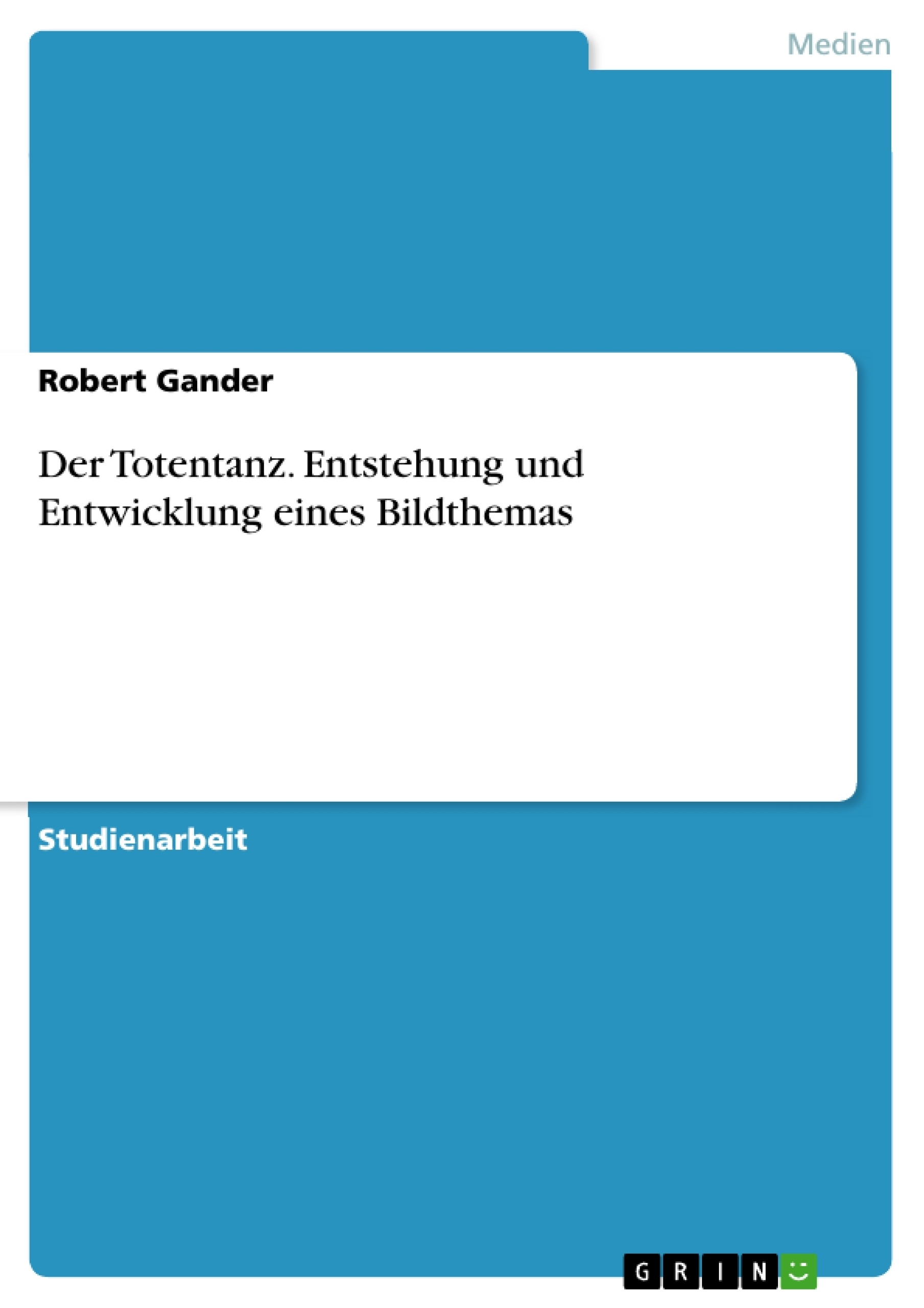Die Bildtradition des Totentanzes ist eine der populärsten Todesbilder, deren ununterbrochene Kontinuität vom Mittelalter bis in unsere Gegenwart zu beobachten ist. Damals wie heute bildet, wenn auch unter verschiedenen gesellschaftlichen Blickwinkeln, die zeitliche wie räumliche Allgegenwärtigkeit des Todes im Leben der Menschen die Kernaussage der Totentanzvorstellung. Der personifizierte Tod greift handelnd in das Leben der Menschen ein. In ihrer künstlerischen Umsetzung war die Bildidee im Laufe der Jahrhunderte mancher Veränderung unterworfen. Aus der ursprünglich mythisch-religiösen, auf das Jenseits gerichteten Vorstellung des Mittelalters wird eine vom Humanismus und der Reformation beeinflusste Ständesatire und gesellschaftliche Morallehre der Renaissance. Der vorwiegend sinnbildhaften Verwendung der Totentanzvorstellung im Barock folgt eine stete Verweltlichung im Zeitalter der industriellen Revolution. An die Stelle des mittelalterlichen Ständereigen („Kaiser, König, Bettelmann“) treten in neuerer Zeit Themen wie das mechanische Töten in Kriegen oder die Ängste vor neuen technischen Errungenschaften, wie der Eisenbahn und später des Autos und des Flugzeuges. Neben traditionellen Themen von überzeitlicher Bedeutung findet ebenso der Tod des Menschen im nuklearen Zeitalter Eingang in das Bildrepertoire der Totentanzdarstellungen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Vorläufer in der Todesdarstellung
- Entstehung des Topos
- Definition
- Die Legende von den drei Lebenden und den drei Toten
- Die Vado-mori-Verse
- Der lateinische Totentanztext
- Die Ars moriendi
- Memento mori und die Conflictusliteratur
- Früheste bildliche Darstellungen
- Der Heidelberger Codex
- Die Blockbücher
- Die Pest als Ursache?
- Erste Monumentalzyklen
- La Chaise-Dieu
- Aux SS. Innocents
- Basler und Berner Totentänze
- Tanzchoreografie
- Tanz im Spätmittelalter
- Der Kettenreigen bzw. Branle
- Der paarweise Aufzug bzw. Basse danse
- Der Basler Totentanz
- Die Zeit, in der die Totentänze entstanden
- Aufbau
- Erste bezeugte Restauration im 16. Jahrhundert
- Das Totentanzbild im 17. und 18. Jahrhundert
- Abbruch im Zuge der Aufklärung
- Die Geschichte des Lübecker Totentanzes
- Urheberschaft
- Aufbau
- Restaurationen
- Neuerungen im Bedeutungsgefüge
- Holbeins Bilder des Todes
- Das Ende der alten Idee
- Das Weiterleben der alten Motive
- Neuzeitliche Entwicklung
- Barock
- Profanisierung des Todes im 18. Jahrhundert
- Historismus
- 20. und 21. Jahrhundert
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung und Entwicklung des Totentanz-Bildthemas vom Mittelalter bis in die Neuzeit. Ziel ist es, die ikonografischen Veränderungen und die gesellschaftlichen Einflüsse auf die Darstellung des Todes im Laufe der Jahrhunderte zu analysieren.
- Die Entwicklung der ikonografischen Darstellung des Todes
- Der Einfluss von Religion und Gesellschaft auf die Totentanz-Darstellung
- Die Rolle des Totentanzes als Ständesatire und Morallehre
- Die Veränderung der Thematik im Laufe der Geschichte
- Die Bedeutung des Totentanzes als Spiegelbild der jeweiligen Epoche
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Das Vorwort führt in die Thematik des Totentanzes ein und beschreibt dessen anhaltende Relevanz vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Es hebt die fortwährende Auseinandersetzung mit dem Tod in unterschiedlichen gesellschaftlichen Kontexten hervor und deutet auf die Veränderungen der künstlerischen Umsetzung im Laufe der Jahrhunderte hin, von den mythisch-religiösen Vorstellungen des Mittelalters bis zur Verweltlichung im Zeitalter der Industrialisierung.
Vorläufer in der Todesdarstellung: Dieses Kapitel beleuchtet die verschiedenen Vorstellungen und bildlichen Darstellungen des Todes in verschiedenen Kulturen und Epochen, von der Antike bis zum frühen Mittelalter. Es zeigt die Entwicklung von frühen Todessymboliken wie dem Skelett über religiöse und philosophische Interpretationen bis hin zu den spezifischen bildlichen Darstellungen des späten Mittelalters. Dabei werden verschiedene ikonografische Topoi wie der „Schnitter Tod“ oder der „Tod als Reiter“ erläutert und in ihren historischen Kontext eingeordnet.
Entstehung des Topos: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Definition des Totentanzes als Bildmotiv und seine Entstehung. Es beschreibt den Totentanz als eine Folge von Bildern mit allegorischem, moralischem oder satirischem Bezug und thematisiert die verschiedenen theoretischen Grundlagen seiner Entstehung, wie den Glauben an die Auferstehung und die volkstümliche Vorstellung der "Armen Seelen". Die unterschiedlichen Definitionen des Totentanzes werden diskutiert und ein differenziertes Verständnis des Themas entwickelt.
Früheste bildliche Darstellungen: Das Kapitel behandelt die ersten bildlichen Darstellungen des Totentanzes, darunter der Heidelberger Codex und die Blockbücher. Es untersucht die möglichen Ursachen für die Entstehung des Totentanzmotivs, wobei die Pest als ein möglicher Faktor diskutiert wird. Der Fokus liegt auf den frühen Formen des Totentanzes und ihren ikonografischen Besonderheiten.
Erste Monumentalzyklen: Dieser Abschnitt analysiert die ersten großen Totentanzzyklen, insbesondere in La Chaise-Dieu, Aux SS. Innocents und die Basler und Berner Totentänze. Die Bedeutung dieser monumentalen Darstellungen für die Verbreitung und Entwicklung des Totentanzmotivs wird untersucht, wobei die jeweiligen stilistischen und inhaltlichen Besonderheiten im Vordergrund stehen.
Tanzchoreografie: Das Kapitel widmet sich der Choreografie des Totentanzes im Kontext des spätmittelalterlichen Tanzes, darunter der Kettenreigen und die paarweise Aufzüge. Es beleuchtet die Zusammenhänge zwischen der Tanzform und der Symbolik des Totentanzes, sowie die unterschiedlichen Bewegungsabläufe und deren Bedeutung.
Schlüsselwörter
Totentanz, Todesdarstellung, Mittelalter, Renaissance, Barock, Ikonografie, Ständesatire, Memento mori, Jüngstes Gericht, Pest, Gesellschaftliche Moral, Bildtradition, Vergänglichkeit.
Häufig gestellte Fragen zum Thema "Totentanz"
Was ist der Inhalt der vorliegenden Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Entstehung und Entwicklung des Totentanz-Bildthemas vom Mittelalter bis in die Neuzeit. Sie untersucht die ikonografischen Veränderungen und die gesellschaftlichen Einflüsse auf die Darstellung des Todes im Laufe der Jahrhunderte. Die Arbeit beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung der ikonografischen Darstellung des Todes, den Einfluss von Religion und Gesellschaft auf die Totentanz-Darstellung, die Rolle des Totentanzes als Ständesatire und Morallehre, die Veränderung der Thematik im Laufe der Geschichte und die Bedeutung des Totentanzes als Spiegelbild der jeweiligen Epoche. Es werden verschiedene Vorläufer in der Todesdarstellung beleuchtet, die Entstehung des Topos "Totentanz" untersucht und frühe bildliche Darstellungen sowie monumentale Zyklen analysiert. Die Tanzchoreografie, die Geschichte spezifischer Totentänze (Basel, Lübeck) und Holbeins Bilder des Todes werden ebenso behandelt wie die neuzeitliche Entwicklung bis ins 21. Jahrhundert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Vorläufern in der Todesdarstellung, der Entstehung des Topos Totentanz (inkl. Definition, Legende der drei Lebenden und drei Toten, Vado-mori-Verse, lateinischer Totentanztext, Ars moriendi, Memento mori und Conflictusliteratur), frühesten bildlichen Darstellungen (Heidelberger Codex, Blockbücher, Pest als Ursache), ersten Monumentalzyklen (La Chaise-Dieu, Aux SS. Innocents, Basler und Berner Totentänze), Tanzchoreografie (Spätmittelalterlicher Tanz, Kettenreigen, Basse danse), dem Basler Totentanz (Entstehung, Aufbau, Restaurationen, Abbruch), der Geschichte des Lübecker Totentanzes (Urheberschaft, Aufbau, Restaurationen, Bedeutungsgefüge), Holbeins Bildern des Todes (Ende alter Ideen, Weiterleben alter Motive) und der neuzeitlichen Entwicklung (Barock, Profanisierung des Todes im 18. Jahrhundert, Historismus, 20. und 21. Jahrhundert).
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Totentanz, Todesdarstellung, Mittelalter, Renaissance, Barock, Ikonografie, Ständesatire, Memento mori, Jüngstes Gericht, Pest, Gesellschaftliche Moral, Bildtradition, Vergänglichkeit.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Entstehung und Entwicklung des Totentanz-Bildthemas vom Mittelalter bis in die Neuzeit und analysiert die ikonografischen Veränderungen und die gesellschaftlichen Einflüsse auf die Darstellung des Todes im Laufe der Jahrhunderte.
Wer sollte diese Arbeit lesen?
Diese Arbeit ist für alle interessant, die sich für die Geschichte der Kunst, die Darstellung des Todes in der Kunstgeschichte, mittelalterliche und neuzeitliche Kulturgeschichte und die Ikonografie interessieren. Sie ist besonders relevant für Studierende und Wissenschaftler im Bereich der Kunstgeschichte, Geschichtswissenschaft und der Kulturwissenschaften.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist übersichtlich strukturiert mit einem Inhaltsverzeichnis, einer Einleitung mit Zielsetzung und Themenschwerpunkten, einer Kapitelzusammenfassung und einer Liste von Schlüsselwörtern. Die Kapitel sind klar gegliedert und bieten einen umfassenden Überblick über das Thema.
- Arbeit zitieren
- Robert Gander (Autor:in), 2004, Der Totentanz. Entstehung und Entwicklung eines Bildthemas, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/51559