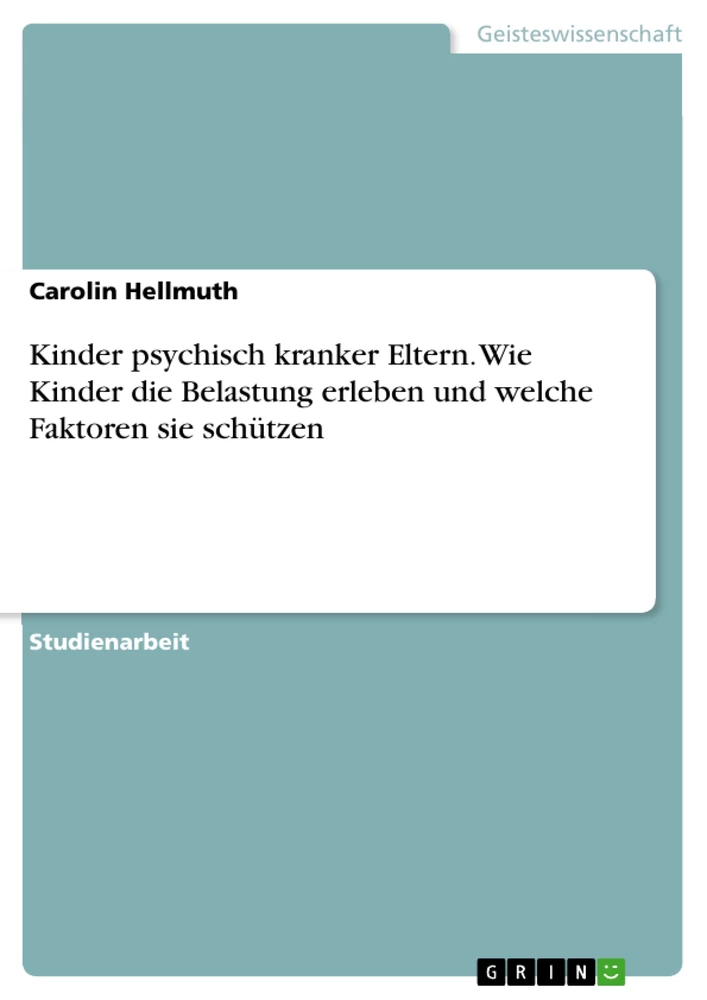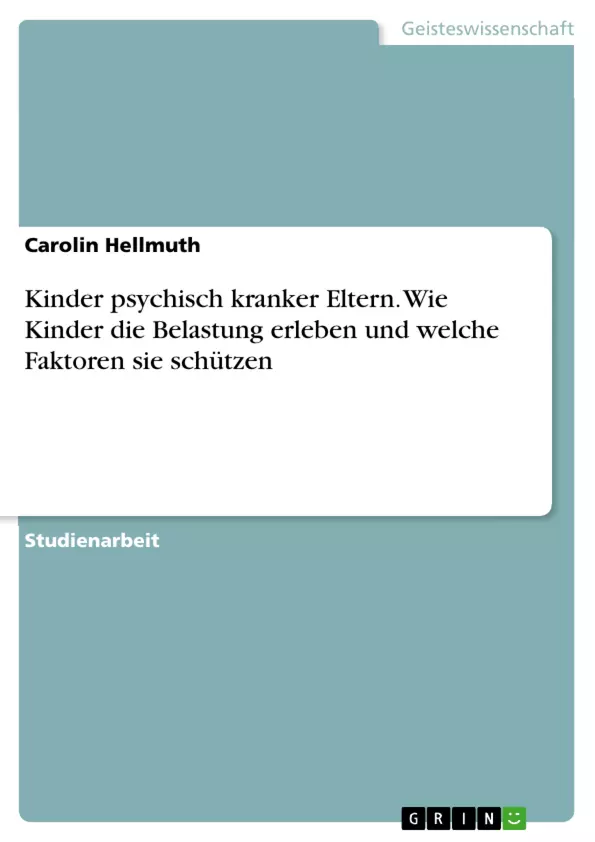Für Kinder stellt das Zusammenleben mit einem psychisch kranken Elternteil ein besonders kritisches Lebensereignis dar. Trotz der schätzungsweise 3 Millionen betroffenen Kinder gibt es jedoch nur wenige beratende und begleitende Einrichtungen. Die Belastungen und die damit verbundenen Entwicklungsrisiken wurden in zahlreichen Studien untersucht - wobei die Wahrscheinlichkeit, Verhaltensauffälligkeiten oder Entwicklungsstörungen zu entwickeln, bei betroffenen Kindern besonders hoch ist. Gewisse Schutzfaktoren wie eine erhöhte genetische Vulnerabilität, ein hohes Maß an Resilienz oder Ressourcen unterschiedlichster Ebenen können das betroffene Kind zu einem gesunden und selbstbewussten Erwachsenen heranwachsen lassen. Besonders gefährdet jedoch sind Kinder mit wenigen sozialen und psychischen Ressourcen. Besonders hervorzuheben gilt jedoch, dass psychisch erkrankte Eltern keineswegs schlechte Eltern sind und dass ihre Kinder nahezu immer wichtig für sie sind - denn aufgrund ihrer Elternrolle erleben sie Nähe, Freude, Stolz sowie Zugehörigkeit und Lebenssinn. Im ersten Abschnitt meiner Arbeit möchte ich einen kurzen Überblick über bestimmte psychische Erkrankungsbilder geben, um einen besseren Einblick über Symptomatiken zu ermöglichen. Im nachfolgenden Teil beschäftige ich mich mit der Perspektive der Kinder, worauf ich mich in meiner Arbeit aufgrund der Komplexität des Themas konzentrieren möchte. Genauer beleuchten möchte ich dabei die Risiko- und Schutzfaktoren, Bewältigungsstrategien und das subjektive Belastungserleben der Kinder.
Inhaltsverzeichnis
- 1 EINLEITUNG
- 2 PSYCHISCHE ERKRANKUNGEN
- 2.1 AFFEKTIVE STÖRUNGEN
- 2.2 SCHIZOPHRENE PSYCHOSEN
- 2.3 ANGST- UND PANIKSTÖRUNGEN.
- 2.4 PERSÖNLICHKEITSSTÖRUNGEN.
- 3 PERSPEKTIVE DER KINDER PSYCHISCH KRANKER ELTERN
- 3.1 RISIKOFAKTOREN.
- 3.2 SUBJEKTIVES BELASTUNGSERLEBEN DER KINDER
- 3.3 WIE KINDER BELASTUNGEN BEWÄLTIGEN KÖNNEN
- 3.4 SCHUTZFAKTOREN
- 4 SCHLUSSBEMERKUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Auswirkungen psychischer Erkrankungen von Eltern auf ihre Kinder. Sie analysiert die verschiedenen Belastungen, denen diese Kinder ausgesetzt sind, und beleuchtet zugleich die Faktoren, die ihnen helfen können, diese Herausforderungen zu bewältigen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem subjektiven Belastungserleben der Kinder, den relevanten Risikofaktoren und den förderlichen Schutzfaktoren.
- Psychische Belastungen von Kindern psychisch kranker Eltern
- Risikofaktoren und ihre Auswirkungen auf die Entwicklung der Kinder
- Subjektives Belastungserleben der Kinder und Bewältigungsstrategien
- Schutzfaktoren und Ressourcen, die die Widerstandsfähigkeit stärken
- Das Zusammenleben von Kindern mit psychisch kranken Eltern und die Rolle der Elternrolle
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Problematik des Zusammenlebens von Kindern mit psychisch kranken Eltern dar. Kapitel 2 bietet einen Überblick über verschiedene psychische Erkrankungen, wie affektive Störungen, schizophrene Psychosen und Angststörungen. Die verschiedenen Störungsbilder und ihre möglichen Auswirkungen auf Kinder werden beleuchtet. Kapitel 3 rückt die Perspektive der Kinder in den Vordergrund und fokussiert auf die Risikofaktoren, das subjektive Belastungserleben, Bewältigungsstrategien und die Schutzfaktoren, die Kindern helfen können, mit den Herausforderungen zurechtzukommen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der psychischen Erkrankungen von Eltern, den Folgen für ihre Kinder, den relevanten Risikofaktoren und Schutzfaktoren. Wichtige Schlüsselbegriffe sind: psychische Erkrankungen, affektive Störungen, Schizophrenie, Angststörungen, Belastungserleben, Risikofaktoren, Schutzfaktoren, Resilienz, Bewältigungsstrategien, subjektive Erfahrungen, Familienleben, Kinder, Elternrolle.
- Quote paper
- Carolin Hellmuth (Author), 2016, Kinder psychisch kranker Eltern. Wie Kinder die Belastung erleben und welche Faktoren sie schützen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/516614