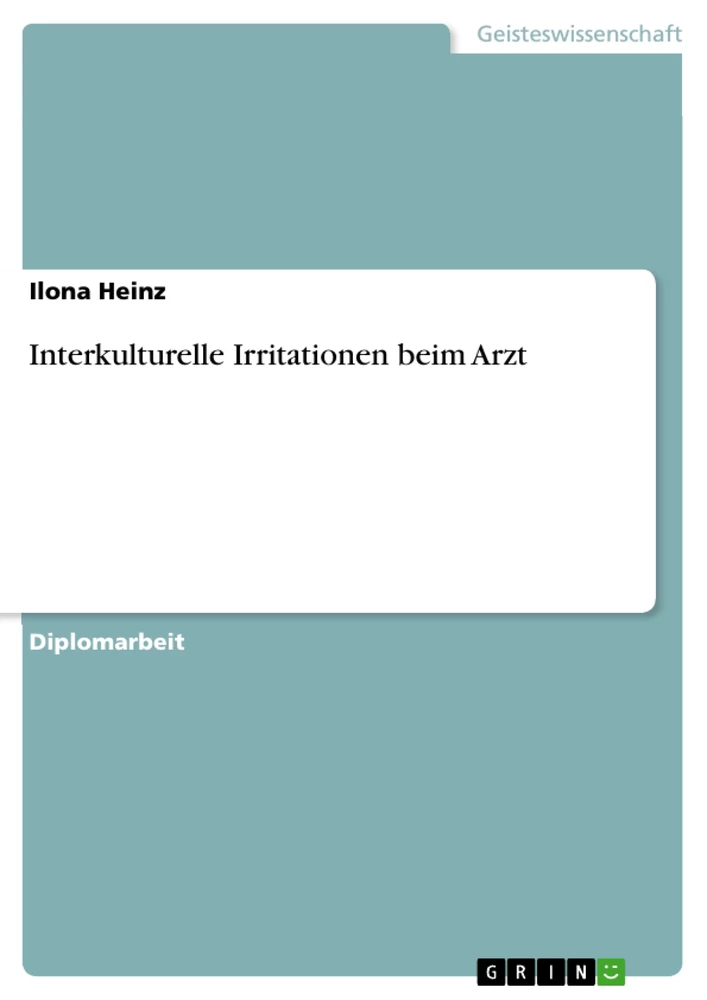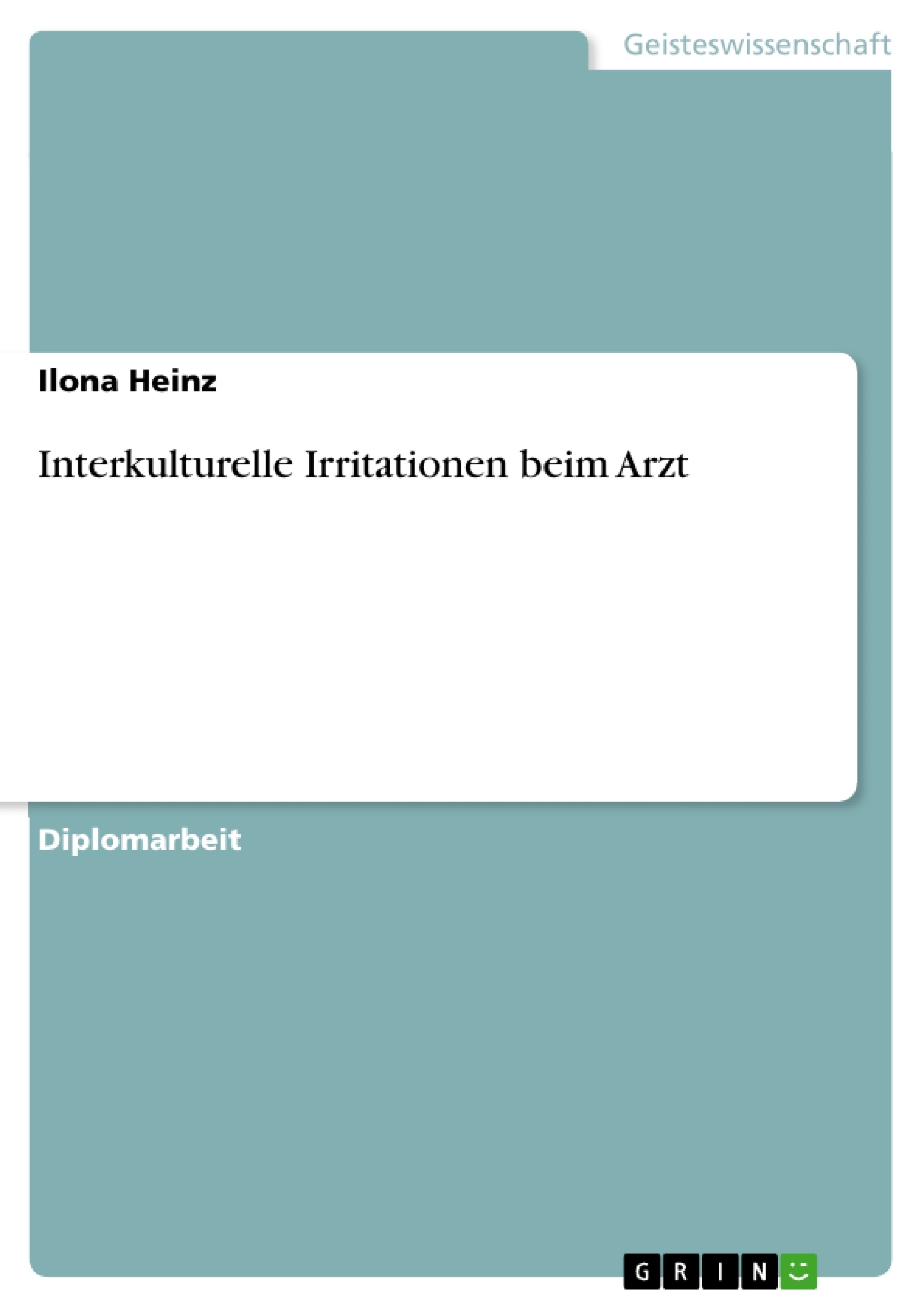Einleitung
„Une rose n’ est pas une rose.“ Diese Feststellung des französischen Dichters Mallarmé beschreibt treffend, was auch Kernpunkt dieser Arbeit ist: mit dem Wort ‚Rose’ verhält es sich genauso, wie mit dem Wort ‚Krankheit’. Eine Rose ist nicht gleich der anderen. Das Wort ‚Rose’ allein beschreibt nicht deren Aussehen, Farbe, Blüte, Größe, Form etc.
Auch das Wort ‚Krankheit’ allein gibt keinen Aufschluss über die Definition von ‚Krankheit’, was ‚Krankheit’ ist, ab wann ein Mensch krank, wann er noch als gesund bezeichnet wird, was Zeichen von Krankheit ist, wie ihr begegnet wird, was zu ihrer Bekämpfung getan werden kann, wer zur Heilung zu Rate gezogen wird und wie mit dem Kranken umgegangen wird.
Wird ‚Krankheit’ in einem kulturübergreifenden Zusammenhang gebracht, sind die Inhalte und Konnotationen von ‚Krankheit’ möglicherweise so unterschiedlich, dass Irritationen entstehen können.
Mit diesen Irritationen, bezogen auf die Arzt-Patientenbeziehung, befasst sich folgende Arbeit.
Die Begründung der Irritationen zwischen ausländischem Patienten und deutschem Arzt durch kulturelle Unterschiede allein, wäre eine zu einseitige Beleuchtung der Thematik. Deswegen werden weitere Problemebenen erfasst, wobei nicht migrantenspezifische Themen kurzgefasst sind, jedoch der Vollständigkeit halber angerissen werden, um einen Einblick zu gewähren.
Leitende Fragestellungen dieser Arbeit sind:
Haben Migranten besondere Bedürfnisse, die bei der Behandlung durch den niedergelassenen Arzt beachtet werden sollten? Worin begründen sich diese Bedürfnisse?
Die Arbeit ist so aufgebaut, dass zunächst in den Kapiteln 1 und 2 eine theoretische Basis gelegt wird. Um den Umfang der Arbeit einzugrenzen, ist die Zielgruppe nicht ausländische Patienten allgemein, sondern türkische Patienten. In den Kapiteln 3 und 4 wird die Ziel gruppe eingehend beschrieben und auf das traditionelle türkische Krankheitsverständnis eingegangen. Dieses Vorwissen ist nötig, um dann in den folgenden Kapiteln 5 – 8 mögliche Irritationen eingehend darlegen und erörtern zu können. Aus der Gesamtheit der Arbeit kann dann eine Konklusion und Handlungsmöglichkeiten erschlossen werden (Kapitel 9 und 10). Diese zeigen auf, worin Möglichkeiten liegen können, die medizinische Behandlung von Migranten in der ärztlichen Praxis und somit den gesundheitlichen Status zu verbessern. Erarbeitet wurden diese Konklusion und die Hinführung zu dieser durch Literaturrecherche und –analyse.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- 1. MIGRATION UND KRANKHEIT – THEORETISCHE ASPEKTE
- 1.1 Migration
- 1.2 Migranten
- 1.3 Gesundheit
- 1.4 Krankheit
- 1.4.1 Krankheit und Kultur
- 1.4.2 Krankheit und soziale Lage
- 1.4.3 Bedeutung von Krankheit in der Gesellschaft
- 1.5 Subjektive Krankheitstheorien
- 1.6 Ursachenvorstellungen bezüglich Krankheit
- 2. MIGRATION - EIN PATHOGENER FAKTOR?
- 2.1 Stand der Forschung
- 2.2 Medizin-soziologische Theorien
- 2.2.1 Selektionshypothese
- 2.2.2 Kulturschocktheorie
- 2.2.3 Akkulturationstheorie
- 2.2.4 Weitere medizin-soziologische Theorien
- 2.3 Fazit aus Kapitel 1 und 2
- 3. DIE TÜRKEI
- 3.1 Türkisch-deutsche Migration
- 3.1.1 Phasen der Arbeitsmigration
- 3.2 Soziale Lage türkischer Migranten in Deutschland
- 3.2.1 Bildungssituation
- 3.2.2 Arbeitssituation
- 3.2.3 Sprachsituation
- 3.2.4 Wohnsituation
- 3.2.5 Gesundheitliche Situation
- 3.3 Die drei Generationen
- 3.4 Fazit
- 4. GESUNDHEIT UND KRANKHEIT IN DER TÜRKEI
- 4.1 Formeller und informeller Sektor
- 4.2 Bedeutung von Krankheit
- 4.3 Aspekte traditioneller türkischer Krankheitsvorstellungen
- 4.3.1 ,Nazar' der böse Blick
- 4.3.2 ,Cinler'- böse Geister
- 4.3.3 ,Büyü'- schwarze Magie
- 4.3.4 Heilerpersönlichkeiten
- 4.3.4.1 ,Hoca' der Korankundige
- 4.3.5 Die Bedeutung von Blut
- 4.3.6 Die Bedeutung von Medikamenten
- 4.4 Fazit
- 5. INTERKULTURELLE IRRITATIONEN BEIM ARZT
- 6. DIE SPRACHBARRIERE
- 6.1 Folgen der Sprachbarriere
- 6.2 Folgen für die compliance
- 6.3 Dolmetschen in der ärztlichen Praxis
- 6.4 Fazit
- 7. KULTURELLE MISSVERSTÄNDNISSE
- 7.1 Unterschiedliche Krankheitsverständnisse im Sprechstundengespräch
- 7.1.2 Folgen unterschiedlicher Krankheitsverständnisse
- 7.1.3 Folgen für die compliance
- 7.2 Die Symptompräsentation
- 7.2.1 Irritationen im Bereich Symptompräsentation
- 7.3 Psychische Krankheiten
- 7.4 Kommunikation im Arzt-Patientengespräch
- 7.5 Erwartungen an den Arzt
- 7.5.1 Einverständnis im Missverständnis
- 7.6 Fazit
- 8. IRRITATIONEN AUFGRUND DER SOZIALEN LAGE
- 8.1 Das Arzt-Patientengespräch in Bezug zur sozialen Lage
- 8.2 Fazit
- 9. ERGEBNISSE
- 9.1 Folgen der Problemebenen
- 9.2 Gesamtfazit
- 9.3 Lösungswege
- 10. SPEZIFISCHE VERSORGUNGSANGEBOTE: DAS GESUNDHEITSZENTRUM FÜR MIGRANT/INN/EN IN KÖLN
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit den Herausforderungen der interkulturellen Kommunikation im Arzt-Patienten-Gespräch, insbesondere bei der Behandlung von Migranten mit türkischem Hintergrund. Die Arbeit untersucht die spezifischen Schwierigkeiten, die durch kulturelle und sprachliche Unterschiede zwischen Arzt und Patient entstehen können.
- Die Bedeutung von Migration und Krankheit als komplexe und miteinander verknüpfte Phänomene
- Die Analyse der sozialen Lage türkischer Migranten in Deutschland und ihrer gesundheitlichen Situation
- Die Erforschung traditioneller türkischer Krankheitsvorstellungen und deren Einfluss auf die Arzt-Patienten-Kommunikation
- Die Untersuchung der Sprachbarriere als wesentliche Herausforderung im Arzt-Patienten-Gespräch und deren Folgen für die Behandlung
- Die Analyse kultureller Missverständnisse im Arzt-Patienten-Gespräch und deren Auswirkungen auf die Compliance und das Behandlungsergebnis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der interkulturellen Irritationen beim Arzt ein und skizziert die Forschungsfrage und die Methode der Arbeit. Kapitel 1 beleuchtet die theoretischen Aspekte von Migration und Krankheit, während Kapitel 2 die Folgen von Migration für die Gesundheit untersucht und verschiedene medizin-soziologische Theorien diskutiert. Kapitel 3 konzentriert sich auf die türkisch-deutsche Migration und die soziale Lage türkischer Migranten in Deutschland. Kapitel 4 befasst sich mit dem Gesundheitsverständnis und den traditionellen Krankheitsvorstellungen in der Türkei. Kapitel 5 analysiert die interkulturellen Irritationen, die im Arzt-Patienten-Gespräch auftreten können, mit besonderem Fokus auf die Sprachbarriere und kulturelle Missverständnisse. Kapitel 6 befasst sich mit der sozialen Lage als weitere Quelle von Irritationen. Kapitel 7 präsentiert die Ergebnisse der Forschungsarbeit und diskutiert die Folgen der Problemebenen. Kapitel 8 erläutert verschiedene Lösungswege und stellt das Gesundheitszentrum für Migrant/inn/en in Köln als Beispiel für ein spezifisches Versorgungsangebot vor.
Schlüsselwörter
Migration, Krankheit, Interkulturelle Kommunikation, Arzt-Patienten-Gespräch, Sprachbarriere, Kulturelle Missverständnisse, Soziale Lage, Türkische Migranten, Traditionelle Krankheitsvorstellungen, Compliance, Gesundheitsversorgung, Gesundheitszentrum für Migrant/inn/en.
Häufig gestellte Fragen
Warum kommt es bei türkischen Patienten oft zu Irritationen beim Arzt?
Ursachen sind oft unterschiedliche Krankheitsverständnisse, kulturelle Traditionen und Sprachbarrieren, die die Kommunikation erschweren.
Was sind traditionelle türkische Krankheitsvorstellungen?
Begriffe wie 'Nazar' (der böse Blick), 'Cinler' (böse Geister) oder 'Büyü' (schwarze Magie) spielen in traditionellen Vorstellungen eine Rolle.
Welche Rolle spielt die Sprachbarriere im Arztgespräch?
Sprachbarrieren führen zu Missverständnissen bei der Symptombeschreibung und mindern die Compliance (Therapietreue) des Patienten.
Was ist unter "Einverständnis im Missverständnis" zu verstehen?
Es beschreibt Situationen, in denen Arzt und Patient glauben, sich einig zu sein, obwohl sie aufgrund kultureller Unterschiede völlig verschiedene Erwartungen haben.
Gibt es spezielle Versorgungsangebote für Migranten?
Ja, die Arbeit nennt als Beispiel das Gesundheitszentrum für Migrant/inn/en in Köln, das kultursensible Beratung und Behandlung anbietet.
- Quote paper
- Ilona Heinz (Author), 2004, Interkulturelle Irritationen beim Arzt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/52072