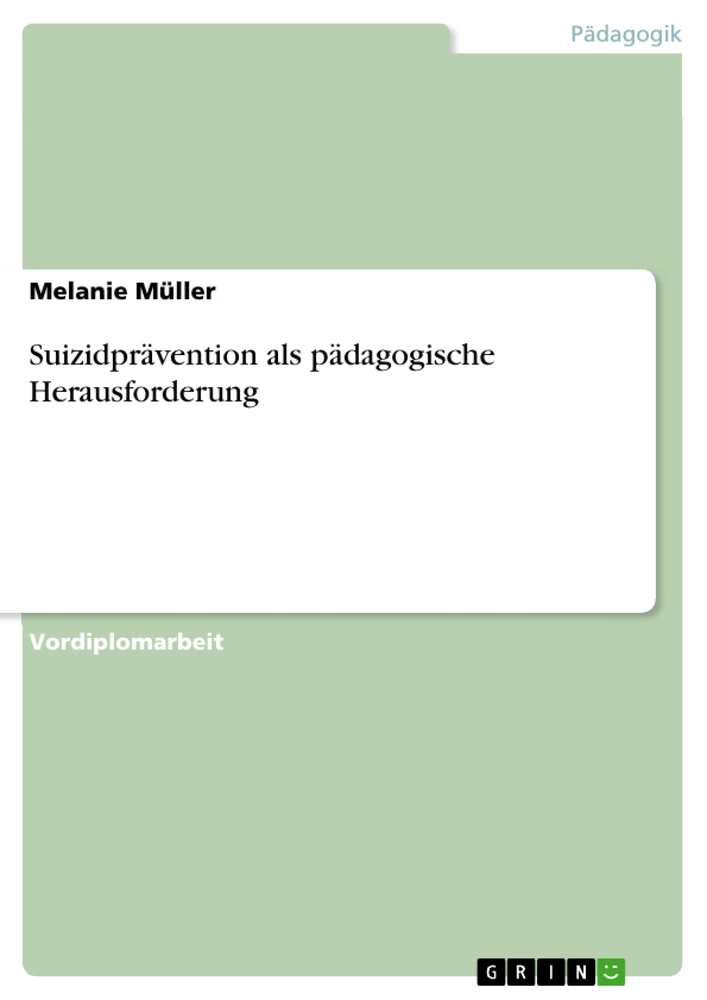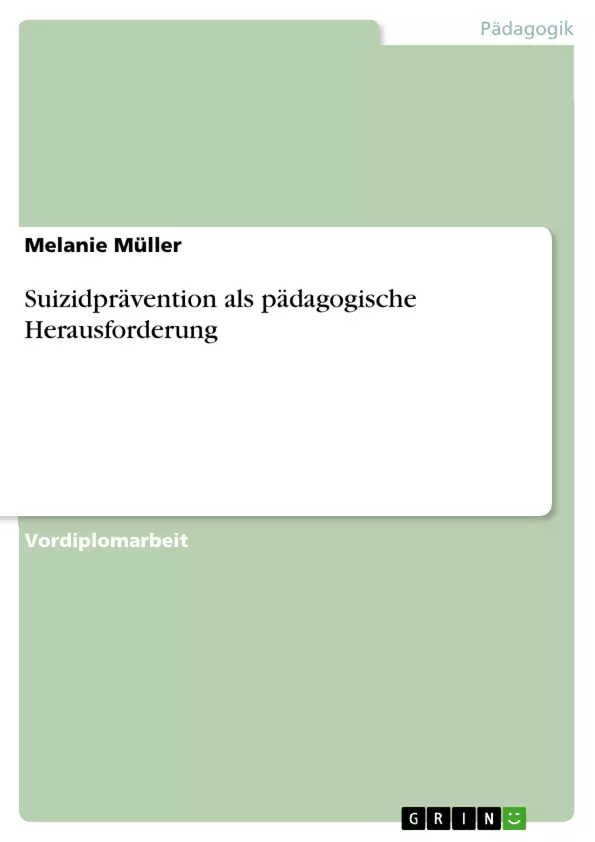Was macht die Suizidprävention zur pädagogischen Herausforderung? Um darauf eine Antwort zu geben, möchte ich zunächst einen Überblick über Zahlen und Fakten (1), sowie Theorien zum Suizid geben und damit eine Vorstellung der Selbsttötung als wissenschaftlicher Forschungsgegenstand vermitteln. Anschließen stelle ich dar, inwiefern das Individuum mit der Gesellschaft (2) verbunden ist, welche Probleme durch diese Verbindung entstehen können und warum der Mensch dabei zur Lösung von Schwierigkeiten, oder an ihrer Statt, sich das Leben nimmt. Gerüstet gegen Herausforderungen im Leben ist der Mensch durch Widerstandsfähigkeiten, die ihm helfen, nicht den Sinn des Lebens (3) aus den Augen zu verlieren. Fehlt der gesellschaftliche Rückhalt, oder scheint er nicht mehr zu bestehen, und kann der Mensch nicht auf ihm Kraft spendende Quellen zurückgreifen, ist er prädisponiert für einen Zusammenbruch. Wirken an solcher Stelle ungewöhnliche Lebensveränderungen oder gar schwerwiegende Ereignisse auf den Menschen ein, können sie eine Krise auslösen. In diesem Zustand erscheint alles schwarz und ohne Hoffnung. Kann sich der Mensch an nichts Lebenswertes mehr klammern, mag der Suizid als Ausweg (4) aus der Verzweiflung angesehen werden. Der Mensch befindet sich in einer akuten Suizidalität. Auf fachliche Kompetenz kann nicht verzichtet werden, wenn der Betroffene eine ihn am Leben erhaltende oder ihn dahin zurückführende Hilfe (5) erhalten soll. Ob der Verzweifelte tatsächlich sterben will, und man ihm nicht doch seinen Willen lassen sollte, ist eine wichtige Überlegung, die der Motivation zu einer eingreifenden und verhindernden Suizidarbeit vorausgeht. Antwort darauf findet sich in der Bedeutung des Suizidversuchs.
Suizidprävention (6) gestaltet sich als ein langer Prozess, der den Menschen ein Leben lang begleitet. Er besteht darin, den Menschen dahingehend zu unterstützen, dass er erst gar nicht auf den Gedanken der Selbsttötung kommt. Doch – und das soll meine Arbeit in Bewusstsein eines jeden rufen – ist es von größter Wichtigkeit, dass unsere Gesellschaft umdenkt und begreift, dass Suizidprävention nicht einzig eine pädagogische oder medizinische Aufgabe ist. So verdeutlichen Schlusswort (7) und die im Anhang (8) stehenden Äußerungen, dass uns alle das Menschensein verbindet, welches uns dazu verpflichtet, füreinander da zu sein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Suizide mitten unter uns
- 1.1 Begriff
- 1.2 Suizid als Phänomen unserer Gesellschaft.
- 1.3 Historisches zum Suizid.
- 1.4 Statistik...
- 1.5 Risikokonstellationen.
- 1.6 Motive
- 1.7 Theorien
- 1.8 Kritik an der Krankheitsthese des Suizids
- 2. Der Suizid ist die Abwesenheit des anderen (Paul Valéry)
- 2.1 Individuum und Gesellschaft
- 2.2 Integration oder Randposition?.
- 2.3 Individualität und Sozialisation.
- 3. Auseinandersetzung mit dem Ich
- 3.1 Das Konstrukt der Resilienz.
- 3.2 Protektive Faktoren
- 3.3 Coping
- 3.4 Entwicklung von Widerstandfähigkeiten in der Kindheit..
- 3.5 Belastungen.
- 3.6 Social Readjustment Rating Scale
- 3.7 Krise
- 3.8 Krisentheorie nach Golan..
- 4. Der Mensch am Ende seiner Kräfte
- 4.1 Ausweg Suizid?.
- 4.2 Akute Suizidalität.
- 4.2.1 Das Präsuizidale Syndrom
- 5. Hilfe
- 5.1 Intervention
- 5.2 Mindestziel der Krisenbehandlung
- 5.3 Will der Lebensmüde tatsächlich sterben?..\n54 Appell und Suizidversuch
- 6. Suizidprävention als pädagogische Herausforderung
- 6.1 Suizidprävention
- 6.2 Vorurteile
- 7. Schlusswort
- 8. Anhang
- 9. Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema Suizidprävention aus pädagogischer Perspektive. Ziel ist es, ein tieferes Verständnis für die Ursachen und die komplexen Zusammenhänge von Suizidalität zu entwickeln und Handlungsmöglichkeiten für die Prävention aufzuzeigen.
- Suizid als gesellschaftliches Phänomen und dessen Ursachen
- Die Rolle von Individuum und Gesellschaft im Kontext von Suizidalität
- Resilienz und Widerstandsfähigkeiten als Schutzfaktoren gegen Suizid
- Akute Suizidalität und das präsuizidale Syndrom
- Suizidprävention als langfristige Aufgabe und die Bedeutung von gesellschaftlichem Umdenken
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Definition des Begriffs „Suizid“ und erläutert die Problematik der gängigen Bezeichnungen „Selbstmord“ und „Freitod“. Kapitel 1 beleuchtet das Phänomen des Suizids in der Gesellschaft und behandelt statistische Daten, Risikofaktoren, Motive und Theorien zur Erklärung von Suizidalität. Kapitel 2 untersucht den Zusammenhang zwischen Individuum und Gesellschaft und geht der Frage nach, welche Faktoren Integration oder Randpositionierung beeinflussen können. Kapitel 3 beschäftigt sich mit dem Konzept der Resilienz, beschreibt die Bedeutung von protektiven Faktoren und Copingmechanismen und analysiert die Entwicklung von Widerstandsfähigkeiten in der Kindheit.
In Kapitel 4 werden die Auswirkungen von Belastungen und Krisen auf die menschliche Psyche untersucht. Dabei wird auch die Bedeutung von akuter Suizidalität und dem präsuizidalen Syndrom dargestellt. Kapitel 5 behandelt verschiedene Formen der Intervention in Krisensituationen und beleuchtet die Bedeutung des Einsatzes von Fachkräften. Schließlich wird in Kapitel 6 Suizidprävention als pädagogische Herausforderung betrachtet und auf die Wichtigkeit von Aufklärung und Vorurteilsabbau hingewiesen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Suizid, Suizidprävention, Resilienz, Coping, Krisenintervention, Gesellschaft, Individuum, Sozialisation, pädagogische Herausforderung und Vorurteile. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung von empirischen Daten, wissenschaftlichen Theorien und interdisziplinären Ansätzen zur Erforschung und Prävention von Suizidalität.
- Quote paper
- Melanie Müller (Author), 2005, Suizidprävention als pädagogische Herausforderung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/52529