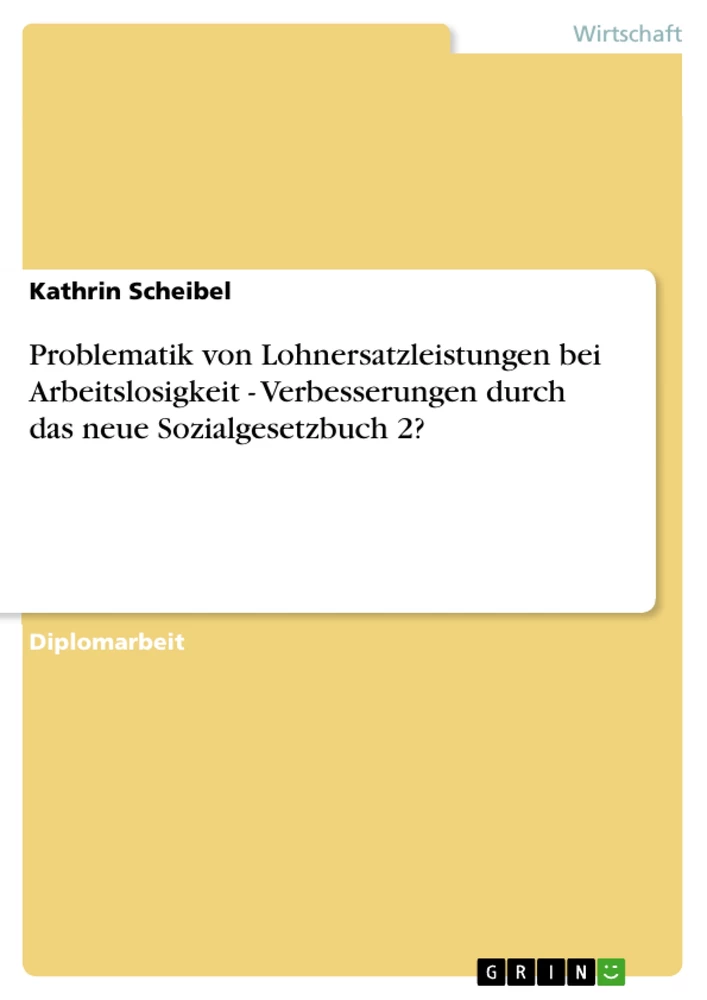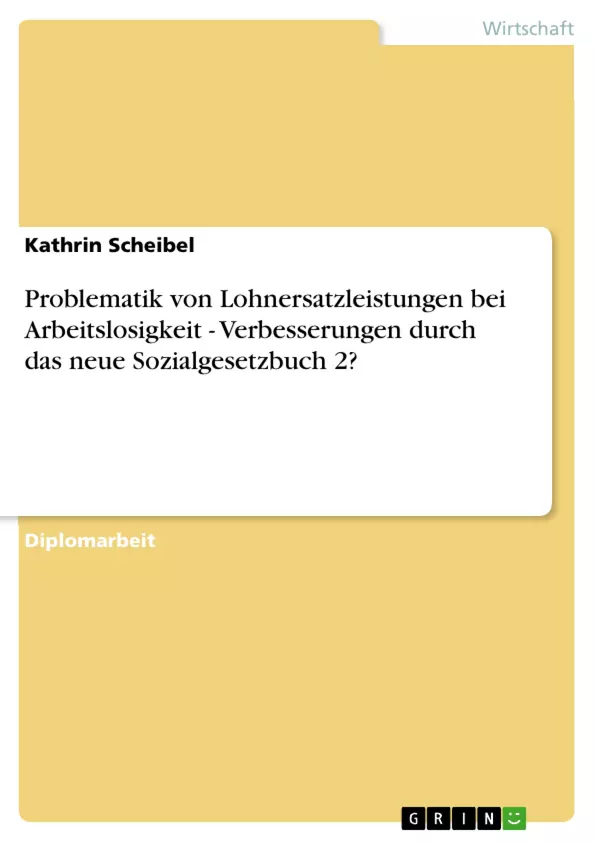Die seit Ende der sechziger Jahre steigende Arbeitslosenquote zeigt, dass Arbeitslosigkeit in Deutschland kein ausschließlich konjunkturelles Phänomen ist.
Durch das System sozialer Sicherung, das Lohnersatzleistungen garantiert, wenn eine Person arbeitslos wird, entstehen große finanzielle Belastungen für die öffentlichen Haushalte. Aus diesem Grund wurde es notwendig über die Ausgestaltung des Systems nachzudenken, vor allem, da anzunehmen ist, dass die Ausgestaltung der Lohnersatzleistungen selbst einen Teil zur Arbeitslosenproblematik beigetragen hat.
Lohnersatzleistungen bei Arbeitslosigkeit sind als temporäre Unterstützung gedacht, bis der Betroffene wieder einer regulären Beschäftigung nachgeht. Hiermit stellen Lohnersatzleistungen eine Art Versicherung gegen Arbeitslosigkeit dar. Das Bestehen solch einer Versicherung zieht Verhaltensänderungen der betroffenen Personen nach sich, beruhend auf dem vermeintlichen Wegfall des Risikos. Dies bedeutet, dass sich versicherte Personen – handele es sich nun um Arbeitslosenversicherung oder eine andere Versicherungsart - in versicherten Situationen nicht so verhalten, wie sie es in der gleichen Lage ohne Versicherung tun würden.
Um diese Problematik abzuschwächen, wurde mit Beginn des Jahres 2005 das bis dahin geltende System zur Grundsicherung erwerbsfähiger Arbeitsloser - bestehend aus Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe - ersetzt durch ein System bestehend aus Arbeitslosengeld I und Arbeitslosengeld II. Nach dem Grundsatz "Fördern und Fordern" soll der Hilfeempfänger bei der Arbeitssuche stärker unterstützt, zugleich zu verstärkten eigenen Bemühungen gezwungen aber auch angeregt werden.
In der vorliegenden Arbeit soll auf Problematiken, die die Zahlung einer Lohnersatzleistung verursacht eingegangen werden. Hierbei liegt das Hauptaugenmerk auf der Arbeitsanreizproblematik mit ihren Auswirkungen. Unter diesem Gesichtspunkt soll analysiert werden, ob durch die Einführung des neuen Sozialgesetzbuchs 2 Verbesserungen mit Wirkung auf die Arbeitsanreize eingetreten sind.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Entscheidung zwischen Arbeit und Freizeit
- 2.1. Entscheidung zwischen Arbeit und Freizeit ohne Lohnersatzleistung
- 2.2. Entscheidung zwischen Arbeit und Freizeit bei bestehender Lohnersatzleistung
- 2.3. Gestaltungsmerkmale einer Lohnersatzleistung und ihre Auswirkungen auf die Arbeitsentscheidung
- 2.3.1. Leistungshöhe
- 2.3.2. Anrechnung von Erwerbseinkommen
- 2.3.3. Bezugsdauer
- 2.3.4. Zumutbarkeitskriterien, Mitwirkungspflichten und Sanktionierung
- 2.4. Auswirkungen schlechter Ausgestaltung einer Lohnersatzleistung
- 2.4.1. Finanzielle Belastung des Sozialsystems
- 2.4.2. Schattenwirtschaft
- 2.4.3. Entwertung des Humankapitals
- 3. Lohnersatzleistungen bis 1.1.2005
- 3.1. Sozialhilfe
- 3.1.1. Leistungshöhe
- 3.1.2. Anrechnung von Erwerbseinkommen
- 3.1.3. Anrechnung von Vermögen und Partnereinkommen
- 3.2. Arbeitslosenhilfe
- 3.2.1. Leistungshöhe
- 3.2.2. Anrechnung von Erwerbseinkommen
- 3.2.3. Anrechnung von Vermögen und Partnereinkommen
- 3.3. Arbeitslosengeld
- 3.3.1. Leistungshöhe
- 3.3.2. Anrechnung von Erwerbseinkommen
- 3.3.3. Anrechnung von Vermögen und Partnereinkommen
- 4. Lohnersatzleistungen ab dem 1.1.2005 - Arbeitslosengeld II
- 4.1. Zuordnung der Personen zu den Lohnersatzleistungen
- 4.2. Leistungshöhe
- 4.2.1. Regelsätze
- 4.2.2. Lohnabstand
- 4.2.3. Einmalleistungen
- 4.3. Anrechnung von Erwerbseinkommen
- 4.3.1. Regelungen vom 1.1.2005 bis 1.10.2005
- 4.3.2. Regelungen ab dem 1.10.2005
- 4.3.3. Vergleich der Arbeitslosengeld II-Regelungen mit denen der Sozial- und Arbeitslosenhilfe
- 4.4. Anrechnung von Vermögen und Partnereinkommen
- 4.5. Fördern und Fordern
- 4.5.1. Mitwirkungspflichten
- 4.5.2. Zumutbarkeit
- 4.5.3. Qualifizierungsmaßnahmen
- 4.5.4. Beschäftigungsmaßnahmen
- 4.5.5. Sonderregelungen für Arbeitslose bis 25 Jahre
- 4.5.6. Sanktionierung
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Problematik von Lohnersatzleistungen bei Arbeitslosigkeit in Deutschland und analysiert die Verbesserungen, die das neue Sozialgesetzbuch II (SGB II) gebracht hat. Die Arbeit befasst sich mit den Auswirkungen verschiedener Gestaltungsmerkmale von Lohnersatzleistungen auf die Arbeitsentscheidung und die finanziellen Belastungen des Sozialsystems.
- Auswirkungen von Lohnersatzleistungen auf die Arbeitsmarktteilnahme
- Vergleich verschiedener Lohnersatzleistungen (Sozialhilfe, Arbeitslosenhilfe, Arbeitslosengeld)
- Analyse der Gestaltungsmerkmale des Arbeitslosengeldes II
- Bewertung des Konzepts "Fördern und Fordern" im SGB II
- Finanziellen Auswirkungen der verschiedenen Systeme auf das Sozialsystem
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Lohnersatzleistungen bei Arbeitslosigkeit ein und skizziert den Aufbau und die Zielsetzung der Arbeit. Es unterstreicht die Bedeutung einer effizienten Gestaltung von Lohnersatzleistungen für die Arbeitsmarktintegration und die finanzielle Stabilität des Sozialsystems.
2. Entscheidung zwischen Arbeit und Freizeit: Dieses Kapitel analysiert das ökonomische Modell der Arbeitsentscheidung, sowohl ohne als auch mit Lohnersatzleistungen. Es untersucht den Einfluss verschiedener Faktoren wie Leistungshöhe, Anrechnung von Erwerbseinkommen, Bezugsdauer und Zumutbarkeitskriterien auf die Entscheidung zwischen Arbeit und Freizeit. Die Kapitel 2.3 und 2.4 bieten eine detaillierte Betrachtung der Gestaltungsmerkmale von Lohnersatzleistungen und ihren Auswirkungen auf die Arbeitsmarktteilnahme und die Belastung des Sozialsystems. Der Fokus liegt auf der Interaktion zwischen individueller Nutzenmaximierung und gesamtwirtschaftlichen Effekten.
3. Lohnersatzleistungen bis 1.1.2005: Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Lohnersatzleistungen, die vor der Einführung des SGB II existierten: Sozialhilfe, Arbeitslosenhilfe und Arbeitslosengeld. Es analysiert deren jeweilige Leistungshöhen, Anrechnungsregelungen für Erwerbseinkommen, Vermögen und Partnereinkommen und vergleicht diese Systeme hinsichtlich ihrer Effizienz und ihrer Auswirkungen auf die Arbeitsmarktintegration. Der Vergleich hebt sowohl Vor- als auch Nachteile der einzelnen Systeme hervor, und bereitet den Weg zum Verständnis der Neuerungen durch das SGB II.
4. Lohnersatzleistungen ab dem 1.1.2005 - Arbeitslosengeld II: Das Herzstück der Arbeit, dieses Kapitel konzentriert sich auf das Arbeitslosengeld II (ALG II), das neue zentrale System der Lohnersatzleistung. Es erläutert die Zuordnung von Personen zu den Leistungen, die Berechnung der Leistungshöhe (inklusive Regelsätze, Lohnabstand und Einmalleistungen), die Anrechnung von Erwerbseinkommen und Vermögen sowie die zentralen Aspekte des Konzepts "Fördern und Fordern", das Mitwirkungspflichten, Zumutbarkeitskriterien, Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen sowie Sanktionierungen umfasst. Ein detaillierter Vergleich mit den Vorgängersystemen (Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe) verdeutlicht die Änderungen und ihre möglichen Folgen.
Schlüsselwörter
Lohnersatzleistungen, Arbeitslosigkeit, Sozialgesetzbuch II (SGB II), Arbeitslosengeld II (ALG II), Sozialhilfe, Arbeitslosenhilfe, Arbeitslosengeld, Arbeitsmarktintegration, Fördern und Fordern, Mitwirkungspflichten, Zumutbarkeit, Anrechnung von Erwerbseinkommen, Leistungshöhe, Bezugsdauer, Schattenwirtschaft, Humankapital, ökonomische Modell, Sozialsystem.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Lohnersatzleistungen in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Problematik von Lohnersatzleistungen bei Arbeitslosigkeit in Deutschland, insbesondere die Auswirkungen verschiedener Gestaltungsmerkmale auf die Arbeitsentscheidung und die Belastung des Sozialsystems. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Vergleich der Systeme vor und nach Einführung des Sozialgesetzbuches II (SGB II).
Welche Lohnersatzleistungen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Sozialhilfe, Arbeitslosenhilfe, Arbeitslosengeld (vor 2005) und das Arbeitslosengeld II (ALG II) als zentrale Lohnersatzleistung nach Einführung des SGB II. Der Fokus liegt auf einem detaillierten Vergleich der einzelnen Systeme.
Wie ist die Diplomarbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, die ökonomische Analyse der Arbeitsentscheidung mit und ohne Lohnersatzleistung, eine Beschreibung der Lohnersatzleistungen vor 2005, eine detaillierte Analyse des ALG II und abschließend ein Fazit. Jedes Kapitel wird durch eine Zusammenfassung erläutert.
Welche Aspekte der Arbeitsentscheidung werden untersucht?
Die Arbeit analysiert, wie die Gestaltungsmerkmale von Lohnersatzleistungen (Leistungshöhe, Anrechnung von Einkommen, Bezugsdauer, Zumutbarkeitskriterien etc.) die Entscheidung zwischen Arbeit und Freizeit beeinflussen. Es wird ein ökonomisches Modell zur Erklärung dieser Zusammenhänge verwendet.
Was sind die zentralen Gestaltungsmerkmale von Lohnersatzleistungen laut der Arbeit?
Zentrale Gestaltungsmerkmale sind die Leistungshöhe, die Anrechnung von Erwerbseinkommen, Vermögen und Partnereinkommen, die Bezugsdauer sowie die Zumutbarkeitskriterien und Mitwirkungspflichten, inklusive der Sanktionierung bei Nichterfüllung.
Wie wird das Konzept "Fördern und Fordern" im SGB II analysiert?
Die Arbeit analysiert das Konzept "Fördern und Fordern" im Kontext des ALG II, indem sie die Mitwirkungspflichten, Zumutbarkeitskriterien, Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen sowie die Sanktionen untersucht.
Welche Auswirkungen haben die verschiedenen Lohnersatzleistungssysteme auf das Sozialsystem?
Die Arbeit untersucht die finanziellen Auswirkungen der verschiedenen Systeme auf das Sozialsystem, inklusive der Risiken einer ineffizienten Gestaltung, wie z.B. die Belastung des Sozialsystems, Schattenwirtschaft und die Entwertung des Humankapitals.
Wie werden die Lohnersatzleistungen vor und nach 2005 verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Lohnersatzleistungen vor (Sozialhilfe, Arbeitslosenhilfe, Arbeitslosengeld) und nach der Einführung des SGB II (ALG II) im Hinblick auf ihre Leistungshöhen, Anrechnungsregelungen und Auswirkungen auf die Arbeitsmarktintegration. Die Unterschiede und ihre Folgen werden detailliert beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Lohnersatzleistungen, Arbeitslosigkeit, Sozialgesetzbuch II (SGB II), Arbeitslosengeld II (ALG II), Sozialhilfe, Arbeitslosenhilfe, Arbeitslosengeld, Arbeitsmarktintegration, Fördern und Fordern, Mitwirkungspflichten, Zumutbarkeit, Anrechnung von Erwerbseinkommen, Leistungshöhe, Bezugsdauer, Schattenwirtschaft, Humankapital, ökonomisches Modell, Sozialsystem.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich mit den Themen Arbeitslosigkeit, Sozialpolitik und dem deutschen Sozialsystem beschäftigen, insbesondere Wissenschaftler, Studenten und Politikinteressierte.
- Citar trabajo
- Kathrin Scheibel (Autor), 2006, Problematik von Lohnersatzleistungen bei Arbeitslosigkeit - Verbesserungen durch das neue Sozialgesetzbuch 2?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/52730