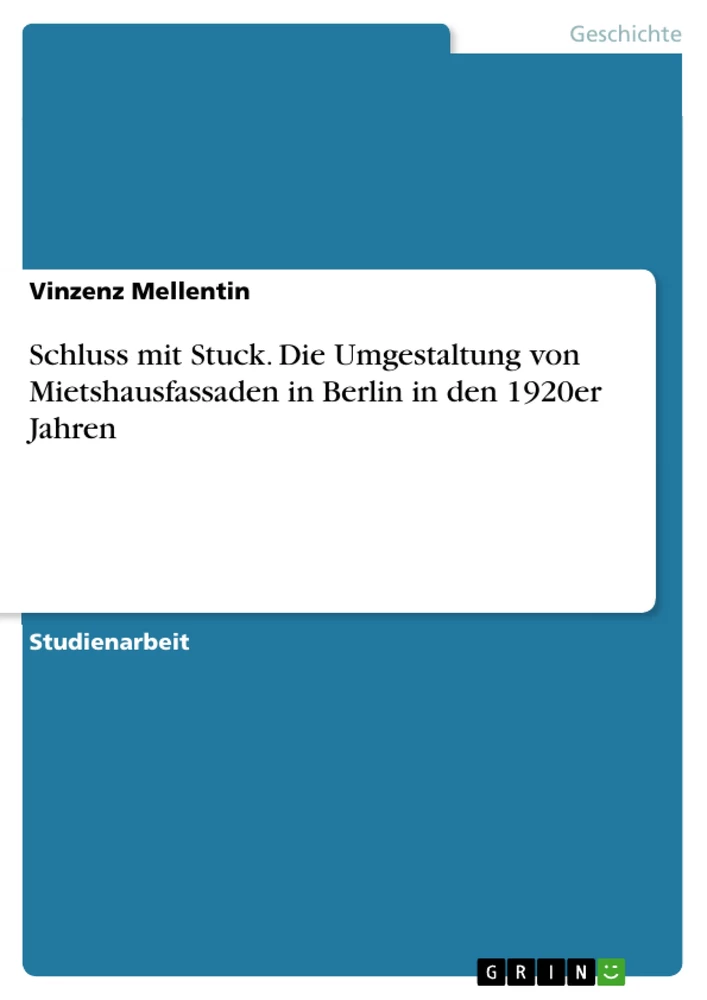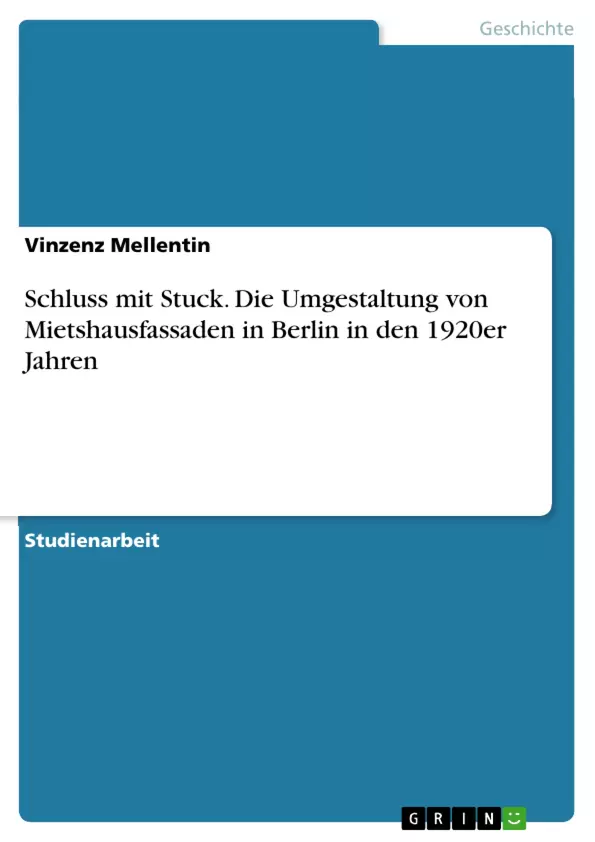Wieso war der Stuck bei den Architekten der Moderne derart geächtet, dass sie bereits in den 20er Jahren hundertfach überformt wurde? Da der Stuck der Gründerzeitwohnung in den Jahrzenten nach dem Krieg tausendfach von den Gebäuden abgeschlagen oder nach jahrelangem Verfall in Renovierungen nicht rekonstruiert wurde, weisen heute mehr als die Hälfte der noch erhaltenen Gründerzeithäuser Berlins eine modernisierte beziehungsweise entstuckte Fassade auf. Wurde der bereits entkleidete Altbau in weiteren Renovierungsarbeiten dann auch noch seiner markanten Kastenfenster entledigt, wird er häufig schon gar nicht mehr als Gründerzeitbau erkannt.
Über die Vor- und Nachteile der Berliner Altbauwohnung darf freilich zurecht gestritten werden, denn trotz steigender Beliebtheit der Gründerzeitviertel, teurer bleibt nach wie vor der Neubau. Die Schönheit der teils straßenweise wieder renovierten Stuckfassaden, so scheint es, steht heute allerdings nicht mehr zu Disposition. Wer eine Boutique eröffnet, sucht nach Stuckaltbauten, der Tourist macht fleißig Bilder. Auch bei der Wohnungssuche macht sich bereits eine neue Stuckeuphorie bemerkbar, wenn Makler/innen das Vorhandensein von Stuckfassaden als offensichtliches Verkaufsargument betrachten und solche Wohnungen als hochherrschaftliche Stuckaltbauten bewerben.
Ironischerweise bedient man sich dabei einer Kausalisierung von herrschaftlich beziehungsweise wertig und eben Stuck, die es den Architekten der Moderne bereits hundert Jahre zuvor zu überwinden galt. Der Schwindel ein hochherrschaftlicher Palast zu sein, hinter dessen trügerischer Gipsfassade sich letztlich doch nur einfache Hinterhauswohnungen verbargen. Sicher entsprachen diese falschen Kleider also nicht dem Ideal des neues Bauens, gerade aus heutiger Sicht bleibt dennoch mehr als verwunderlich.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historische Einordnung
- Die gründerzeitliche Bebauung Berlins
- Quantitative Bewertung der Fassadenumbauten der 1920er Jahre
- Gründe für die Umgestaltungen der Mietshausfassaden
- Pragmatismus: Ausstrahlung einer temporären und flexiblen Architektur
- "Die falsche Architektur" der Gründerzeit
- Kritik am Ornament
- Neue Werbeflächen, Schauseiten der Geschäfte als Werbung
- Kostenfaktor bei Renovierungen (Kurzlebigkeit der Stuckfassaden)
- Gegenstimmen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Umgestaltung Berliner Mietshausfassaden in den 1920er Jahren. Ziel ist es, die Motive hinter diesen Umbauten zu analysieren und die Hintergründe der damaligen Architekturentwicklung aufzuzeigen.
- Die historische Einordnung der gründerzeitlichen Bebauung Berlins
- Die Gründe für die Umgestaltung der Fassaden, insbesondere der pragmatische Aspekt, die Kritik am Ornament und die neuen Werbeflächen
- Die quantitative Bewertung der Fassadenumbauten der 1920er Jahre
- Die Herausforderungen der Moderne in der "fertigen Stadt" Berlin
- Die Bedeutung des sozioökonomischen Kontextes der Zwischenkriegszeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und beleuchtet die aktuelle Rezeption von Berliner Gründerzeithäusern im Kontext der Stuckfassaden. Kapitel 2 ordnet die Thematik historisch ein, indem es die gründerzeitliche Bebauung Berlins und deren kritische Bewertung durch die Moderne beleuchtet. Dabei wird die quantitative Entwicklung der Fassadenumbauten in den 1920er Jahren dargestellt. Im Kapitel 3 werden die Gründe für die Umgestaltungen der Mietshausfassaden untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Gründerzeitarchitektur, Berliner Mietshausfassaden, Fassadenumbauten, Moderne Architektur, Pragmatismus, Ornamentkritik, Werbeflächen, sozioökonomischer Kontext der Zwischenkriegszeit, Stadtentwicklung, Berliner Geschichte.
Häufig gestellte Fragen
Warum wurde der Stuck an Berliner Mietshäusern in den 1920ern entfernt?
Architekten der Moderne lehnten den Stuck als „falsche Architektur“ ab, die einfache Hinterhauswohnungen hinter prunkvollen Gipsfassaden verbarg.
Welche pragmatischen Gründe sprachen für die Entstuckung?
Stuckfassaden waren kurzlebig und teuer in der Renovierung. Zudem boten glatte Fassaden Platz für moderne Werbeflächen und Schaufenstergestaltungen.
Wie werden entstuckte Altbauten heute wahrgenommen?
Oft werden sie gar nicht mehr als Gründerzeitbauten erkannt, besonders wenn auch die markanten Kastenfenster durch moderne Fenster ersetzt wurden.
Was bedeutet die heutige „Stuckeuphorie“?
Heute gilt Stuck als wertvolles Verkaufsargument für „hochherrschaftliche“ Wohnungen, was ironischerweise genau die Koppelung von Wertigkeit und Ornament bedient, die die Moderne überwinden wollte.
Wie viele Berliner Häuser sind heute noch entstuckt?
Nach Schätzungen der Arbeit weisen heute mehr als die Hälfte der erhaltenen Gründerzeithäuser Berlins eine modernisierte bzw. entstuckte Fassade auf.
- Quote paper
- Vinzenz Mellentin (Author), 2017, Schluss mit Stuck. Die Umgestaltung von Mietshausfassaden in Berlin in den 1920er Jahren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/535308