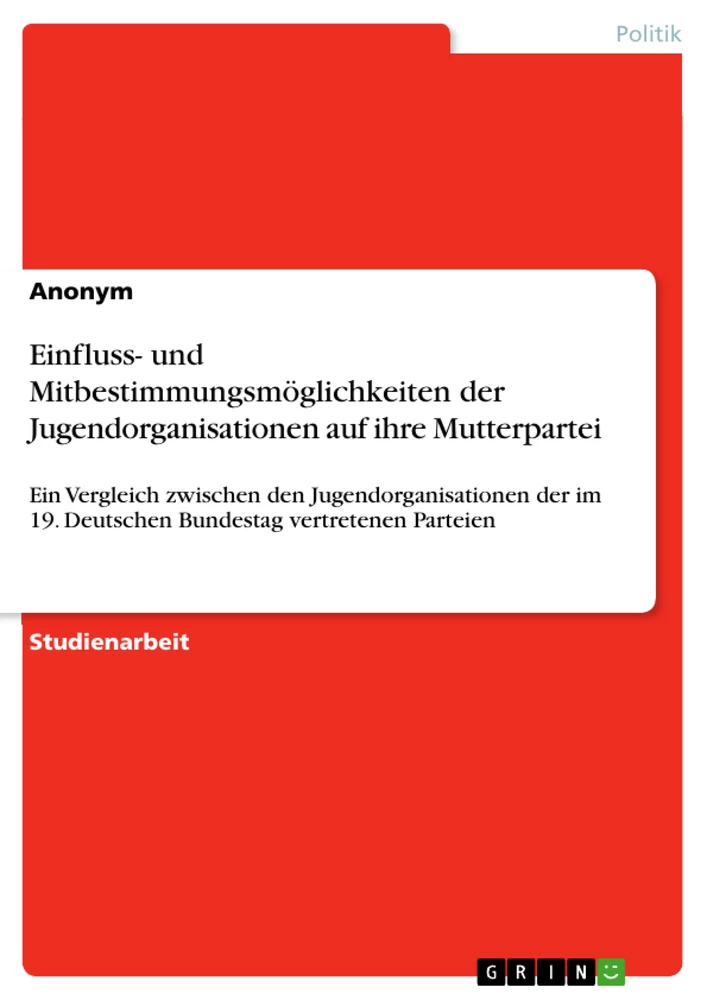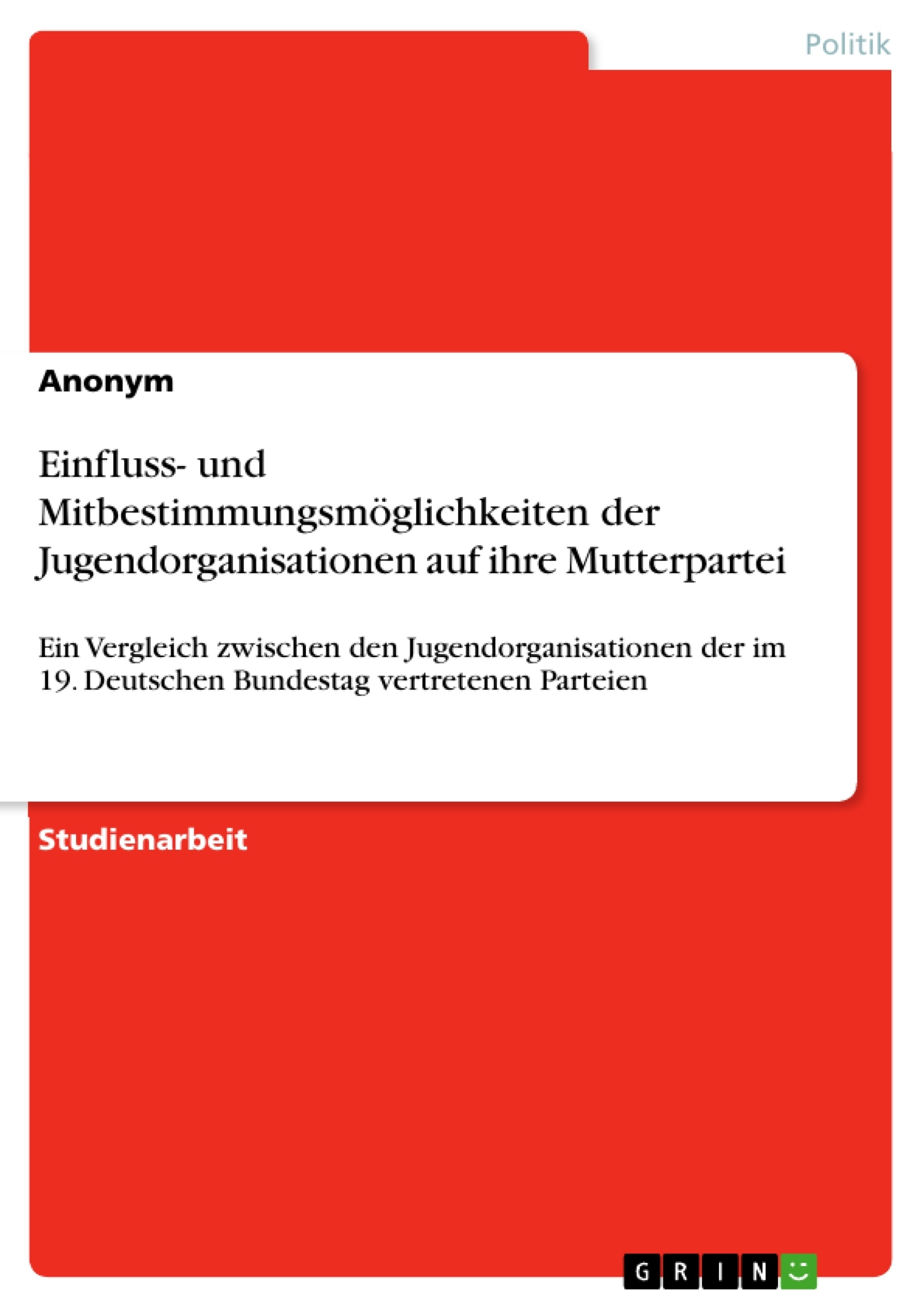Jugendorganisationen von Parteien sind in letzter Zeit wieder stärker in den öffentlichen Fokus geraten. Doch welche Möglichkeiten haben die Jugendorganisationen außerhalb des Umwegs über die Mitglieder, Einfluss auf ihre Mutterpartei zu nehmen? Die vorliegende Arbeit beschreibt zunächst den aktuellen Forschungsstand und ordnet Jugendorganisationen dementsprechend theoretisch ein. Ferner wird deren innerparteilicher Einfluss und die damit verbundene Wirkungsmacht der verschiedenen Jugendorganisationen der Parteien untersucht und untereinander verglichen. Das Thema dieser Arbeit erscheint in einer Zeit in der die Jugend wieder vermehrt die politische Agenda bestimmt, höchst relevant. Dabei spielen Jugendliche und junge Erwachsene als zukünftige führende Generation für die Stabilität des demokratischen Systems eine wichtige Rolle.
Da sich die Parteien in Deutschland in ihrer Geschichte und Entwicklung sehr stark voneinander unterscheiden und von verschiedenen Parteitypen her entstanden sind, ist auch davon auszugehen, dass sich die Einbindung ihrer Jugendorganisationen unterscheidet. Aus diesem Grund sollen hier die Einflussmöglichkeiten aller Jugendorganisationen der im 19. Deutschen Bundestag vertretenen Parteien miteinander verglichen werden. Für eine genaue Bestimmung des tatsächlichen Einflusspotentials wären dabei Daten über die aktive Parteipartizipation erforderlich, das ist jedoch im Rahmen dieser Arbeit nicht zu leisten.
Aus diesem Grund konzentriert sich die Arbeit auf die sogenannte „official story“, und wird die in den Parteisatzungen statuierten Einflussmöglichkeiten über die Organe der Mutterparteien untersuchen. Es soll also im Folgenden der Frage nachgegangen werden, wie sich insbesondere die formalen Einflussmöglichkeiten der Jugendorganisationen auf ihre im Deutschen Bundestag vertretene Mutterpartei unterscheiden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Verortung und Aufgaben der Jugendorganisationen in der Parteiorganisation
- Verortung im Konzept der „Three Faces Of Party Organization“ sowie Konzept der Ebenen der Parteiorganisation
- Das Linkage Konzept
- Arten von Linkage
- Umweltbeziehungen der Partei
- Jugendorganisationen – Kollateralorganisationen ihrer Partei
- Vergleich der Einflussmöglichkeiten der Jugendorganisationen
- Operationalisierung
- Untersuchungskriterien und -variablen
- Berechnung des Einfluss-Index
- Besonderheiten/Ausnahmefälle
- Bei der Benennung
- Bei der Codierung
- Vergleich (und Interpretation)
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert den Einfluss und die Mitbestimmungsmöglichkeiten von Jugendorganisationen auf ihre Mutterparteien. Im Mittelpunkt steht ein Vergleich der Jugendorganisationen aller im 19. Deutschen Bundestag vertretenen Parteien. Das Ziel der Arbeit ist es, die verschiedenen Einflussmöglichkeiten der Jugendorganisationen aufzuzeigen und zu analysieren, inwieweit diese in der Praxis genutzt werden. Die Arbeit konzentriert sich insbesondere auf die Rolle der Jugendorganisationen im Konzept der „Three Faces Of Party Organization“, das Linkage Konzept sowie die jeweiligen Einbindungsmöglichkeiten der Jugendorganisationen in die Parteistruktur.
- Verortung von Jugendorganisationen im Konzept der „Three Faces Of Party Organization“
- Analyse des Linkage Konzepts im Kontext von Jugendorganisationen
- Vergleich der Einflussmöglichkeiten von Jugendorganisationen auf ihre Mutterparteien
- Analyse der Besonderheiten und Ausnahmefälle bei der Einbindung von Jugendorganisationen
- Bewertung des Einflusses von Jugendorganisationen auf die politische Agenda ihrer Mutterparteien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und erläutert die Relevanz der Untersuchung von Jugendorganisationen im Kontext der politischen Partizipation. Das zweite Kapitel beleuchtet die Verortung und Aufgaben von Jugendorganisationen in der Parteiorganisation. Es wird dabei auf das Konzept der „Three Faces Of Party Organization“ eingegangen sowie auf das Linkage Konzept, welches die Verbindungen zwischen Partei und Gesellschaft beschreibt. Das dritte Kapitel befasst sich mit dem Vergleich der Einflussmöglichkeiten der Jugendorganisationen auf ihre Mutterparteien. Es werden Kriterien und Variablen für die Messung des Einflusses definiert und ein Einfluss-Index berechnet. Abschließend werden Besonderheiten und Ausnahmefälle bei der Einbindung von Jugendorganisationen in die Parteistruktur beleuchtet.
Schlüsselwörter
Jugendorganisationen, Parteien, politische Partizipation, Parteiorganisation, „Three Faces Of Party Organization“, Linkage Konzept, Einfluss, Mitbestimmung, Vergleich, Einfluss-Index, Besonderheiten, Ausnahmefälle
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2018, Einfluss- und Mitbestimmungsmöglichkeiten der Jugendorganisationen auf ihre Mutterpartei, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/535692