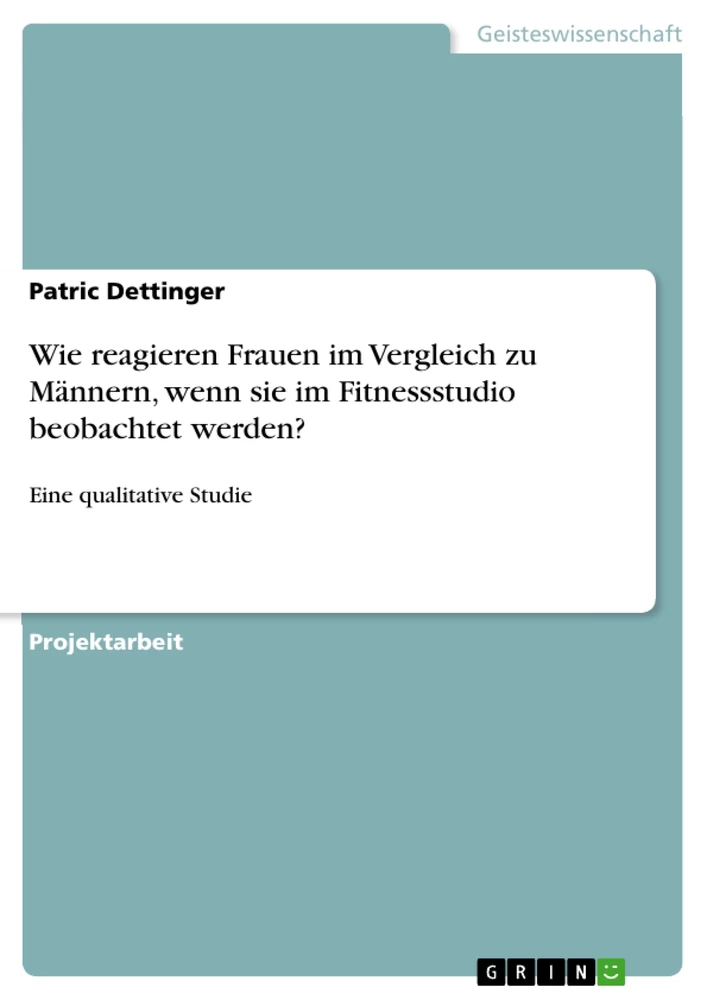In der Forschungsarbeit wird versucht, den Gemeinsamkeiten und Unterschieden im emotionalen Empfinden zwischen Männern und Frauen beim Sporttreiben auf den Grund zu gehen. Insbesondere soll dabei der Faktor eines Beobachters während der Trainingseinheit berücksichtigt werden. Mit Hilfe einer qualitativen Datenerhebung soll untersucht werden, welche Gedanken und Emotionen ein auslösender Situationsreiz während des Trainings bei den befragten Fitnessmitgliedern verursacht.
Als Beispiel für einen auslösenden Situationsreiz wird in dieser Arbeit das Beobachtenwerden durch eine andere Person betrachtet. Durch das theoretische Konzept des Lazarus-Appraisal-Modells wird Einsicht über die Bewältigungsmethoden der Befragten gewährt und es lässt sich auf die jeweilige Emotion schließen. Der Fitnessboom ist schon lange kein Geheimnis mehr. Immer mehr Menschen scheinen sich für das Training im Fitnessstudio zu interessieren, denn sowohl die Zahl der Fitnessstudios als auch die Anzahl ihrer Mitglieder steigen seit Jahren. Insbesondere in den letzten Jahren durchläuft der Markt der privaten Sportanbieter eine dynamische Entwicklung. Aktuelle Statistiken, die den deutschlandweiten Hype rund um das Thema Fitness belegen, zeigen einen stetigen Aufwärtstrend.
Ende 2014 waren es noch rund 9 Mio. Mitglieder in Fitnessstudios während Ende 2016 bereits erstmals die 10 Mio. Mitglieder Marke überschritten wurde (DSSV – Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheits- Anlagen, 2017). Anfang 2018 wurden sogar 10,61 Mio. Mitglieder gemessen, Trend steigend. Ähnlich verhält sich die Entwicklung der Fitnessanlagen. Im Jahr 2014 wurden ca. 8000 Anlagen gemessen während es Ende 2017 schon knapp 9000 waren (DSSV – Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheits-Anlagen, 2018). Motive und Beweggründe für das Training sind laut aktuellem Forschungsstand Spaß, Gesundheit, Fitness, Ausgleich, Wohlbefinden und gutes Aussehen. Ideale wie Schlankheit, Sportlichkeit, Jugendlichkeit und Beweglichkeit sind die Ziele der Kraftsportler und Kraftsportlerinnen.
Inhaltsverzeichnis:
Tabellenverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung
1.1. Fragestellung der Arbeit
1.2. Zielsetzung der Arbeit
2. Theoretischer Hintergrund
2.1. Das Lazarus-Appraisal-Modell
2.2. Die Attributionstheorie
3. Durchführung der qualitativen Forschung
3.1. Forschungsfrage und Design
3.2. Konstruktion des Interviewleitfadens
3.3. Auswahl der Stichprobe
3.4. Wörtliche Transkription
3.5. Analyse des Textmaterials
3.6. Darstellung der Ergebnisse
4. Diskussion
4.1. Interpretation der Ergebnisse
4.2. Reflexion der Methodik
4.3. Gütekriterien
5. Fazit & Ausblick
6. Literaturverzeichnis
7. Anhang
-
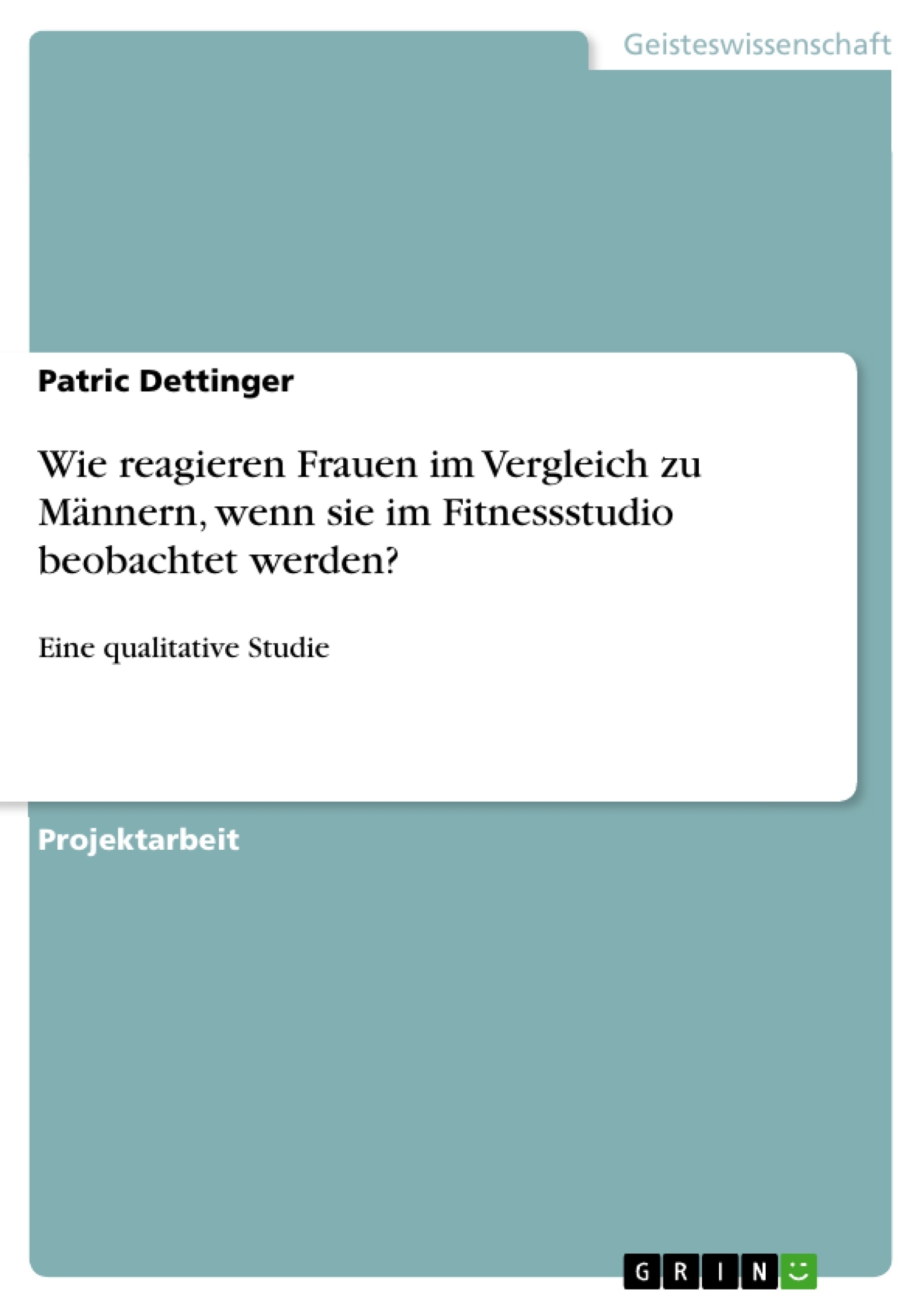
-

-

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen.