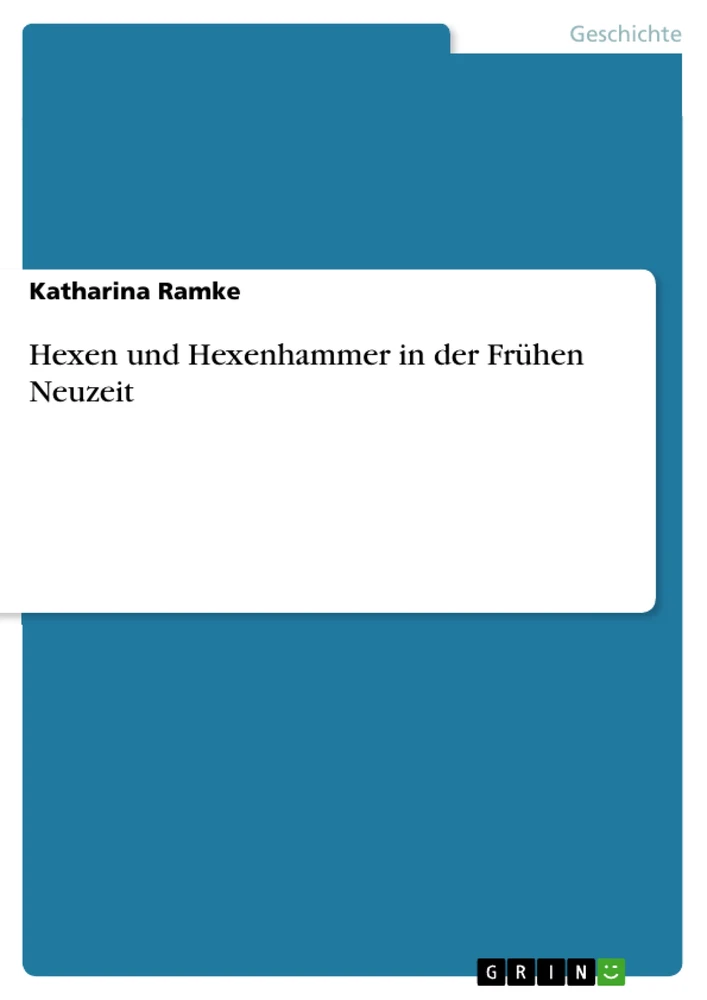"Hexerei" – ein Begriff der heutzutage eher Erinnerungen an Bibi Blocksberg oder Harry Potter weckt und somit oftmals höchstens mit der Film- und Fernsehindustrie verbunden wird. Dort reiten Hexen auf Besen, sagen Zaubersprüche auf, treffen sich zu Hexentänzen und können sogar ihre Zauberkräfte nutzen, um Schaden anzurichten. Auch wenn sich diese Beschreibung nach einem neuen Hollywood-Blockbuster anhört, so waren es im ausgehenden Mittelalter und in der frühen Neuzeit tatsächliche Vorstellungen, mit denen sich die Kirche, der Staat und die Bevölkerung beschäftigten.
Das Thema "Hexerei" ist allerdings kein spätmittelalterliches oder frühneuzeitliches Phänomen, dahinter steckt ein altertümlicher Glaube. Bereits in den Hochkulturen der Antike vertritt man die Überzeugung, dass es Dämonen und Magie gibt. Schon damals wurden mutmaßliche Hexer oder Hexen für ihre Vergehen mit dem Tode bestraft. In dieser Arbeit soll es jedoch um die Hexerei in der frühen Neuzeit gehen, denn der Unterschied zur Antike besteht darin, dass die Verurteilten zwar auch hingerichtet, aber nicht systematisch verfolgt wurden.
Inhalt
1. Der steinige Weg der Hexerei
2. Der ,,Hexenhammer‘‘ trifft den Nerv der Zeit
3. Quellenauszug ,,Hexenhammer‘‘
4. Fazit
5. Quellenverzeichnis
6. Anhang
-
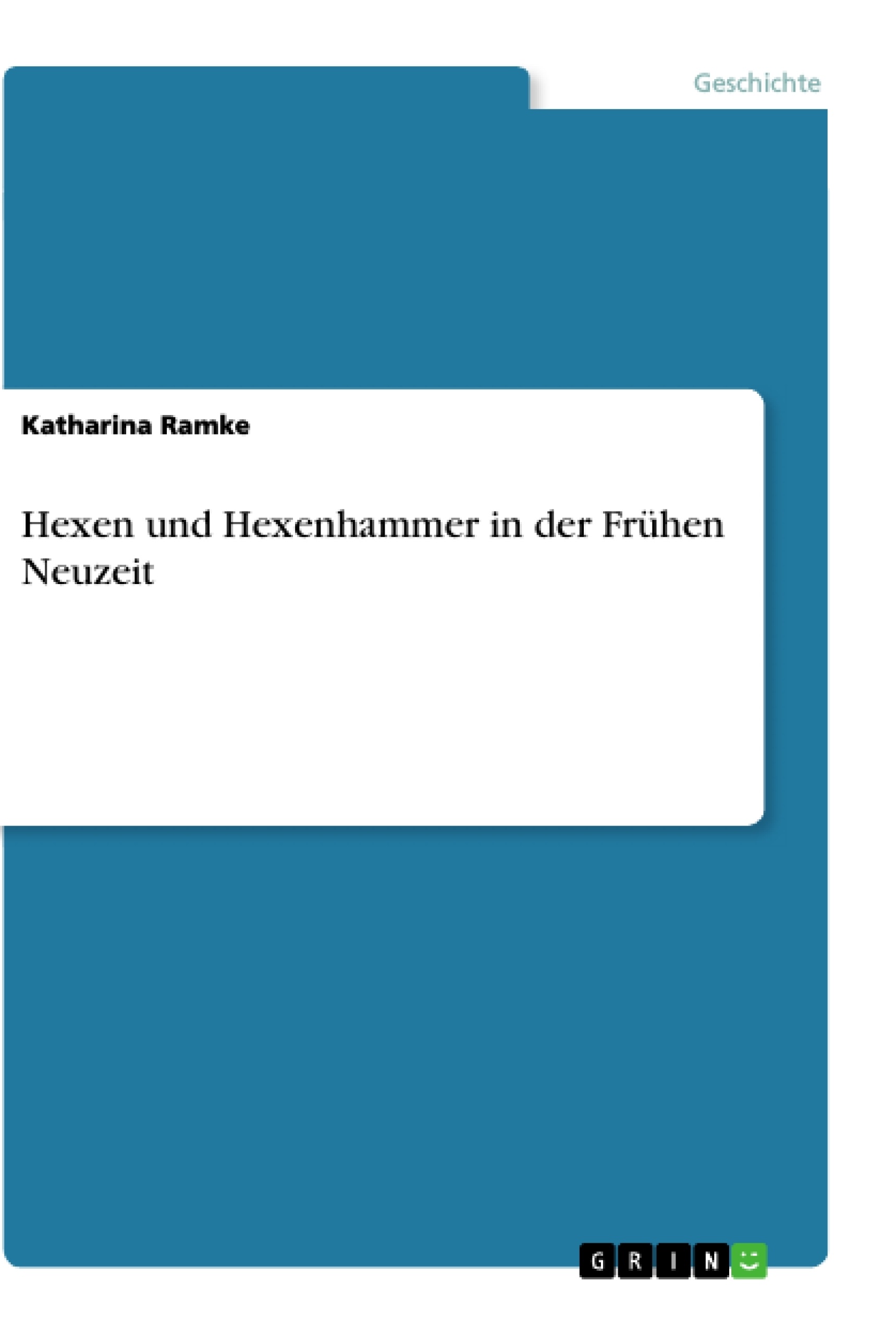
-

-

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen.