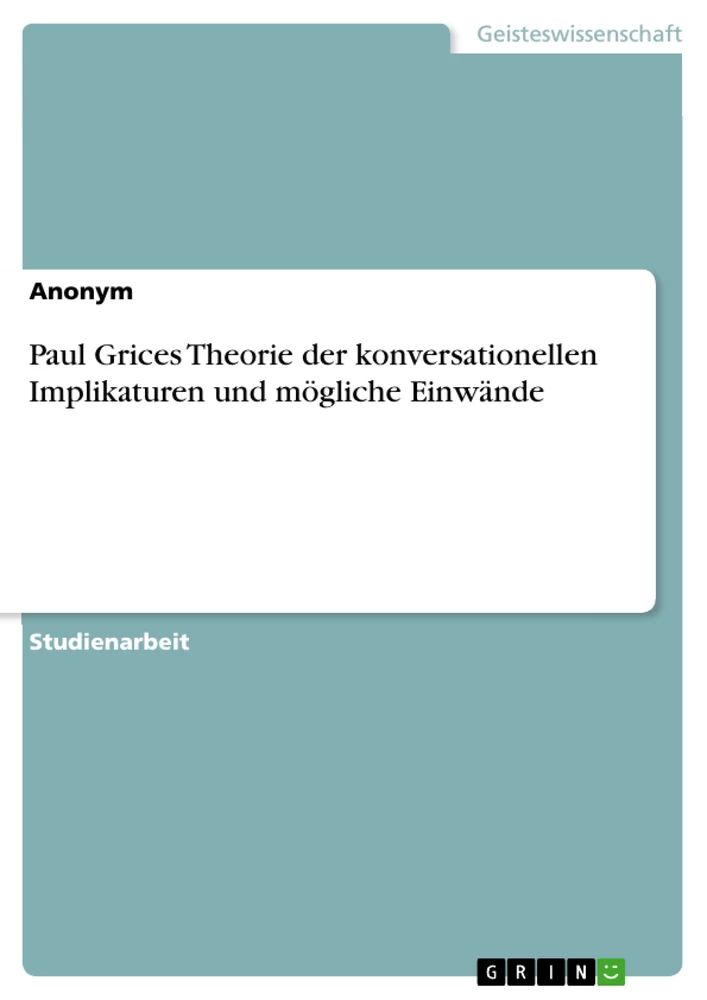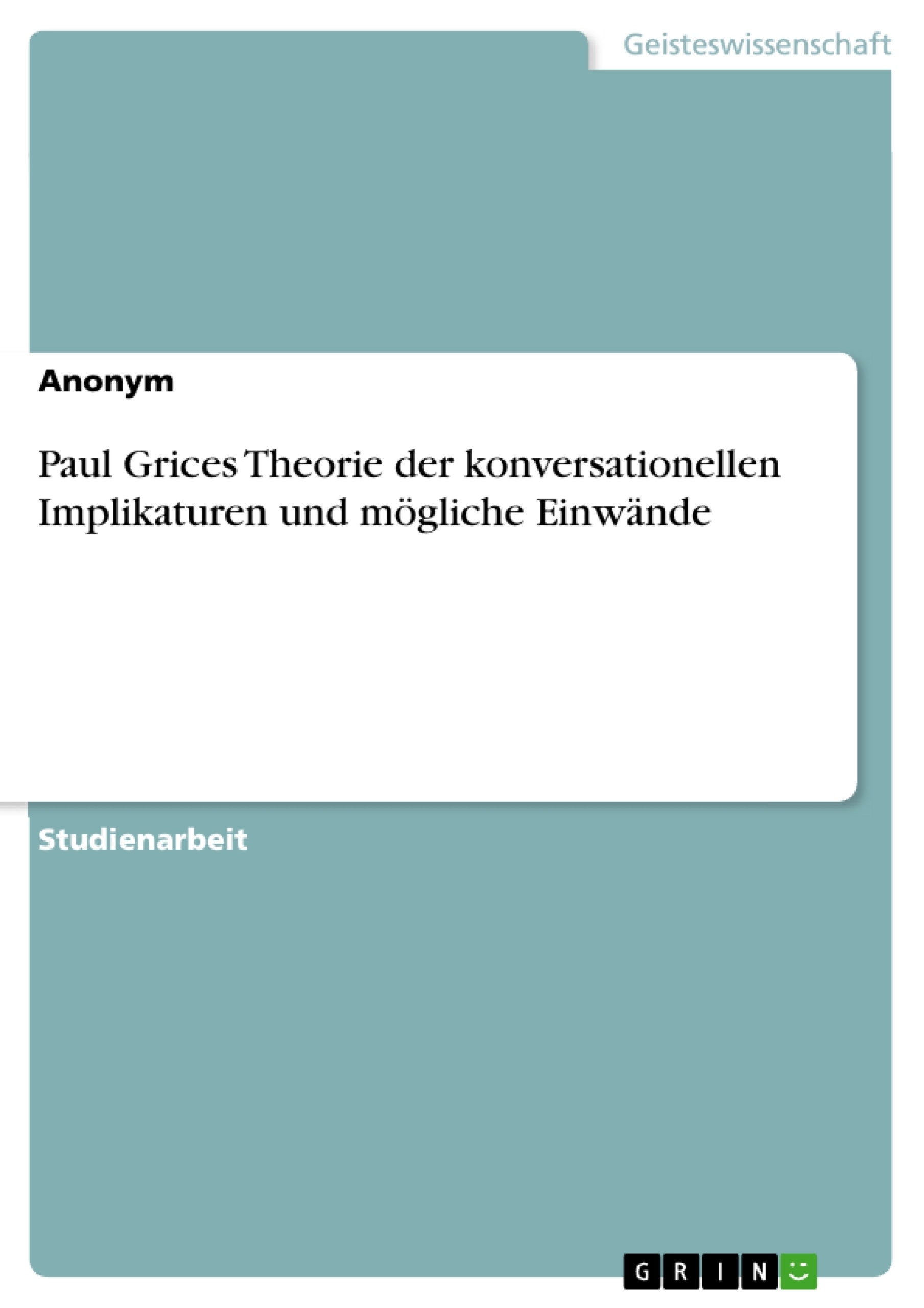In der folgenden Hausarbeit wird Paul Grices Theorie der konversationellen Implikaturen erklärt und mögliche Einwände betrachtet.
Zu Beginn werde ich die Theorie an sich darlegen, daraufhin auf potenzielle Kritikpunkte dieser Theorie eingehen und schließlich ein Fazit verfassen. In "Logic and Conversation" aus dem Jahr 1975 wird Grices Implikaturtheorie erstmals veröffentlicht. Bei
seiner Theorie geht es darum, dass ein Sprecher mit seinem Gesagten mehr ausdrücken kann als er tatsächlich sagt. Wir meinen und verstehen nämlich oft mehr als wir sagen.
Grice nimmt hier das Beispiel von drei Personen. Person A fragt Person B, wie sich Person C in seiner neuen Arbeit macht. Person B sagt, dass Person C seine Kollegen mag und bislang noch nicht ins Gefängnis gekommen ist. Hier wird deutlich, dass Person B mehr meint als er tatsächlich gesagt hat. Person A kann nun mit der Aussage, dass Person C noch nicht ins Gefängnis gekommen ist nämlich mehr implikatieren. Beispielsweise, dass C jemand ist, von dem man denken kann, dass er oft Dummheiten anstellt und somit relativ schnell im Gefängnis landen könnte.
Inhaltsverzeichnis
- Fragestellung: Worin besteht Grice's Theorie der konversationellen Implikaturen? Diskutieren Sie mögliche Einwände.
- Darlegung der Theorie
- Kritikpunkte
- Fazit
- Einwände
- Allgemeine Probleme
- Konversationsmaxime
- Fünfte Maxime?
- Scheitern der Konversationsmaxime
- Kooperationsprinzip?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert Paul Grice's Theorie der konversationellen Implikaturen und beleuchtet mögliche Einwände. Der Schwerpunkt liegt auf der Erläuterung der Theorie, der Untersuchung von Kritikpunkten und der Entwicklung eines abschließenden Fazits.
- Die Theorie der konversationellen Implikaturen von Paul Grice
- Die Rolle von Konversationsmaximen
- Mögliche Einwände und Kritikpunkte
- Die Bedeutung des Kooperationsprinzips
- Die Interpretation von Aussagen in alltäglichen Situationen
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Abschnitt der Hausarbeit stellt Grice's Theorie der konversationellen Implikaturen vor. Dabei wird erläutert, dass Sprecher mit ihren Aussagen mehr ausdrücken können, als sie tatsächlich sagen. Es wird das Konzept der vier Konversationsmaximen (Quantität, Qualität, Relation und Art & Weise) eingeführt und anhand von Beispielen veranschaulicht, wie diese zur Entstehung von Implikaturen beitragen können.
Der zweite Abschnitt der Hausarbeit beleuchtet mögliche Einwände gegen Grice's Theorie. Es werden allgemeine Kritikpunkte thematisiert, die sich auf die Frage konzentrieren, wie es überhaupt möglich ist, dass wir mehr sagen und verstehen, als explizit gesagt wird. Des Weiteren werden Einwände gegen die Konversationsmaxime selbst geäußert, da diese durch verschiedene Faktoren wie Ironie oder Sarkasmus scheitern können.
Die Hausarbeit diskutiert auch die Notwendigkeit einer möglichen fünften Maxime, die auf die Zweckmäßigkeit und Zielgerichtetheit von Aussagen fokussiert. Sie argumentiert, dass Grice's Theorie nicht ausreichend berücksichtigt, wie Aussagen in alltäglichen Situationen verstanden werden und dass sie nur den Aspekt des Sprechers abdeckt, nicht aber den des Hörers.
Zusätzlich wird die Frage aufgeworfen, ob eine Konversation immer nach einem Kooperationsprinzip verläuft, da in der Realität Situationen auftreten können, in denen Gesprächspartner nicht kooperativ sind oder verschiedene Ziele verfolgen.
Schlüsselwörter
Konversationelle Implikaturen, Paul Grice, Konversationsmaximen, Kooperationsprinzip, Ironie, Sarkasmus, Mehrdeutigkeit, Sprechakte, Interpretation, Alltagskommunikation.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2016, Paul Grices Theorie der konversationellen Implikaturen und mögliche Einwände, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/537879