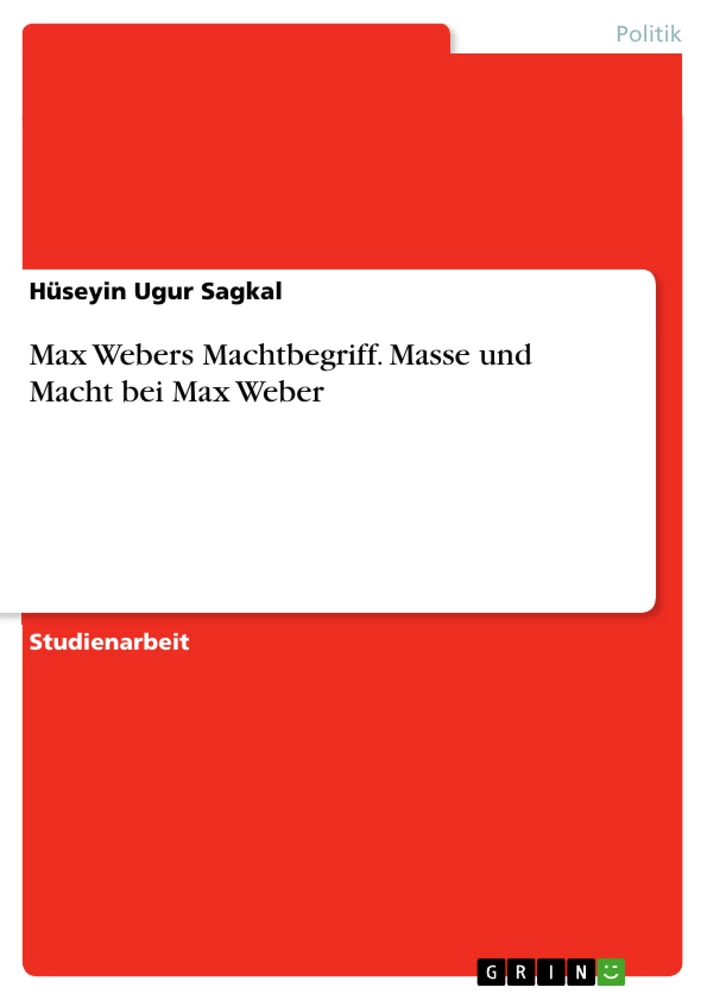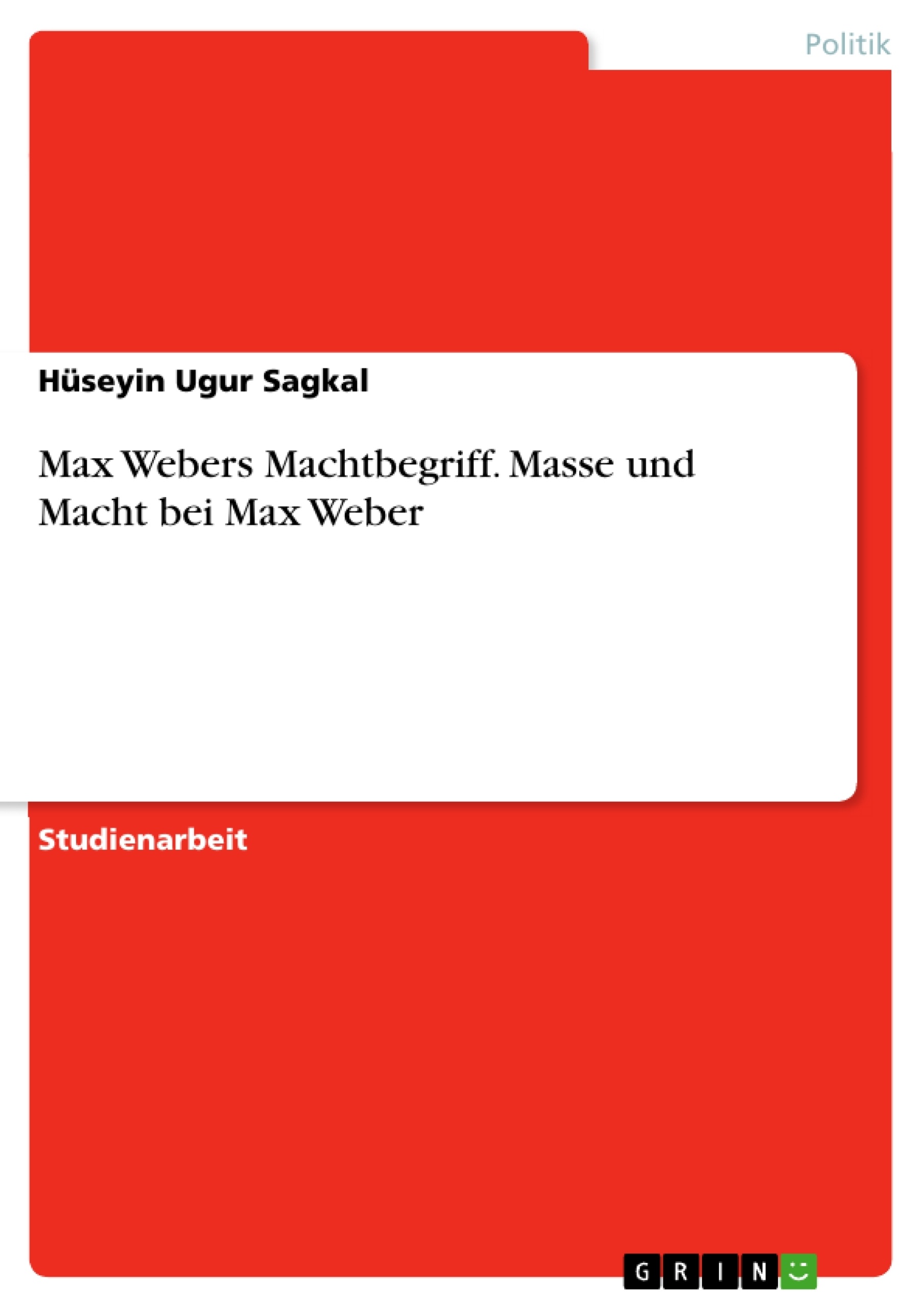Max Weber hat die Politikwissenschaft geprägt wie kein zweiter. Besonders herausstechen tun seine Definition von Herrschaft und die Einteilung des moralischen Handelns, in Gesinnungs- und Verantwortungsethik. Auch sein Machtbegriff ist prägend geworden. Max Weber definiert Macht wie folgt: „Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel, worauf diese Chance beruht.“ (Wug-O) Der Machtbegriff von Weber wurde sehr oft in Zusammenhang mit anderen Forschungsfeldern von Max Weber, wie z.B. seiner Herrschaftssoziologie, untersucht. Sie war allerdings selten alleiniger Forschungsgegenstand. Ausnahmen bilden hier z.B. Steinberger, der versucht den Machtbegriff von Weber auf Machiavelli und Nietzsche zurückzuführen. Daher möchte ich in meiner Hausarbeit den Fokus auf den Machtbegriff richten.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- Terminologie von Masse und Macht in Webers Werken
- Machtlosigkeit durch eine Masse
- Machtlosigkeit direkt durch eine Masse
- Machtlosigkeit indirekt durch eine Masse
- Masse kontrollieren
- Masse kontrollieren durch Vertrauen
- Masse kontrollieren durch Abhängigkeit
- Masse kontrollieren durch Belohnungen
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Beziehung zwischen Masse und Macht im Werk von Max Weber. Ziel ist es, die Bedeutung dieses Zusammenhangs in Webers Schriften zu untersuchen, insbesondere im Hinblick auf seine Definition von Macht. Dazu wird die Verwendung der Begriffe „Masse“ und „Macht“ in Webers Werken analysiert, die Möglichkeiten untersucht, wie eine Masse Macht entziehen kann, und wie eine Masse kontrolliert bzw. beherrscht werden kann, um an Macht zu gelangen. Der Fokus liegt dabei auf den Werken „Politik als Beruf“ und „Wirtschaft und Gesellschaft – Die Stadt“, wobei zusätzliche Bezugnahmen auf „Wirtschaft und Gesellschaft – Grundriss der verstehenden Soziologie“ und „Wirtschaft und Gesellschaft – Die Wirtschaft und die gesellschaftlichen Ordnungen und Mächte“ erfolgen.
- Analyse der Verwendung der Begriffe „Masse“ und „Macht“ in Webers Werken
- Untersuchung der Machtlosigkeit durch eine Masse (direkte und indirekte Formen)
- Erläuterung von Mechanismen der Kontrolle und Beherrschung einer Masse
- Hervorhebung der Bedeutung des Machtbegriffs in Webers Werk
- Beurteilung des Zusammenhangs zwischen Masse und Macht im Kontext von Webers Herrschaftssoziologie
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt Max Webers prägenden Einfluss auf die Politikwissenschaft dar, insbesondere seine Definition von Herrschaft und die Unterscheidung zwischen Gesinnungs- und Verantwortungsethik. Der Fokus der Arbeit liegt auf Webers Machtbegriff, der im Kontext seiner Herrschaftssoziologie untersucht wurde, aber selten alleiniger Forschungsgegenstand war. Die Hausarbeit soll den Zusammenhang zwischen Masse und Macht in Webers Werken beleuchten und die Bedeutung dieses Themas hervorheben.
Terminologie von Masse und Macht in Webers Werken
Dieser Abschnitt analysiert die Verwendung der Begriffe „Masse“ und „Macht“ in Webers Werken „Wirtschaft und Gesellschaft – Die Stadt“ und „Politik als Beruf“. Es wird untersucht, wie Weber den Begriff „Macht“ verwendet, in welchen Formen er ihn differenziert und wie oft er im Text vorkommt. Die Analyse betrachtet die Verwendung des Begriffs „Masse“ und die Frage, ob Weber ihm eine Bedeutung zuschreibt. Synonyme für den Massebegriff werden erörtert, wie z.B. Menschengruppen, Verbände, Gefolgsleute und die Gefolgschaft.
Machtlosigkeit durch eine Masse
Dieses Kapitel untersucht, wie eine Person durch eine Masse ihrer Macht beraubt werden kann. Es werden verschiedene Möglichkeiten betrachtet, wie die Masse, direkt oder indirekt, zur Machtlosigkeit einer Person führen kann.
Masse kontrollieren
Der letzte Abschnitt des Hauptteils widmet sich der Frage, wie eine Masse kontrolliert bzw. beherrscht werden kann, um an Macht zu gelangen. Es werden verschiedene Mechanismen der Kontrolle durch Vertrauen und Abhängigkeit sowie durch Belohnungen analysiert.
Schlüsselwörter
Max Weber, Machtbegriff, Masse, Herrschaftssoziologie, Politik als Beruf, Wirtschaft und Gesellschaft, Kontrolle, Beherrschung, Machtlosigkeit, Synonyme, Menschengruppen, Verbände, Gefolgsleute, Gefolgschaft, Vertrauen, Abhängigkeit, Belohnungen.
Häufig gestellte Fragen
Wie definiert Max Weber den Begriff „Macht“?
Weber definiert Macht als jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, unabhängig von der Grundlage dieser Chance.
Was ist das Verhältnis zwischen Masse und Macht?
Die Arbeit untersucht, wie Massen (Menschengruppen, Verbände) einerseits Macht entziehen können (Machtlosigkeit) und andererseits als Mittel zur Herrschaft kontrolliert werden können.
Wie kann eine Masse kontrolliert werden?
Weber beschreibt Mechanismen wie Vertrauen, Abhängigkeit und Belohnungen als Wege, um eine Gefolgschaft zu steuern und Macht auszuüben.
Was ist der Unterschied zwischen Macht und Herrschaft?
Während Macht die allgemeine Durchsetzung des Willens beschreibt, ist Herrschaft die Chance, für einen Befehl bestimmten Inhalts bei angebbaren Personen Gehorsam zu finden.
Welche Werke von Weber werden analysiert?
Im Fokus stehen „Politik als Beruf“ sowie verschiedene Bände von „Wirtschaft und Gesellschaft“.
- Citation du texte
- Hüseyin Ugur Sagkal (Auteur), 2018, Max Webers Machtbegriff. Masse und Macht bei Max Weber, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/538458