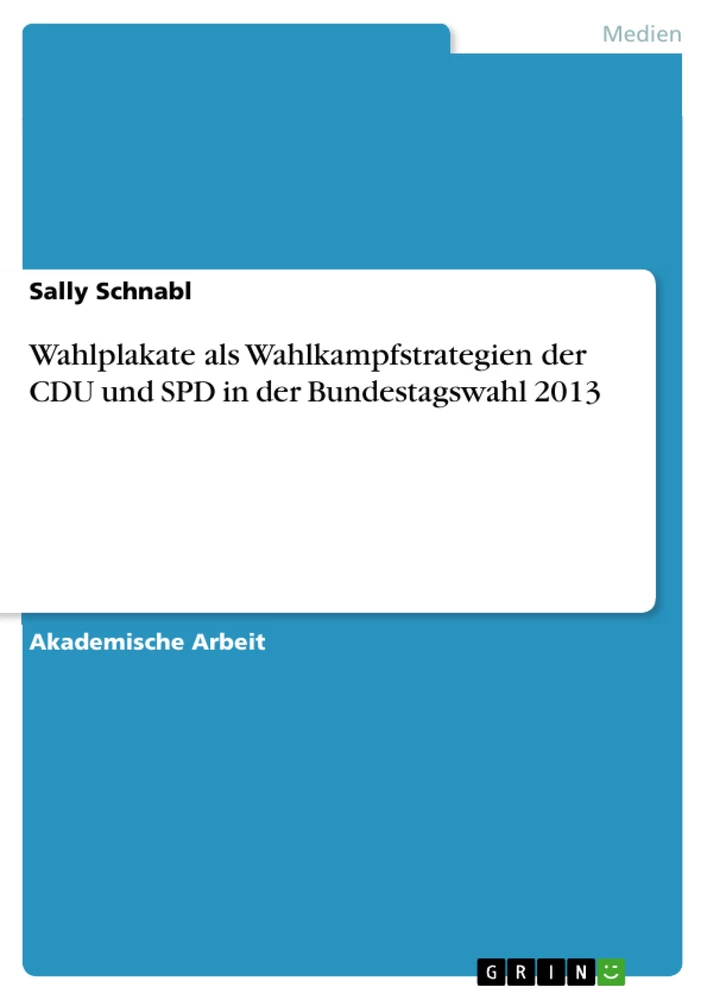Die Arbeit beschäftigt sich mit den Wahlstrategien, bezogen auf die Spitzenkandidaten der SPD und der CDU, bei der Bundestagswahl 2013.
Es soll überprüft werden, ob die CDU aufgrund ihrer Wahlstrategien, speziell bezogen auf ihre Spitzenkandidatin Angela Merkel, erfolgreicher war als die SPD mit dem Spitzenkandidat Peer Steinbrück. Haben die Wahlstrategien auf den Wahlplakaten, mit der Abbildung der Spitzenkandidaten bei der Bundestagswahl 2013 dazu geführt, dass die CDU erfolgreicher war als die SPD? Diese Frage soll primär anhand von Wahlplakaten untersucht werden. In der Arbeit wird primär auf die Theorie des Wissenschaftlers Frank Brettschneider eingegangen. Brettschneiders Theorie beschäftigt sich mit der Bindung der Wähler an einen Spitzenkandidaten anstatt an eine Partei.
Die Spitzenkandidatin der CDU war bei der Bundestagswahl 2013 Angela Merkel. Als Spitzenkandidat der SPD trat Peer Steinbrück an. Zuerst schien es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der SPD und der CDU gegeben zu haben. Allerdings verlor die SPD die Wahl am Ende deutlich und Merkel siegte mit ihrer Partei mit großem Vorsprung.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Theoriegrundlagen
2.1 Spitzenkandidaten und Wahlerfolg
2.2 Reichweite und Wirkung von Wahlplakaten
2.3 Wahlkampfstrategien
2.3.1 Personalisierung des Kandidaten
2.3.2 Negative Campaigning
3. Empirischer Teil
3.1 Plakatanalyse – Negative Campaigning Angriffe der SPD auf die CDU
3.2 Personalisierungsstrategie der CDU – Merkel steht für die Partei
3.3 Spitzenkandidat Peer Steinbrück – SPD Plakat
3.4 Vergleich der Plakate und Ergebnisse
4. Fazit und Ausblick
Literaturverzeichnis
-
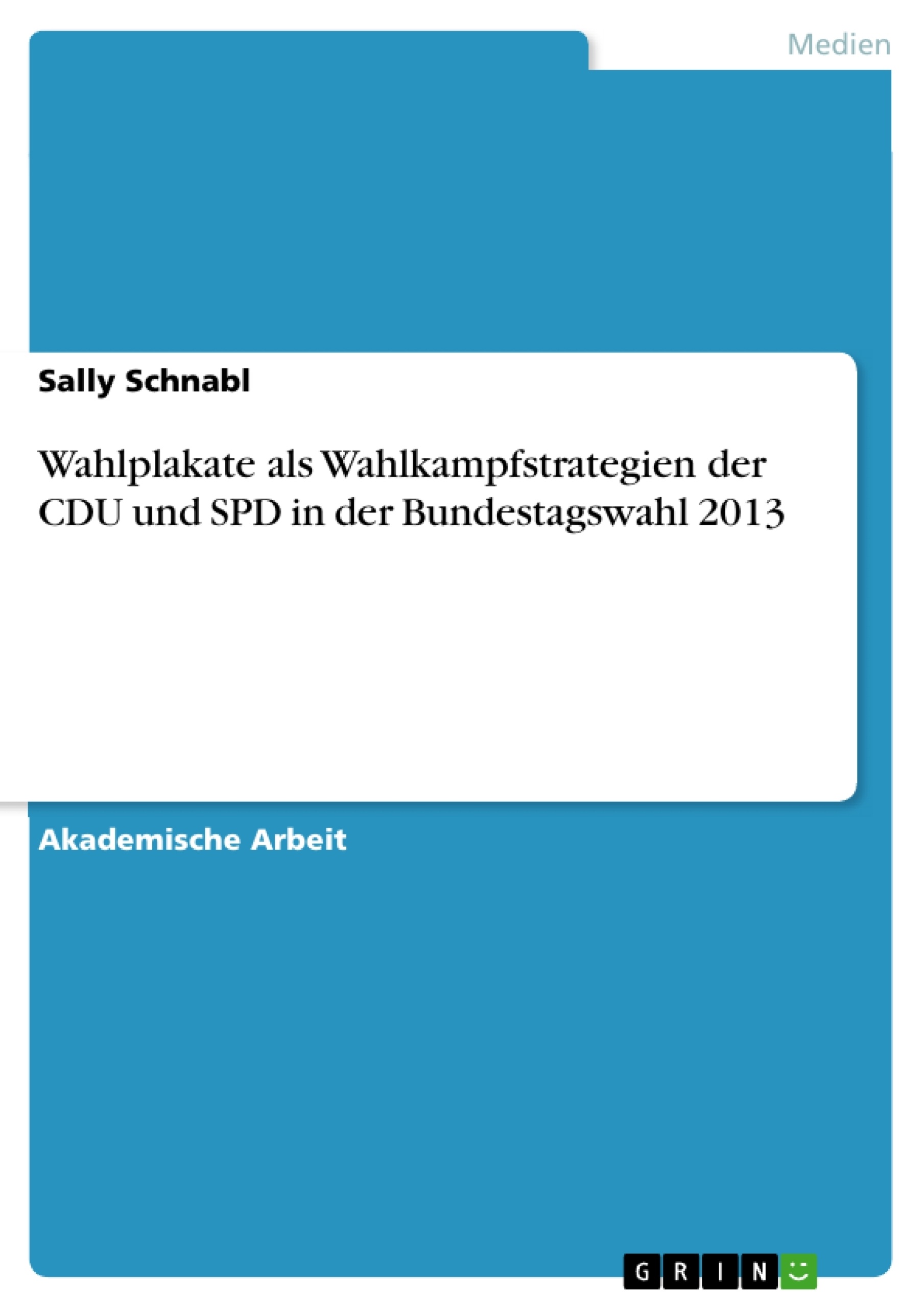
-

-

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen.