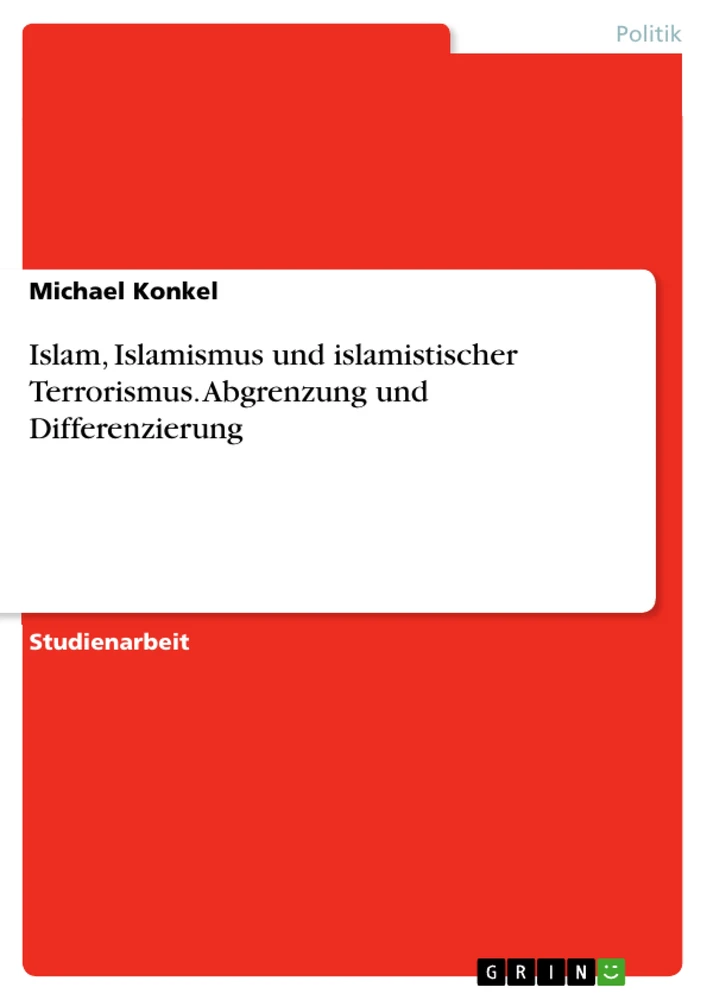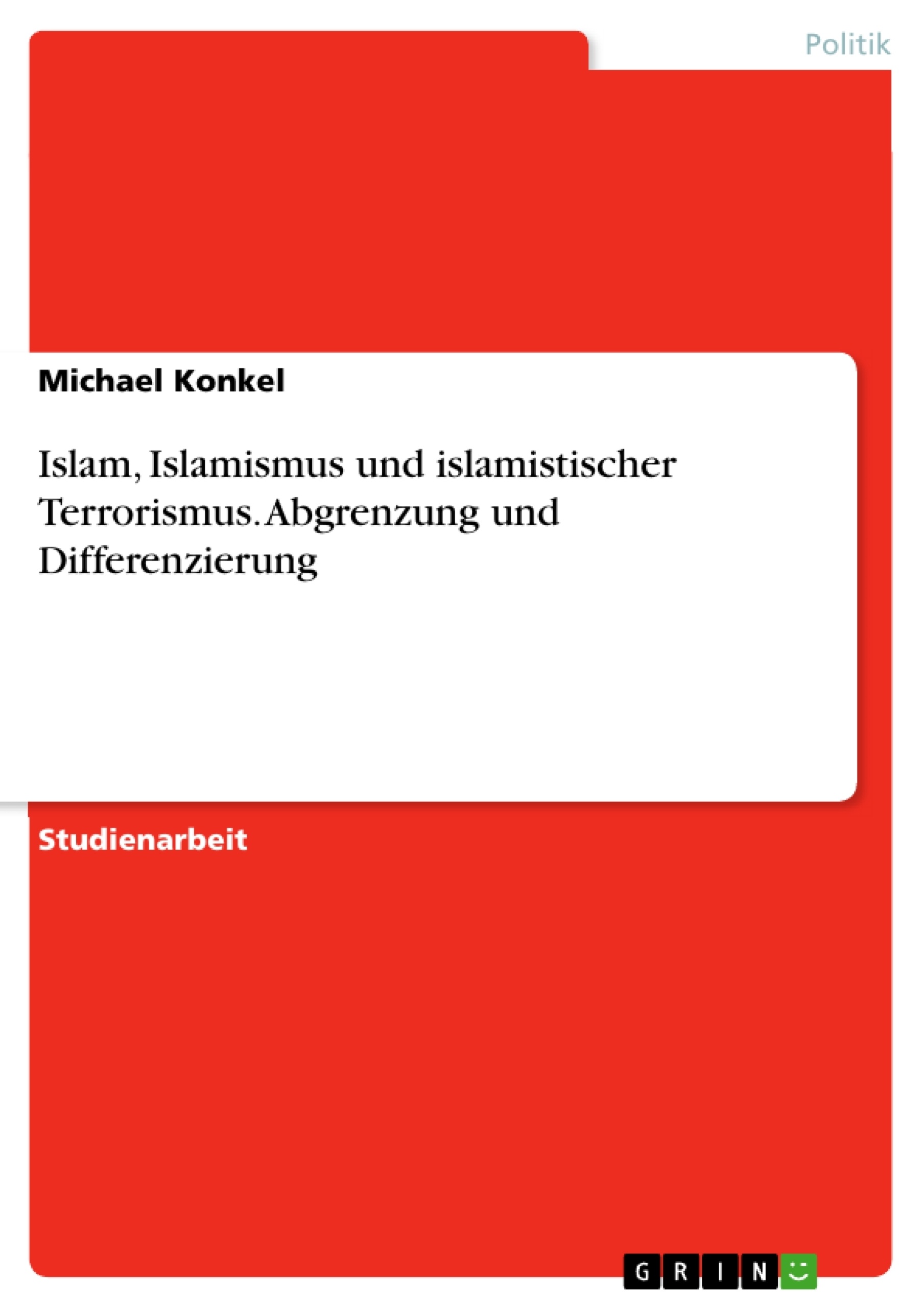Diese Arbeit thematisiert die Begriffe Islam, Islamismus und islamistischer Terrorismus. Der Islam stellt heute mit mehr als 1,8 Milliarden Anhängern, nach dem Christentum, die zweitgrößte Weltreligion dar. Mit den vom Terrornetzwerk al Qaida verübten Anschlägen vom 11. September 2001 rückte der islamistische Terrorismus erstmals in den Fokus einer breiten Weltöffentlichkeit. Seither wird der Islam in der medialen Berichterstattung mit Gewalt assoziiert und es herrscht eine kontinuierliche Debatte über die Verbindung zwischen Religion und Gewalt.
In diesem Zusammenhang soll im Verlauf dieser Ausarbeitung differenziert auf die Abgrenzung zwischen Islam, Islamismus und islamistischem Terrorismus eingegangen werden. Zur Veranschaulichung erfolgt dazu zunächst ein Überblick über die Grundzüge des islamischen Glaubens. Die Entstehungsgeschichte, die Entwicklung und wesentliche Begrifflichkeiten sollen erklärt und verdeutlicht werden. Danach erfolgt die Bestimmung des Islamismus-Begriffs und eine Abgrenzung zum islamischen Glauben. Vor diesem Hintergrund werden anschließend die Begriffe Salafismus und Wahhabismus sowie der islamische Modernismus erläutert. Der Abschnitt beschäftigt sich abschließend mit den Anfängen und der ideologischen Festigung des Islamismus.
Im Anschluss daran wird der Islamismus dem islamistischen Terrorismus gegenübergestellt. Es folgt eine Begriffsbestimmung des islamistischen Terrorismus und eine Abgrenzung zum Islamismus-Begriff. In diesem Zusammenhang wird daran anknüpfend auf den Begriff des Dschihadismus eingegangen und die Internationalisierung dschihadistischer Gruppierungen betrachtet. Des Weiteren wird stellvertretend für derartige Gruppierungen beispielhaft die Entstehung und Entwicklung der al Qaida und die Sonderstellung des Islamischen Staates (IS) vor dem Hintergrund klassisch strukturierter Terrororganisationen veranschaulicht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Grundzüge des islamischen Glaubens
- Grundlagen
- Vorislamische Zeit
- Der Prophet Mohammed
- Sunniten und Schiiten
- Koran, Sunna und Hadith
- Die Scharia
- Der Dschihad
- Islamismus
- Begriffsbestimmung und Abgrenzung
- Salafismus
- Wahhabismus
- Islamischer Modernismus
- Anfänge und ideologische Festigung
- Islamistischer Terrorismus
- Begriffsbestimmung und Abgrenzung
- Dschihadismus
- Internationalisierung
- Al Qaida
- Der Islamische Staat
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Abgrenzung zwischen Islam, Islamismus und islamistischem Terrorismus. Ziel ist es, ein differenziertes Verständnis dieser drei Begriffe zu entwickeln und die komplexen Zusammenhänge zwischen Religion, Ideologie und Gewalt aufzuzeigen.
- Die Grundzüge des islamischen Glaubens und seine Entwicklung
- Die Entstehung und Entwicklung des Islamismus
- Die Definition und Abgrenzung von islamistischem Terrorismus
- Die Rolle des Dschihadismus und die Internationalisierung dschihadistischer Gruppierungen
- Der Einfluss von Al Qaida und dem Islamischen Staat auf die Entwicklung des islamistischen Terrorismus
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Islam als zweitgrößte Weltreligion vor und thematisiert die mediale Verbindung von Islam und Gewalt, insbesondere durch die Anschläge vom 11. September 2001.
- Die Grundzüge des islamischen Glaubens: Dieses Kapitel behandelt die Bedeutung des Wortes "Islam", die fünf Säulen des Islam und die vorislamische Zeit. Es erläutert die Rolle Mohammeds als Prophet und die Entstehung der Umma.
- Islamismus: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Islamismus" und grenzt ihn vom islamischen Glauben ab. Es behandelt den Salafismus, Wahhabismus und den islamischen Modernismus sowie die Anfänge und ideologische Festigung des Islamismus.
Schlüsselwörter
Islam, Islamismus, islamistischer Terrorismus, Dschihadismus, Al Qaida, Islamischer Staat, Religion, Ideologie, Gewalt, Monotheismus, Umma, Scharia, Koran, Sunna, Hadith, Salafismus, Wahhabismus, islamischer Modernismus.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Islam und Islamismus?
Der Islam ist eine Weltreligion mit über 1,8 Milliarden Anhängern. Islamismus hingegen ist eine politische Ideologie, die die Religion instrumentalisiert, um eine bestimmte staatliche und gesellschaftliche Ordnung zu erzwingen.
Wie wird islamistischer Terrorismus definiert?
Er beschreibt die Anwendung von Gewalt durch extremistische Gruppen, um politische Ziele auf Basis einer radikalen Interpretation des Islam zu erreichen, oft unter dem Begriff des Dschihadismus.
Was sind die fünf Säulen des Islam?
Die Arbeit erläutert diese als Grundpfeiler des Glaubens, zu denen das Glaubensbekenntnis, das Gebet, das Fasten, die Armensteuer und die Pilgerfahrt nach Mekka gehören.
Was unterscheidet Sunniten und Schiiten?
Die Arbeit geht auf die historische Spaltung der muslimischen Gemeinschaft (Umma) nach dem Tod des Propheten Mohammed ein, die auf unterschiedlichen Vorstellungen über seine rechtmäßige Nachfolge basiert.
Was versteht man unter Salafismus und Wahhabismus?
Dies sind ultra-konservative Strömungen innerhalb des Islamismus, die eine Rückkehr zu den vermeintlichen Wurzeln des Ur-Islam fordern und oft als ideologische Basis für Radikalisierung dienen.
Welche Rolle spielt al Qaida in der Entwicklung des Terrorismus?
Al Qaida wird als Beispiel für die Internationalisierung des dschihadistischen Terrors angeführt, insbesondere durch die Anschläge vom 11. September 2001.
- Quote paper
- Michael Konkel (Author), 2018, Islam, Islamismus und islamistischer Terrorismus. Abgrenzung und Differenzierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/539055