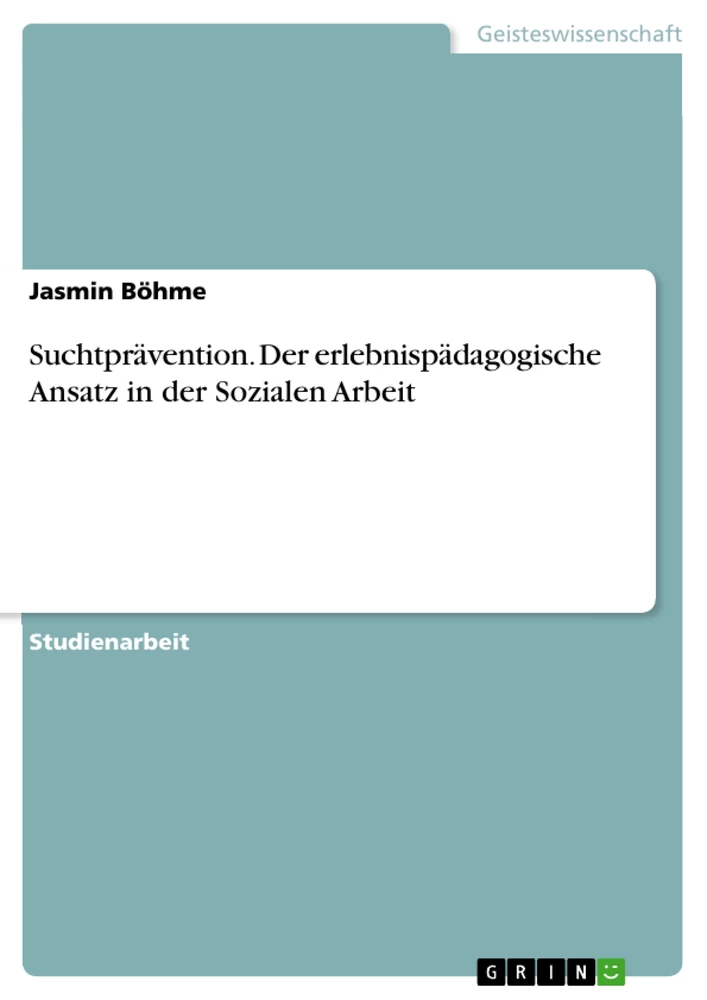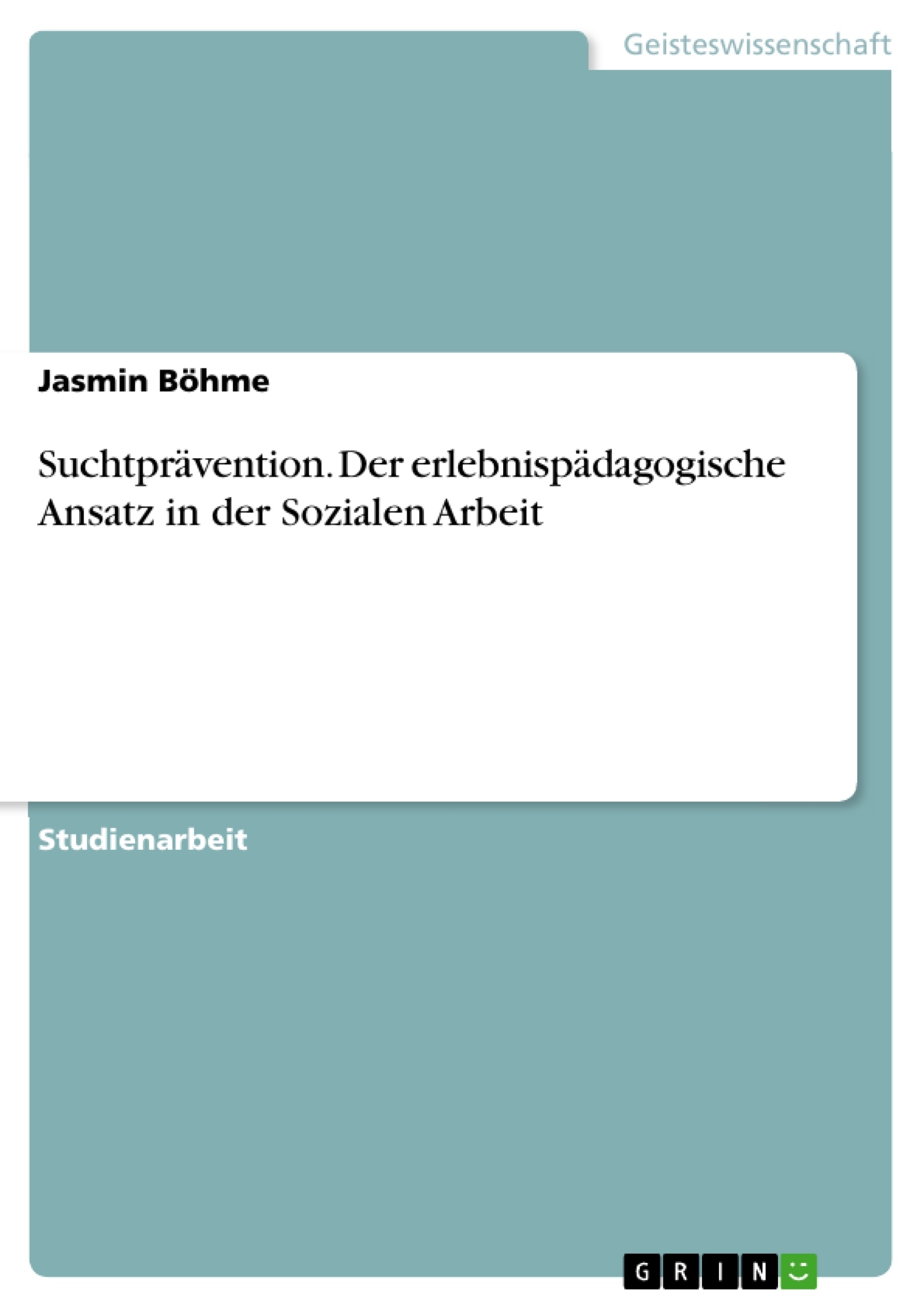Herzlich Willkommen, im Zeitalter der Konsumer, geprägt durch eine reizgeflutete Gesellschaft und psychisch stark belastete Menschen. Der Mensch muss vielen Versuchungen stand halten, ein feines Filtersystem für wertvolle Umweltreize entwickeln und dementsprechend seine eigene gesunde Persönlichkeit formen.
Zu Beginn möchte ich die Entwicklung der Sucht klären, was ihre Beständigkeit in der Gesellschaft verdeutlicht und die Wichtigkeit einer bewussten präventiven Arbeit hervorheben soll. Weiterhin analysiere ich in dieser Arbeit charakteristische Strukturen der Sucht und die Vielfältigkeit präventiver Methoden und Handlungsfelder der Sozialen Arbeit, um zu verdeutlichen wie wichtig die individuelle Intervention innerhalb der Suchtprävention ist. Ebenfalls werden die Strukturen der Erlebnispädagogik genauer beleuchtet, sodass sich schlussendlich die Verbindung zur Suchtprävention erschließt. Hinsichtlich dessen, werden die Anforderungen der Sozialen Arbeit genauer betrachtet.
Zusammenführend soll die Komplexität der Suchtprävention dargelegt und der positive Wirkungsbereich der Erlebnispädagogik innerhalb der Prävention hervorgehoben werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Entwicklungslinie der Suchtprävention
- 3 Sucht
- 3.1 Begriffsklärung Sucht
- 3.2 Formen der Sucht
- 3.3 Bedingende Faktoren der Sucht
- 3.4 Erkennungsmerkmale der Sucht
- 4 Suchtprävention
- 4.1 Begriffsklärung Prävention
- 4.2 Arbeitsfelder in der Suchtprävention
- 4.3 Zielgruppen der Suchtprävention
- 4.4 Ansätze in der Suchtprävention
- 4.5 Anforderungen an die Soziale Arbeit
- 4.6 Kritischer Blick auf die Suchtprävention
- 5 Erlebnispädagogischer Ansatz in der Suchtprävention
- 5.1 Begriffsklärung Erlebnispädagogik
- 5.2 Der Kerngedanke der Erlebnispädagogik
- 5.3 Handlungsmodelle der Erlebnispädagogik und ihre Areale in Deutschland
- 5.4 Ziele der Erlebnispädagogik
- 5.5 Zielgruppen der Erlebnispädagogik
- 5.6 Kritischer Blick auf die Erlebnispädagogik
- 6 Fazit
- 7 Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den erlebnispädagogischen Ansatz in der Suchtprävention. Ziel ist es, die Entwicklung der Suchtprävention aufzuzeigen, charakteristische Strukturen der Sucht und präventive Methoden der Sozialen Arbeit zu analysieren, und die Verbindung zur Erlebnispädagogik herzustellen. Die Anforderungen der Sozialen Arbeit in diesem Kontext werden ebenfalls betrachtet. Die Komplexität der Suchtprävention soll dargelegt und der positive Einfluss der Erlebnispädagogik hervorgehoben werden.
- Entwicklung der Suchtprävention
- Strukturen und Formen von Sucht
- Methoden und Ansätze der Suchtprävention
- Der erlebnispädagogische Ansatz
- Anforderungen an die Soziale Arbeit in der Suchtprävention
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Suchtprävention im Kontext einer reizüberfluteten Gesellschaft ein. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und hebt die Bedeutung individueller Interventionen und des erlebnispädagogischen Ansatzes hervor. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Komplexität der Suchtprävention und der positiven Wirkung der Erlebnispädagogik.
2 Entwicklungslinie der Suchtprävention: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung der Suchtprävention, beginnend mit den 1960er Jahren und der Fokussierung auf illegale Drogen und abstinenzorientierte Ansätze. Es beschreibt den Paradigmenwechsel hin zu Ursachenbekämpfung, der Einbeziehung legaler Drogen und des Konsumenten als aktiven Handelnden, sowie die Entwicklung des „Setting-Ansatzes“ und der „Policyentwicklung“. Die zunehmende Komplexität der Angebote und der politische Einfluss auf die Präventionsmaßnahmen werden kritisch betrachtet.
3 Sucht: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Sucht“ anhand der WHO-Definition und der Definition von M. Laging, als Abhängigkeit von Substanzen und Verhaltensweisen mit zwanghaftem Charakter. Es unterscheidet zwischen substanzgebundenen und substanzungebundenen Süchten und nennt Beispiele für beide Kategorien. Der Fokus liegt auf der Beschreibung der verschiedenen Formen und Ausprägungen von Sucht.
Schlüsselwörter
Suchtprävention, Erlebnispädagogik, Soziale Arbeit, Sucht, Abhängigkeit, Präventionsansätze, Individuelle Intervention, Substanzgebundene Sucht, Substanzungebundene Sucht, Risikokompetenz, Gesundheitsförderung, Lebenskompetenz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Erlebnispädagogischer Ansatz in der Suchtprävention
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über den erlebnispädagogischen Ansatz in der Suchtprävention. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Schlüsselwortverzeichnis. Der Fokus liegt auf der Analyse der Entwicklung der Suchtprävention, der verschiedenen Suchtformen, präventiver Methoden der Sozialen Arbeit und der Integration der Erlebnispädagogik in diesen Kontext.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt folgende Kernbereiche: die Entwicklungslinie der Suchtprävention, die Definition und verschiedene Formen von Sucht (substanzgebunden und substanzungebunden), Methoden und Ansätze der Suchtprävention, den erlebnispädagogischen Ansatz im Detail (inkl. Begriffsklärung, Zielen und Kritik), die Anforderungen an die Soziale Arbeit in der Suchtprävention und schließlich ein Fazit.
Welche Zielsetzung verfolgt das Dokument?
Das Dokument zielt darauf ab, den erlebnispädagogischen Ansatz in der Suchtprävention zu untersuchen. Es möchte die Entwicklung der Suchtprävention aufzeigen, die Strukturen von Sucht analysieren, präventive Methoden der Sozialen Arbeit beleuchten und deren Verbindung zur Erlebnispädagogik herstellen. Die Anforderungen der Sozialen Arbeit und die Komplexität der Suchtprävention werden ebenfalls thematisiert, wobei der positive Einfluss der Erlebnispädagogik hervorgehoben wird.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument ist in Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einleitung und endend mit einem Literaturverzeichnis. Zwischen Einleitung und Fazit werden die Entwicklungslinie der Suchtprävention, der Begriff der Sucht, Suchtprävention im Allgemeinen und schließlich der erlebnispädagogische Ansatz ausführlich behandelt. Jedes Kapitel enthält eine kurze Zusammenfassung.
Welche Schlüsselbegriffe werden im Dokument verwendet?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Suchtprävention, Erlebnispädagogik, Soziale Arbeit, Sucht, Abhängigkeit, Präventionsansätze, Individuelle Intervention, Substanzgebundene Sucht, Substanzungebundene Sucht, Risikokompetenz, Gesundheitsförderung und Lebenskompetenz.
Welche Arten von Sucht werden im Dokument beschrieben?
Das Dokument unterscheidet zwischen substanzgebundenen Süchten (z.B. Drogenabhängigkeit) und substanzungebundenen Süchten (z.B. Spielsucht). Es werden Beispiele für beide Kategorien genannt und die verschiedenen Formen und Ausprägungen von Sucht beschrieben.
Welche Kritikpunkte werden an der Suchtprävention und der Erlebnispädagogik geäußert?
Das Dokument enthält kritische Betrachtungen der Suchtprävention, die sich auf die zunehmende Komplexität der Angebote, den politischen Einfluss und den Paradigmenwechsel in der Präventionsarbeit beziehen. Auch die Erlebnispädagogik wird kritisch beleuchtet, wobei konkrete Kritikpunkte im Dokument selbst nachgeschlagen werden müssen.
Für wen ist dieses Dokument relevant?
Dieses Dokument ist relevant für Studierende der Sozialen Arbeit, Pädagogik und verwandter Disziplinen, sowie für Fachkräfte im Bereich der Suchtprävention und der Erlebnispädagogik. Es eignet sich auch für alle, die sich umfassend über die Thematik informieren möchten.
- Quote paper
- Jasmin Böhme (Author), 2019, Suchtprävention. Der erlebnispädagogische Ansatz in der Sozialen Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/539800