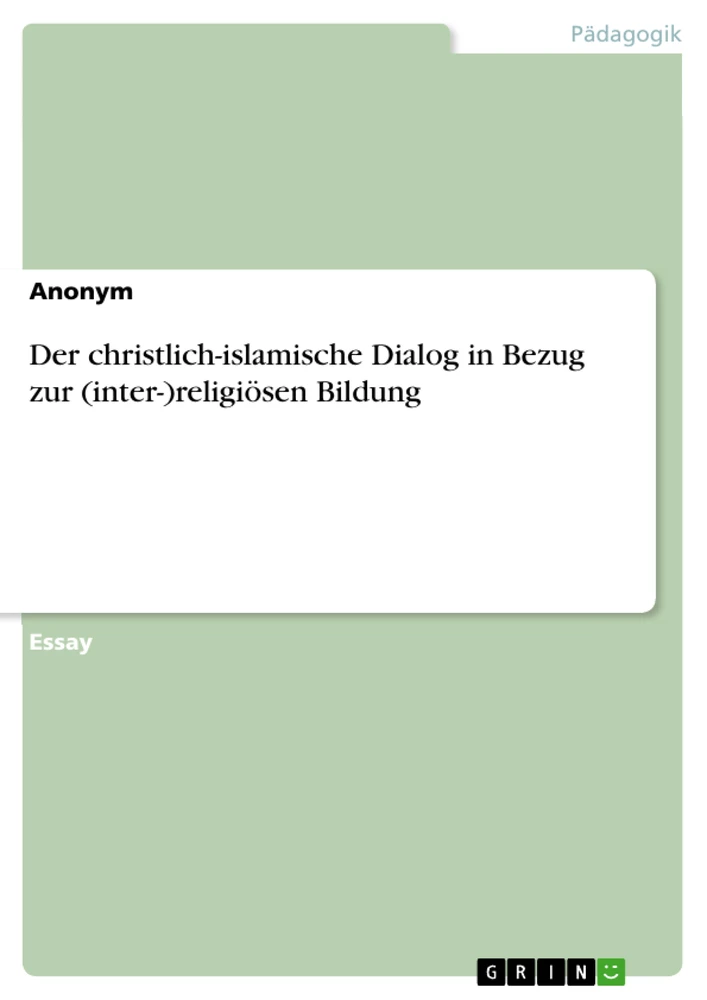In Deutschland leben etwa vier Millionen Muslime. Von diesen vier Millionen Muslimen sind ca. 850.000 muslimische Schülerinnen und Schüler, die nach dem Artikel 7 Absatz 3 des Grundgesetzes das Recht auf Erteilung von Religionsunterricht an öffentlichen Schulen unter staatlicher Aufsicht haben. Muslimische Eltern konkretisieren Forderungen nach einem islamischen Religionsunterricht, den sie mit politischer Unterstützung einführen wollen, deutlich. Christen und Muslime begegnen einander aber nicht nur in der Schule, sondern auch in der Berufswelt und im Alltag. Das SI-EKD, das gesellschaftliche und kirchliche Entwicklungen erforscht, hat 2018 eine Befragung zum Islam in der deutschen Bevölkerung durchgeführt. Während 69 Prozent der befragten deutschen Bevölkerung festhalten, dass Muslime zum Alltagsleben dazugehören, finden 67 Prozent der Befragten, dass der Islam nicht in die deutsche Gesellschaft passt. Fast 70 Prozent der Befragten finden also, dass Muslime zwar zum Alltag dazugehören, aber trotzdem nicht in die deutsche Gesellschaft passen. Dies könnte eventuell damit zusammenhängen, dass rund 71 Prozent der Deutschen angaben, dass sie sehr schlecht, eher schlecht oder nur teils/teils über den Islam Bescheid wissen würden.
Aufgrund der steigenden Zuwanderungszahlen und der weit verbreiteten Unkenntnis über den Islam bzw. den muslimischen Glauben, ist es naheliegend den Dialog mit dem Islam in allen Lebensbereichen zu intensivieren bzw. sich des Dialoges bewusst zu werden. Doch woher kommt eigentlich das Wort "Dialog" und welche Definition hat es? Um diese Frage beantworten zu können, gebe ich als erstes eine Begriffserklärung des Wortes "Dialog". Daraufhin werden Bedingungen zum Erfolg eines Dialoges genannt und die Durchführung eines Dialogs wird kurz thematisiert. Mir persönlich liegt das darauffolgende Kapitel auf dem Herzen, denn in diesem wird die Verantwortung für Menschen in Bezug auf den Dialog thematisiert. Im letzten Teil dieses Essays wird auf die interkulturelle Bildung und den Religionsunterricht an Schulen eingegangen, denn besonders in den Schulen treffen Christen und Muslime aufeinander.
-
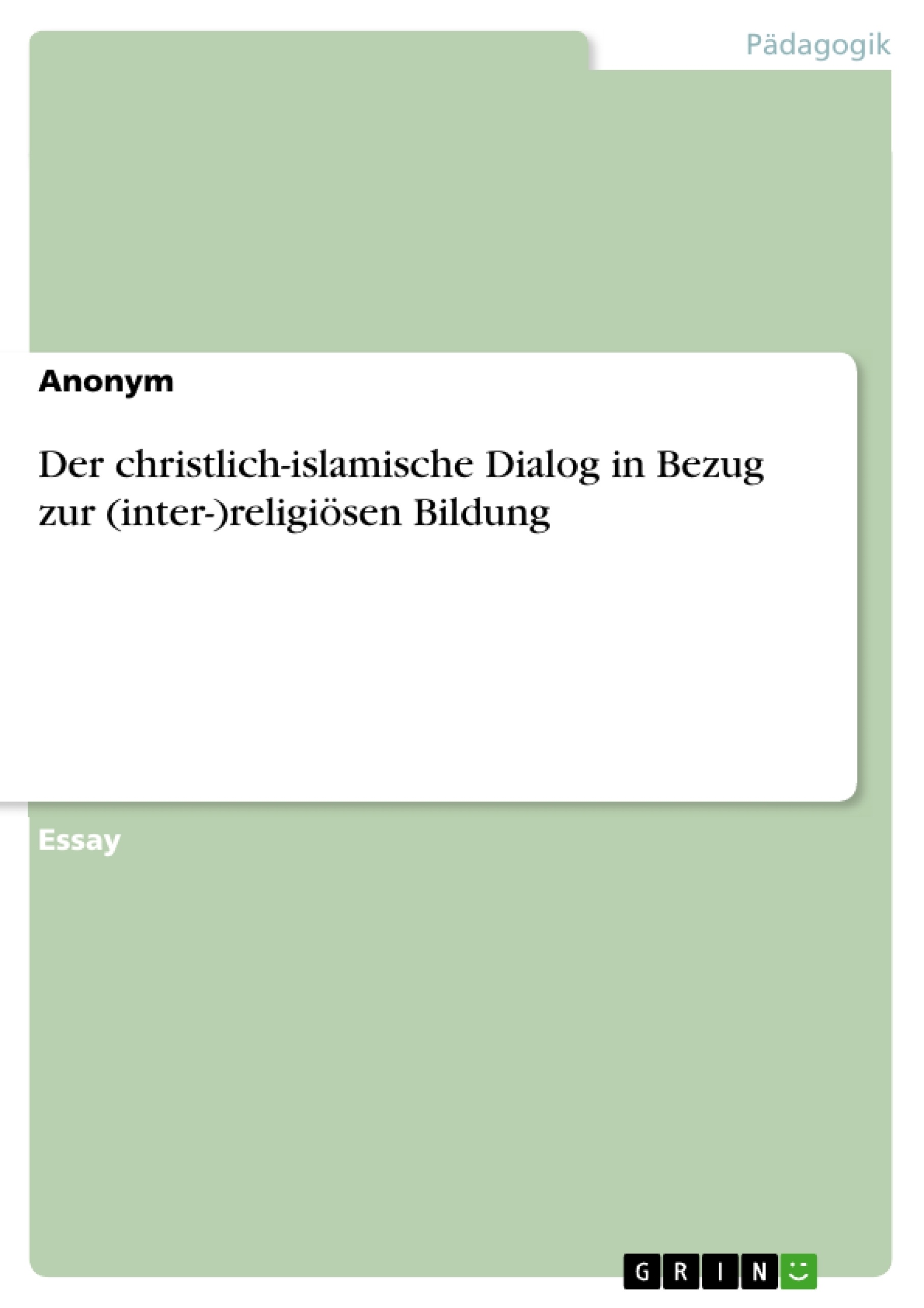
-

-

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen.