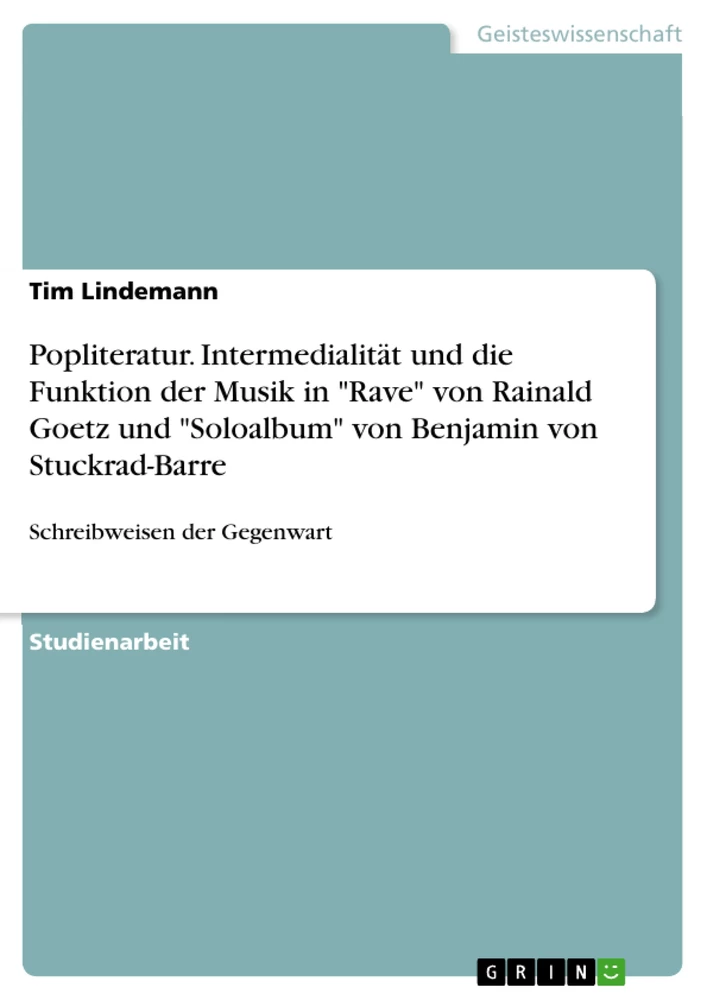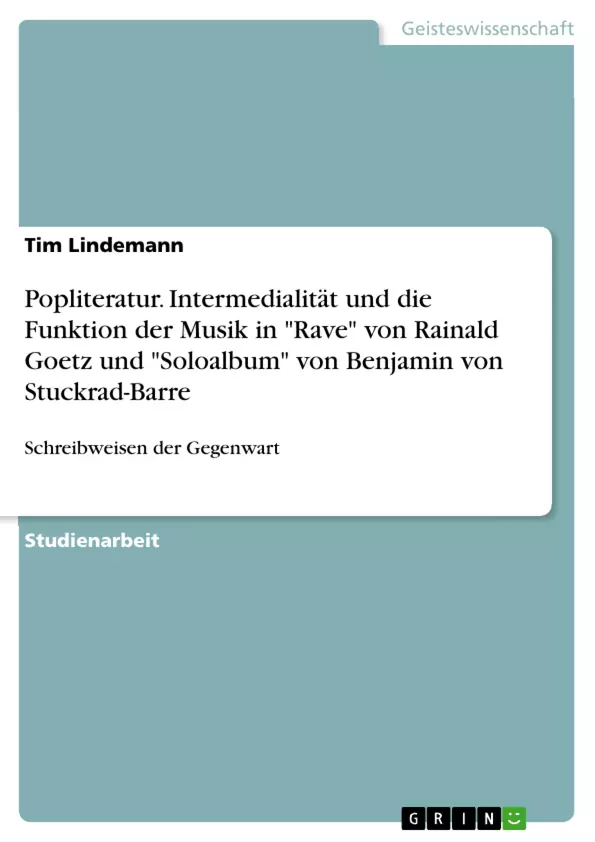Diese Arbeit setzt sich im Hinblick einer differenzierten Argumentation mit der Funktion von Musik innerhalb ausgewählter Werke der Popliteratur auseinander. Neben der Funktion der Musikreferenz soll beantwortet werden, auf welche Art und Weise Musik in der Popliteratur eingesetzt wird und ob die Verwendung innerhalb der Popliteratur einheitlich verläuft oder variiert.
In Kapitel eins werden Pop, Popliteratur und Intermedialität definiert. Im nächsten Schritt wird anhand des „Handbuch[s] für Literatur & Musik“ von Nicola Gess und Alexander Honold der aktuelle Forschungsstand von intermedialer Referenz von Musik in Literatur herausgestellt.
Besonders im Fokus stehen hier die Methoden des „showing“ und „telling“. Im Anschluss daran werden zwei der bedeutendsten Werke der Popliteratur auf diese Methoden der Intermedialität hin untersucht. „Soloalbum“ von Benjamin von Stuckrad-Barre und „Rave“ von Rainald Goetz werden als zwei Vertreter ihrer Gattung gegenübergestellt und in ihrer Verwendung hinsichtlich Musik verglichen.
Die Popliteratur ist eine moderne Literaturgattung, deren Ursprung in den 1950er Jahren liegt. Sie weist ein hohes Maß an Aktualität auf, da immer noch neue Werke ihrer bekanntesten Popautoren veröffentlicht werden. Die Popliteratur ist jedoch nur eine Teilströmung des Pop. Das wohl noch bekanntere und kommerziellere Medium des Pop ist die Popmusik. Die beiden Medien stehen jedoch nicht nur für sich allein, sondern werden oft intermedial zueinander referenziert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffliche Grundlagen
- Pop
- Popliteratur
- Intermedialität
- Intermediale Referenz von Musik in Literatur
- Telling
- Showing
- Untersuchung der Werke auf intermediale Referenz
- Fazit
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Funktion von Musik in der Popliteratur, indem sie die intermediale Referenz von Musik anhand der Werke "Rave" von Rainald Goetz und "Soloalbum" von Benjamin von Stuckrad-Barre untersucht. Die Arbeit zielt darauf ab, die unterschiedlichen Arten der Musikreferenz in der Popliteratur zu erforschen und die Verwendung von Musik in diesen beiden Werken zu vergleichen.
- Intermediale Referenz von Musik in Literatur
- Unterscheidung zwischen "Telling" und "Showing" in Bezug auf Musik
- Analyse der Musikreferenz in "Rave" und "Soloalbum"
- Vergleich der Verwendung von Musik in den beiden Werken
- Funktion von Musik in der Popliteratur
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel definiert die Begriffe Pop, Popliteratur und Intermedialität. Es stellt auch die ambivalenten Bedeutungen des Begriffs "Pop" dar, die sich als "Pop als Rebellion" und "Pop als Markt" unterscheiden lassen.
Kapitel zwei beschäftigt sich mit der intermedialen Referenz von Musik in Literatur und untersucht dabei die Methoden des "Telling" und "Showing". Das Kapitel analysiert, wie Musik in literarischen Texten dargestellt und erzählt wird.
In Kapitel drei werden die Werke "Soloalbum" von Benjamin von Stuckrad-Barre und "Rave" von Rainald Goetz auf die intermediale Referenz von Musik hin untersucht. Die Analyse konzentriert sich auf die Frage, wie Musik in diesen Werken eingesetzt wird und welche Funktion sie erfüllt.
Schlüsselwörter
Popliteratur, Intermedialität, Musikreferenz, "Telling", "Showing", "Rave", "Soloalbum", Benjamin von Stuckrad-Barre, Rainald Goetz.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt Musik in der Popliteratur?
Musik dient in der Popliteratur oft als intermediale Referenz, die sowohl zur Charakterisierung als auch zur Erzeugung einer bestimmten Atmosphäre genutzt wird.
Was ist der Unterschied zwischen "Showing" und "Telling" in Bezug auf Musik?
"Telling" beschreibt die bloße Erwähnung von Musikstücken, während "Showing" versucht, die Wirkung oder den Klang der Musik durch sprachliche Mittel unmittelbar erfahrbar zu machen.
Wie wird Musik in Rainald Goetz' "Rave" eingesetzt?
Die Arbeit untersucht, wie Goetz Musik nutzt, um das Lebensgefühl der Techno-Kultur darzustellen und welche intermedialen Techniken er dabei anwendet.
Was zeichnet die Musikreferenzen in Stuckrad-Barres "Soloalbum" aus?
In "Soloalbum" dient Musik oft als Identitätsmarker und emotionaler Anker für den Protagonisten, wobei die Arbeit die spezifische Funktion dieser Referenzen analysiert.
Wann entstand die Gattung der Popliteratur?
Die Ursprünge der Popliteratur liegen in den 1950er Jahren, wobei sie durch eine starke Aktualität und die Verbindung zu kommerziellen Medien wie der Popmusik geprägt ist.
- Quote paper
- Tim Lindemann (Author), 2019, Popliteratur. Intermedialität und die Funktion der Musik in "Rave" von Rainald Goetz und "Soloalbum" von Benjamin von Stuckrad-Barre, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/540682