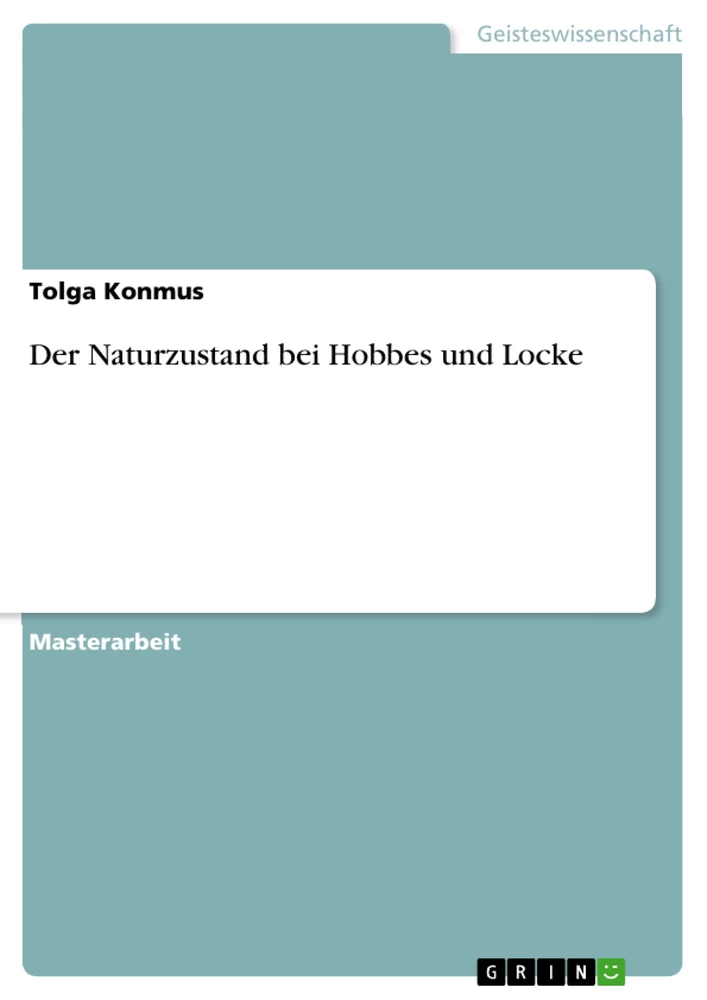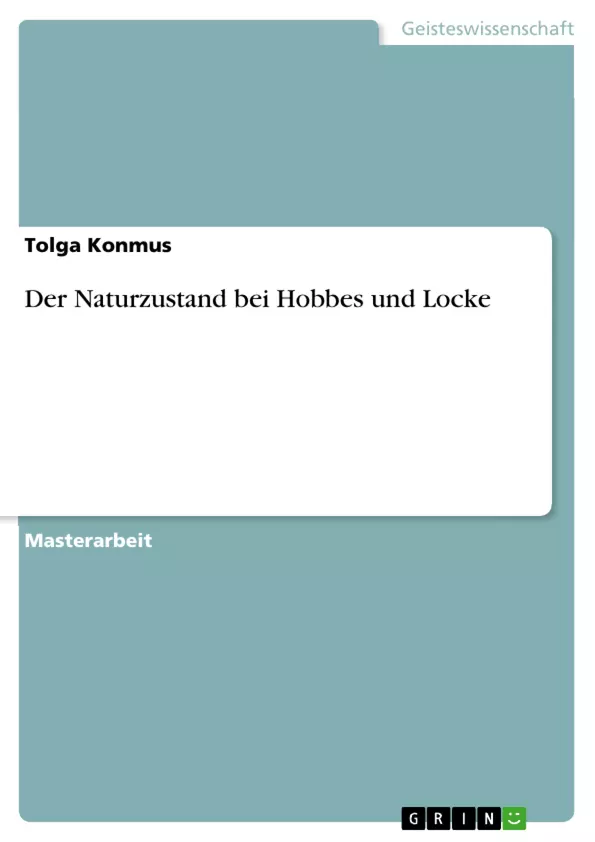Die vorliegende Arbeit analysiert und vergleicht die Darstellungen des Naturzustandes bei Thomas Hobbes und John Locke. Thomas Hobbes und John Locke sind Namen, denen man unweigerlich begegnet, sollte man sich mit dem Kontraktualismus auseinandersetzen. Diese zählen zu den Begründern der modernen Vertragstheorie, da beide dem neuzeitlichen philosophischen Denken ein unbestreitbares Fundament gelegt haben. Mit dem Naturzustand bedienen sich beide eines Instrumentes, das den Zweck hat, den Menschen vor der Etablierung einer staatlichen Ordnung darzustellen. In diesem Zustand wird der Mensch beschrieben, wie er in seinem natürlichen Wesen wirkt, und durch welche Mechanismen die Konstruktion eines Staates legitimiert werden kann. Somit sind beide Philosophen durch die Ambition, auf vertraglicher Basis die Legitimation politischer Herrschaft zu begründen, verbunden.
Trotz dieser Verbundenheit und vermeintlichen Ähnlichkeit, divergieren beide Philosophen drastisch sowohl in der Darstellung des natürlichen Wesens des Menschen, als auch in dem Begriff der Rechte, die diese im Naturzustand besitzen. Um einen Vergleich dieser beiden Konzepte nachvollziehbar und sinnvoll darzustellen, möchte ich mich in der vorliegenden Arbeit auf diese Elemente konzentrieren. Hierfür soll zuerst eine Darstellung der Elemente der jeweiligen Philosophen stattfinden, nach welcher ich einen fundierten Vergleich aufzustellen. Das Ziel hierbei ist, die Motive und die gedanklichen Ursprünge der Eigenheiten der jeweiligen Naturzustandsauffassungen herauszuarbeiten, um die Unterschiede zwischen dem Hobbesschen und Lockeschen Naturzustand deutlich aufzeigen zu können. Als Grundlage hierfür dient das Hauptwerk "Leviathan" von Thomas Hobbes und das Werk "Zweite Abhandlung über die Regierung" von John Locke. Zum Schluss möchte ich die prägnantesten Kontraste im Fazit zusammenfassend und vergleichend darstellen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Mensch im Naturzustand
- 2.1 Das Hobbessche Menschenbild
- 2.1.1 Die Konkurrenz
- 2.1.2 Das Misstrauen
- 2.1.3 Die Ruhmsucht
- 2.2 Das Lockesche Menschenbild
- 3. Der Begriff des Rechts
- 3.1 Der Begriff des Rechts bei Hobbes
- 3.2 Die natürlichen Gesetze bei Hobbes
- 3.3 Der Begriff des Rechts bei Locke
- 3.3.1 Der Begriff der Strafe und der Sanktion bei Locke
- 4. Der Kriegszustand
- 5. Das Eigentum
- 5.1 Vergleichende Diskussion des Eigentums bei Hobbes
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Vergleich des Naturzustands bei Thomas Hobbes und John Locke. Ziel ist es, die Motive und gedanklichen Ursprünge der Eigenheiten der jeweiligen Naturzustandsauffassungen herauszuarbeiten und die Unterschiede zwischen dem Hobbesschen und Lockeschen Naturzustand deutlich aufzuzeigen.
- Darstellung des Hobbesschen und Lockeschen Menschenbilds
- Analyse des Rechtsbegriffs bei Hobbes und Locke
- Untersuchung des Kriegszustands im Naturzustand
- Vergleich der Eigentumsauffassungen bei Hobbes und Locke
- Zusammenfassende Gegenüberstellung der Kontraste im Fazit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz der Naturzustands-Konzeption für die Vertragstheorie erläutert. Kapitel 2 widmet sich dem Menschenbild im Naturzustand. Hier werden die zentralen Elemente des Hobbesschen Menschenbilds, wie die Konkurrenz, das Misstrauen und die Ruhmsucht, sowie das Lockesche Menschenbild beleuchtet. In Kapitel 3 wird der Begriff des Rechts bei Hobbes und Locke behandelt, wobei die natürlichen Gesetze bei Hobbes und die Konzepte der Strafe und Sanktion bei Locke besondere Aufmerksamkeit erhalten. Kapitel 4 beleuchtet den Kriegszustand als Folge des Naturzustands bei Hobbes. Schließlich widmet sich Kapitel 5 dem Eigentum und stellt die unterschiedlichen Ansätze von Hobbes und Locke gegenüber.
Schlüsselwörter
Naturzustand, Vertragstheorie, Hobbes, Locke, Menschenbild, Recht, natürliche Gesetze, Kriegszustand, Eigentum, Kontraktualismus, politische Herrschaft, Legitimation.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der „Naturzustand“ in der Philosophie?
Ein Gedankenexperiment, das den Menschen ohne staatliche Ordnung beschreibt, um die Notwendigkeit und Legitimation eines Staates zu begründen.
Wie unterscheidet sich das Menschenbild bei Hobbes und Locke?
Hobbes sieht den Menschen als egoistisch und konkurrenzgetrieben („Krieg aller gegen alle“), während Locke den Menschen als vernunftbegabt und grundsätzlich friedlich betrachtet.
Welche Rolle spielt das Eigentum bei John Locke?
Für Locke ist Eigentum ein natürliches Recht, das bereits im Naturzustand durch Arbeit entsteht und vom Staat geschützt werden muss.
Was ist der „Leviathan“ bei Hobbes?
Der Leviathan ist der absolute Souverän, dem die Menschen per Vertrag ihre Macht übertragen, um Sicherheit und Frieden zu gewährleisten.
Warum schließen Menschen laut Locke einen Gesellschaftsvertrag?
Um ihre natürlichen Rechte (Leben, Freiheit, Eigentum) besser gegen gelegentliche Übergriffe und Unsicherheiten zu schützen.
- Quote paper
- Tolga Konmus (Author), 2019, Der Naturzustand bei Hobbes und Locke, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/541068