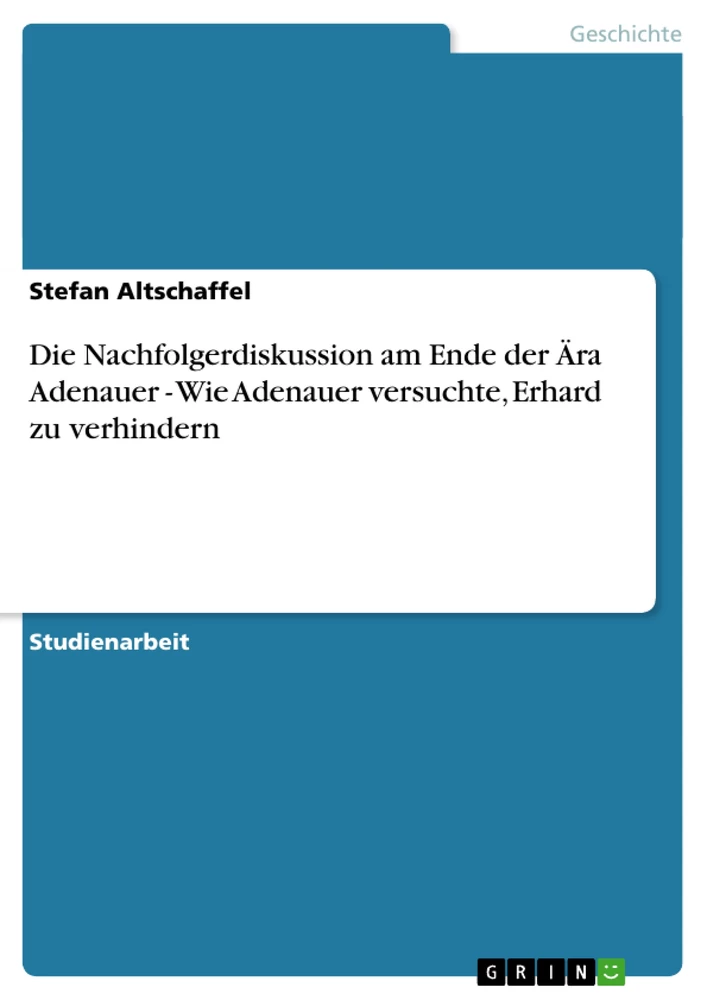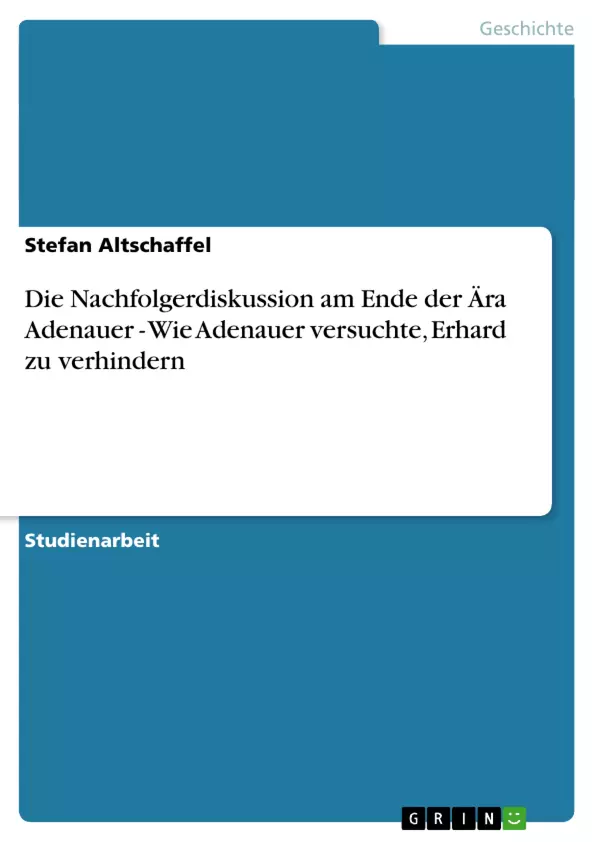Die letzten Jahre der Kanzlerschaft Konrad Adenauers waren geprägt von außen- und innenpolitischen Ereignissen, die eine enorme Herausforderung für die junge Demokratie und ihren weniger jungen Kanzler bedeuteten, und die teilweise ein baldiges Ende seiner Amtszeit vorausahnen ließen. Das Bewusstsein, dass Adenauer bereits ein Alter weit jenseits der damaligen durchschnittlichen Lebenserwartung – genau genommen sogar jenseits der heutigen - erreicht hatte, dürfte den meisten dabei klar gewesen sein. Es stellte sich daher die Frage, wer die schwere Bürde der Nachfolge des ersten Kanzlers antreten könnte. Erster Anwärter war seit der Bundestagswahl 1957 der Bundeswirtschaftsminister und frisch ernannte Vizekanzler Ludwig Erhard. Dennoch war letzterer als potenzieller Nachfolger im Amt des Bundeskanzlers nicht unumstritten. Insbesondere Adenauer, der Erhard für nicht geeignet hielt, dieses Amt kompetent zu bekleiden, ließ eine deutliche Widerstandshaltung gegen diesen erkennen.
Um die Entwicklungsphasen des Konflikts zwischen Adenauer und Erhard in Bezug auf die Nachfolge-Problematik genau zu beleuchten, sollen einige Ereignisse der letzten Jahre der Ära Adenauer untersucht werden. Den Konflikt von seiner Entstehung bis zur tatsächlichen Amtsübernahme durch Ludwig Erhard lückenlos zu beschreiben, würde sicherlich den Rahmen einer Seminararbeit sprengen. Daher können nur einzelne Aspekte in der Entwicklung der Nachfolgerfrage bearbeitet werden. Dabei soll es nicht das Ziel sein, lediglich deskriptiv zu schildern. Es soll vielmehr die Frage beantwortet werden, wie sich die Abneigung Adenauers gegenüber seinem Wirtschaftsminister äußerte, inwiefern sie begründet war, welche Alternativen denkbar waren, und wieso Erhard letztendlich doch die Nachfolge Adenauers antrat.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Präsidentschaftskrise 1959
- 2.1. Erhard als Präsidentschaftskandidat
- 2.2. Adenauer als Präsidentschaftskandidat
- 3. Wahlkampf und Regierungsbildung 1961
- 4. Die Folgen der „Spiegel“-Affäre
- 5. Der Kanzlerwechsel
- 6. Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Konflikt zwischen Konrad Adenauer und Ludwig Erhard bezüglich der Nachfolge Adenauers als Bundeskanzler. Ziel ist es, Adenauers Abneigung gegen Erhard zu beleuchten, die Gründe hierfür zu analysieren und alternative Szenarien zu betrachten. Die Arbeit konzentriert sich auf ausgewählte Ereignisse der späten Adenauer-Ära, um die Entwicklung der Nachfolgefrage nachzuvollziehen.
- Adenauers Widerstand gegen Erhards Kanzlerschaft
- Die Rolle der Präsidentschaftskrise 1959
- Der Einfluss der „Spiegel“-Affäre
- Mögliche Alternativen zur Erhard-Nachfolge
- Die letztendliche Amtsübernahme durch Erhard
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Nachfolge Adenauers ein und skizziert die Herausforderungen für die junge Bundesrepublik in den letzten Jahren seiner Kanzlerschaft. Sie erläutert die zentrale Fragestellung der Arbeit: Wie äußerte sich Adenauers Abneigung gegen Erhard, welche Gründe lagen ihr zugrunde, welche Alternativen gab es und warum wurde Erhard letztendlich Kanzler? Die Arbeit stützt sich auf die Werke von Koerfer und Hentschel sowie auf Adenauers Memoiren, wobei die subjektive Perspektive Adenauers im Fokus steht. Die Methode ist nicht rein deskriptiv, sondern analytisch.
2. Die Präsidentschaftskrise 1959: Dieses Kapitel behandelt die Präsidentschaftskrise 1959 als einen wichtigen Wendepunkt in der Nachfolgefrage. Es untersucht die Diskussion um eine mögliche Verlängerung der Amtszeit von Theodor Heuss und die damit verbundenen Überlegungen zur Kanzlernachfolge. Die Ablehnung Heuss' einer erneuten Kandidatur wird dargestellt, ebenso wie die ersten Anzeichen von Adenauers Widerstand gegen Erhard als potenziellen Nachfolger. Die Auseinandersetzung mit dieser Krise verdeutlicht frühzeitig Adenauers strategisches Vorgehen gegen Erhard.
Schlüsselwörter
Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, Kanzlernachfolge, Präsidentschaftskrise 1959, „Spiegel“-Affäre, Bundesrepublik Deutschland, Nachkriegspolitik, politische Strategien, Machtstrukturen.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Adenauer und Erhard – Die Kanzlernachfolge
Was ist der Gegenstand dieses Dokuments?
Das Dokument analysiert den Konflikt zwischen Konrad Adenauer und Ludwig Erhard bezüglich der Kanzlernachfolge in der Bundesrepublik Deutschland. Es untersucht Adenauers Abneigung gegen Erhard, die Gründe hierfür und alternative Szenarien zur Nachfolge.
Welche Zeitspanne wird behandelt?
Der Fokus liegt auf den letzten Jahren der Adenauer-Ära, insbesondere auf der Präsidentschaftskrise 1959 und der „Spiegel“-Affäre, die entscheidend für die Entwicklung der Nachfolgefrage waren.
Welche Ereignisse werden im Detail untersucht?
Das Dokument behandelt detailliert die Präsidentschaftskrise von 1959, den Wahlkampf und die Regierungsbildung von 1961, sowie die Folgen der „Spiegel“-Affäre. Diese Ereignisse werden als wichtige Wendepunkte in der Auseinandersetzung um die Kanzlernachfolge betrachtet.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Analyse basiert auf den Werken von Koerfer und Hentschel sowie auf Adenauers Memoiren. Der Ansatz ist nicht rein deskriptiv, sondern analytisch und berücksichtigt die subjektive Perspektive Adenauers.
Welche Schlüsselfragen werden behandelt?
Zentrale Fragen sind: Wie äußerte sich Adenauers Abneigung gegen Erhard? Welche Gründe lagen dieser Abneigung zugrunde? Welche Alternativen zur Erhard-Nachfolge gab es? Und warum wurde Erhard letztendlich Bundeskanzler?
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, Kanzlernachfolge, Präsidentschaftskrise 1959, „Spiegel“-Affäre, Bundesrepublik Deutschland, Nachkriegspolitik, politische Strategien, Machtstrukturen.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument enthält eine Einleitung, Kapitel zur Präsidentschaftskrise 1959 (mit Unterkapiteln zu Erhard und Adenauer als Präsidentschaftskandidaten), zum Wahlkampf und der Regierungsbildung 1961, zu den Folgen der „Spiegel“-Affäre, zum Kanzlerwechsel und Schlussbetrachtungen.
Wo finde ich eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Das Dokument beinhaltet eine detaillierte Zusammenfassung jedes Kapitels, die die wichtigsten Punkte und Ergebnisse der jeweiligen Analyse zusammenfasst.
Für welche Zielgruppe ist dieses Dokument bestimmt?
Das Dokument richtet sich an Leser, die sich akademisch mit der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland und der Politik der Nachkriegszeit befassen. Es ist insbesondere für Wissenschaftler und Studenten relevant.
- Quote paper
- Stefan Altschaffel (Author), 2005, Die Nachfolgerdiskussion am Ende der Ära Adenauer - Wie Adenauer versuchte, Erhard zu verhindern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/54115