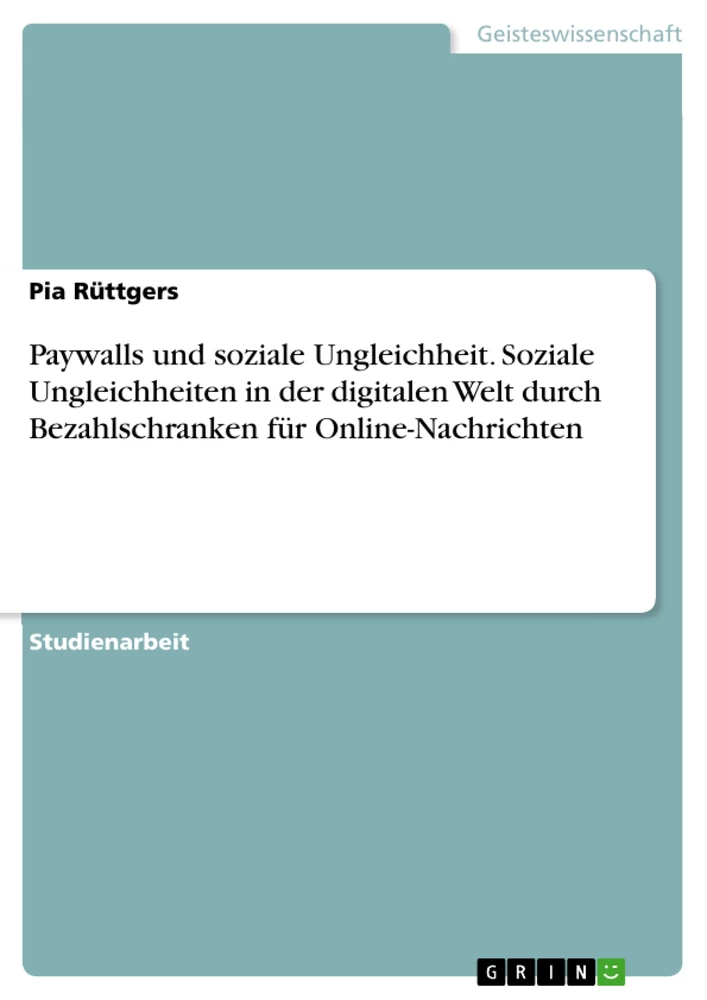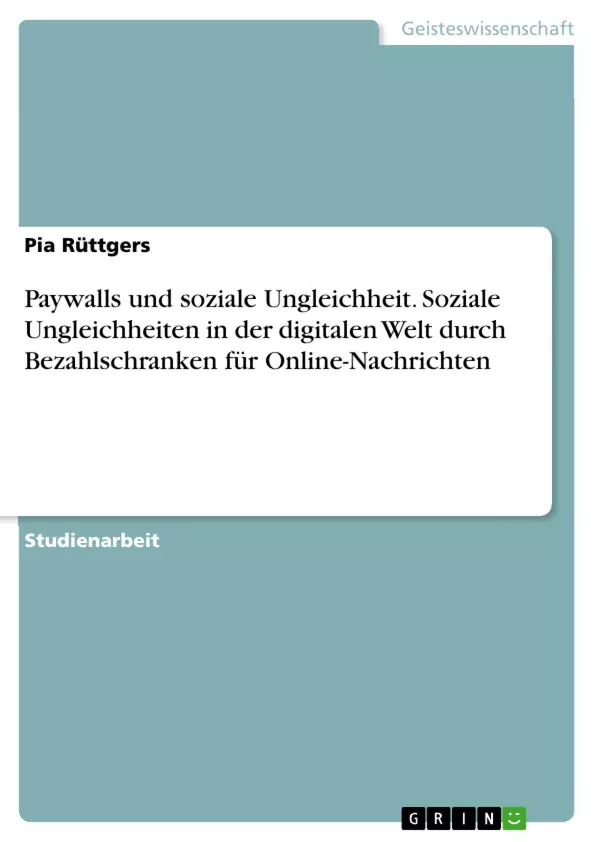In letzter Zeit wird die Legitimität von Bezahlschranken für Online-Nachrichten in Deutschland diskutiert. Aus soziologischer Perspektive erscheint das Argument, Bezahlschranken würden sozialstrukturelle Ungleichheiten verstärken, bemerkenswert.
In der Arbeit soll dieses Argument kritisch geprüft werden. Zunächst wird eine geeignete Perspektive zur Beurteilung der Paywall-Debatte erarbeitet. Anschließend werden Paywalls anhand der vorhergehenden Erkenntnisse und mit Blick auf einschlägige empirische Befunde einer kritischen Prüfung unterzogen. Im Zuge gesamtgesellschaftlicher Entwicklungen, die unter den Begriff Digitalisierung gefasst werden, hat sich der "Digital Divide" als mehrdimensionales Konzept zur Beschreibung und Erklärung sozialer Ungleichheiten einer digitalisierten Welt etabliert. Die Unterscheidung zwischen den Ebenen des Zugangs, der Nutzung/ Verwendung und der Rezeption (und Produktion) wird für eine sinnvolle Gliederung dieser Arbeit übernommen.
Eine Annäherung an strukturelle Ungleichheiten erfolgt anhand der Befunde zur Zahlungsbereitschaft von Nutzern für Online-Nachrichten. Barrieren-Effekte können auf dieser Grundlage nur vermutet werden. Daher werden Paywalls anschließend mithilfe des Access-Modells untersucht. Darüber hinaus werden Befunde der Rezeption von Online-Angeboten unter besonderer Berücksichtigung der Nachrichten-Dimension in den Blick genommen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Hintergrund
- 1.1. Relevanz, Verbreitung und Finanzierung von Online-Nachrichten
- 1.2. soziale Ungleichheit und Digitalisierung
- 1.2.1. Digital Divide global, sozial und demokratiscch
- 1.2.2. Digital Divide - Zugangs- und Nutzungsbarrieren
- 1.2.3. Barrieren der digitalen Produktion - (digitale) Teilhabechancen
- 2. Die Paywall-Debatte
- 2.1. Die Forderung nach „Informationsgleichheit“
- 2.2. Soziale Ungleichheiten des binären Nutzens und der Zahlungsbereitschaft
- 2.3. Soziale Ungleichheiten des Zugangs
- 2.4. Soziale Ungleichheit einer effektiven Nutzung
- 2.5. Soziale Ungleichheit der Rezeption - Zeit und Wissen macht den Unterschied
- 2.6. Jenseits der Schranken: Die Paywall-Debatte als Stellvertreterdebatte über Herausforderungen einer digitalen Öffentlichkeit
- 3. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, ob Paywalls für Online-Nachrichten soziale Ungleichheiten verstärken. Sie analysiert die Paywall-Debatte aus soziologischer Perspektive und untersucht die Relevanz von Online-Nachrichten und Paywalls im Kontext des „Digital Divide“.
- Relevanz und Verbreitung von Online-Nachrichten
- Finanzierung von Online-Nachrichten und Paywalls
- Das Konzept des „Digital Divide“ als mehrdimensionales Modell zur Erklärung sozialer Ungleichheiten im digitalen Raum
- Analyse der Paywall-Debatte im Hinblick auf strukturelle Ungleichheiten
- Bewertung der Auswirkungen von Paywalls auf den Zugang, die Nutzung und die Rezeption von Online-Nachrichten
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Paywalls und soziale Ungleichheit im Kontext von Online-Nachrichten ein. Sie stellt die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit dar.
- 1. Hintergrund: Dieses Kapitel liefert den theoretischen Rahmen für die Analyse. Es beleuchtet die Relevanz von Online-Nachrichten und Paywalls aus Anbieter- und Nutzerperspektive. Des Weiteren werden zentrale Dimensionen des „Digital Divide“ erörtert.
- 1.1. Relevanz, Verbreitung und Finanzierung von Online-Nachrichten: In diesem Unterkapitel werden die Bedeutung von Online-Nachrichten in der deutschen Medienlandschaft sowie verschiedene Finanzierungsmodelle und Paywall-Varianten beleuchtet.
- 1.2. soziale Ungleichheit und Digitalisierung: Dieses Unterkapitel beschäftigt sich mit dem Konzept des „Digital Divide“ und seinen verschiedenen Dimensionen, die für die Analyse der Paywall-Debatte relevant sind.
- 2. Die Paywall-Debatte: Dieses Kapitel analysiert die Paywall-Debatte im Hinblick auf soziale Ungleichheiten. Es beleuchtet die Argumentation der „Informationsgleichheit“ und untersucht die Auswirkungen von Paywalls auf die Zahlungsbereitschaft, den Zugang, die Nutzung und die Rezeption von Online-Nachrichten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Online-Nachrichten, Paywalls, soziale Ungleichheit, Digital Divide, Informationsgleichheit, Zahlungsbereitschaft, Zugang, Nutzung und Rezeption im digitalen Raum. Sie analysiert die Paywall-Debatte aus soziologischer Perspektive und untersucht die Auswirkungen von Paywalls auf verschiedene Ebenen der digitalen Teilhabe.
- Quote paper
- Pia Rüttgers (Author), 2020, Paywalls und soziale Ungleichheit. Soziale Ungleichheiten in der digitalen Welt durch Bezahlschranken für Online-Nachrichten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/541376