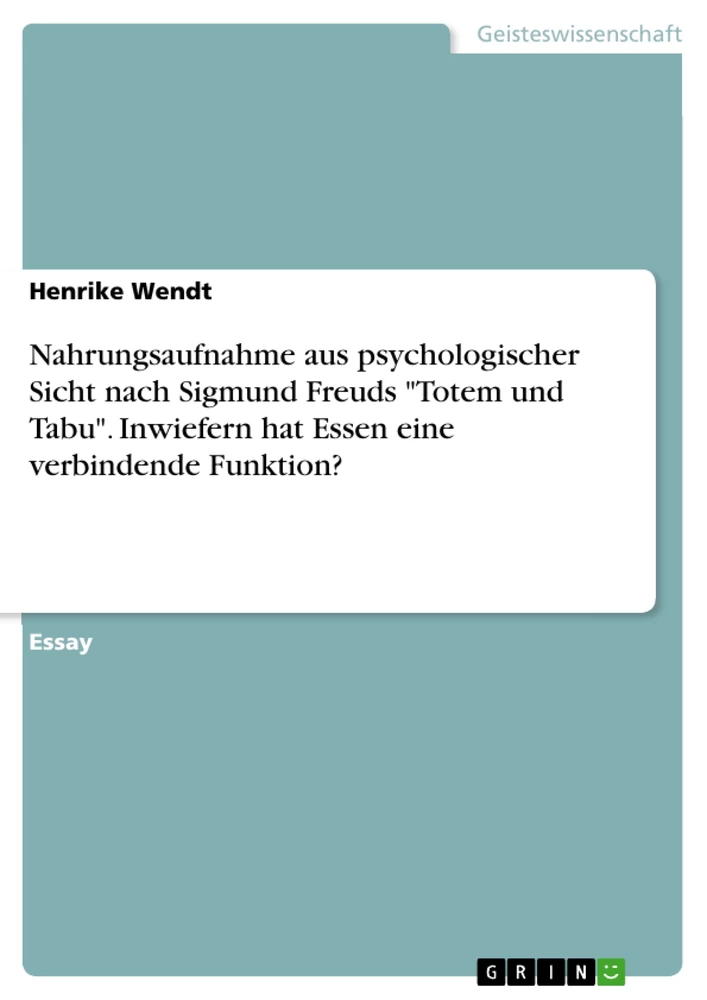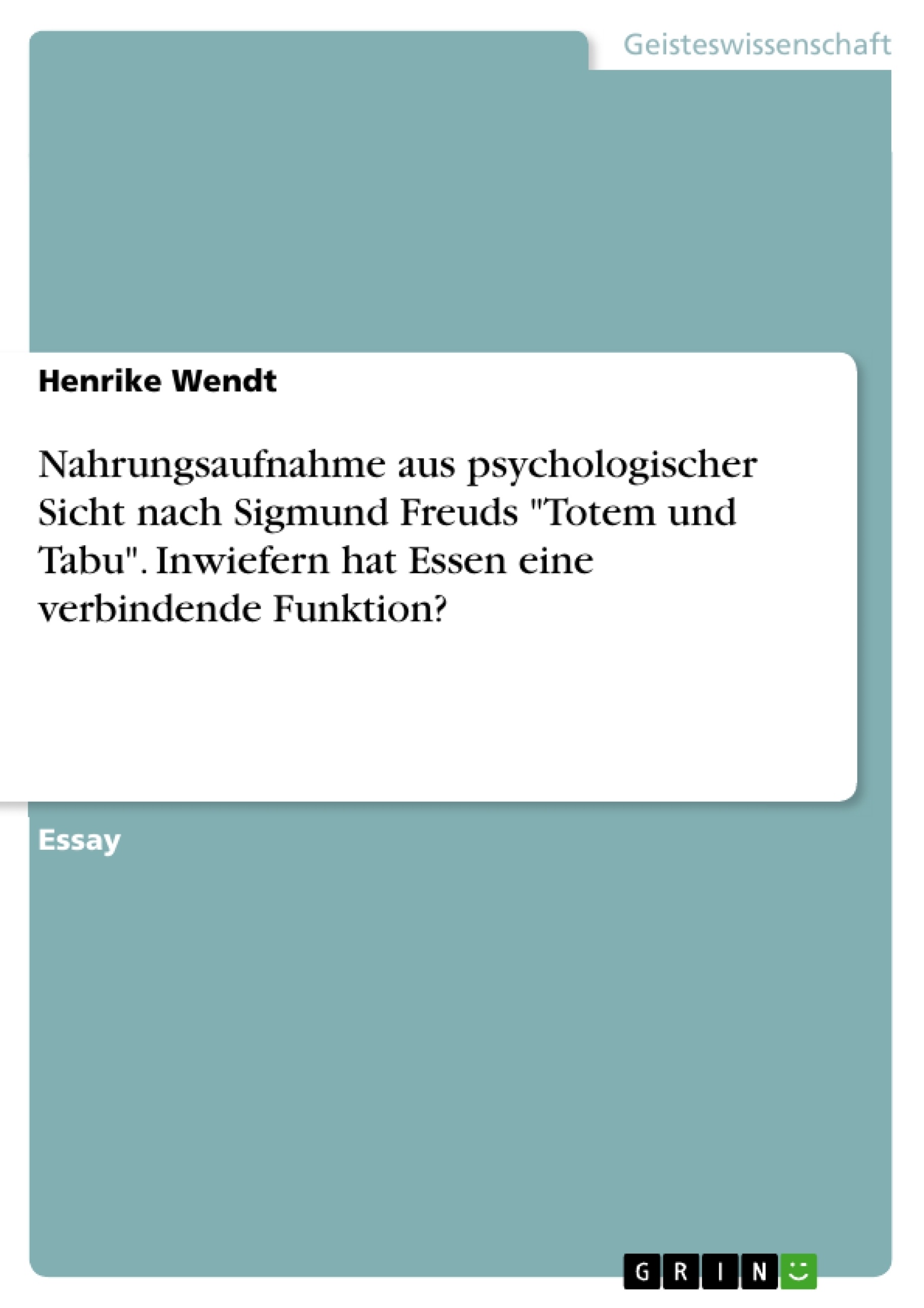Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, inwiefern und weshalb die Nahrungsaufnahme in psychologischer Hinsicht eine verbindende Funktion hat. Groß, klein, mit braunen oder blauen Augen, buddhistisch, atheistisch, sportlich, gemütlich, egozentrisch, altruistisch, optimistisch oder pessimistisch: Einzeln betrachtet können Menschen unterschiedlicher nicht sein. Doch entgegen der Diversität lassen sich Gemeinsamkeiten erkennen, die die Menschheit verbindet. Um zu überleben müssen die Grundbedürfnisse erfüllt sein. Jeder Mensch muss mit Nahrung, Sauerstoff, Schlaf und Liebe versorgt werden, sowie die Nahrung wieder ausscheiden. Auffällig ist, dass das Bedürfnis nach Nahrungsaufnahme oftmals in (größerer) Gesellschaft erfüllt wird, während den anderen Bedürfnissen hingegen allein oder zu zweit nachgegangen wird.
Dass das Bedürfnis nach Sauerstoff lediglich erfüllbar in Einzelarbeit ist, ist physiologisch erklärbar und liegt auf der Hand. Zudem ist das Atmen keine aktive Handlung, sondern ein Reflex und wird somit unbewusst – selbst im Schlaf – durchgeführt, im Gegensatz zur Nahrungsaufnahme, die eine aktive und meist bewusste Tätigkeit ist. Schlafgewohnheiten werden von Menschen sehr unterschiedlich gehandhabt. Während viele Menschen, besonders die mit leichtem Schlaf gerne allein nächtigen, erfüllen sich wiederum andere dieses Bedürfnis in Gesellschaft. Oftmals sind dies paarweise oder Eltern-mit-Kind- Konstellationen.
Der Sinn dieses gemeinschaftlichen Schlafes liegt in der Erfüllung des Sicherheitsbedürfnisses, sodass der zweite Schläfer eine passive Schutzfunktion einnehmen kann. Das Bedürfnis nach Sicherheit ist jedoch im Gegensatz zur Nahrungsaufnahme ein Sekundärbedürfnis Ein weiterer wichtiger Effekt ist der der Festigung von Beziehungen durch körperliche Nähe. Da Säuglinge ohne liebevolle menschliche Begegnungen nicht lebensfähig sind, wird auch das Bedürfnis nach Liebe zu den Grundbedürfnissen gezählt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Erkenntnisinteresse
- Abgrenzung zu anderen Primärbedürfnissen
- Geschichte der Nahrungsaufnahme in Gesellschaft
- Sinnesübergreifend
- Unterschiedliche Geschmäcker
- Essen in Gesellschaft im Alterungsprozess
- Bedürfniserfüllung und Nichterfüllung in Gesellschaft
- Konsumverhalten und gesellschaftliche Akzeptanz
- Sinnerweiternde Lebensmittel
- Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die verbindende Funktion der Nahrungsaufnahme im Hinblick auf psychologische Aspekte. Sie beleuchtet die Gemeinsamkeiten des menschlichen Zusammenlebens anhand eines grundlegenden Bedürfnisses und setzt dies in Relation zu anderen Primärbedürfnissen. Im Mittelpunkt steht die Frage, warum und inwiefern Essen eine gesellschaftlich so bedeutende Rolle spielt.
- Vergleich der Nahrungsaufnahme mit anderen Primärbedürfnissen (Sauerstoff, Schlaf, Liebe).
- Historische Entwicklung der gemeinsamen Nahrungsaufnahme in verschiedenen Kulturen.
- Die Rolle der Sinne beim Essen und die Transformation der Nahrungsaufnahme von reiner Bedürfnisbefriedigung zu einem Genusserlebnis.
- Der Einfluss sozialer Strukturen und Hierarchien auf Essgewohnheiten.
- Gesellschaftliche Akzeptanz von Essverhalten und Konsummustern.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung und Erkenntnisinteresse: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der verbindenden Funktion der Nahrungsaufnahme aus psychologischer Perspektive. Sie verweist auf die Gemeinsamkeiten der Menschheit trotz individueller Unterschiede und hebt die Nahrungsaufnahme als ein Bedürfnis hervor, das häufig in Gesellschaft befriedigt wird, im Gegensatz zu anderen Grundbedürfnissen wie Atmen oder Schlafen. Die Arbeit beabsichtigt, diese Diskrepanz zu untersuchen.
Abgrenzung zu anderen Primärbedürfnissen: Dieses Kapitel differenziert die Nahrungsaufnahme von anderen Primärbedürfnissen wie Atmen, Schlafen und dem Bedürfnis nach Liebe. Während Atmen ein unbewusster Reflex ist, ist die Nahrungsaufnahme eine bewusste Handlung. Schlafgewohnheiten variieren stark, wobei gemeinschaftliches Schlafen oft mit dem Sicherheitsbedürfnis in Verbindung gebracht wird. Liebe hingegen kann sowohl alleine als auch in Gesellschaft erfahren werden. Im Gegensatz zur Nahrungsaufnahme, die gesellschaftlich zelebriert wird, wird die Ausscheidung meist allein vollzogen – ein spannender sozialer Kontrast.
Geschichte der Nahrungsaufnahme in Gesellschaft: Das Kapitel beleuchtet die lange Geschichte der gemeinschaftlichen Nahrungsaufnahme, beginnend mit den Neandertalern. Die gemeinsame Jagd und Nahrungssuche waren überlebensnotwendig und führten zu einem stärkeren Gruppenzusammenhalt. Die Nahrungsaufnahme bildete den Höhepunkt des Tages und ermöglichte eine größere Nährstoffvielfalt. Die Entwicklung der Landwirtschaft und Sesshaftigkeit brachte Veränderungen, aber die gemeinsame Mahlzeit blieb ein zentraler sozialer Akt, der in verschiedenen Kulturen (Maya, Wikinger, Römer) unterschiedliche soziale Hierarchien widerspiegelte, jedoch auch gemeinsame, übergreifende Rhythmen aufwies. Religiöse Rituale, wie die Totemmahlzeiten, unterstrichen die verbindende Funktion des Essens.
Sinnesübergreifend: Im Gegensatz zu anderen Bedürfnissen wird die Nahrungsaufnahme mit allen Sinnen – Sehen, Riechen, Tasten, Hören und Schmecken – erlebt. Das Kapitel betont die multisensorische Natur des Essens und wie diese Sinneserfahrung die reine Bedürfnisbefriedigung zu einem Genusserlebnis erhebt. Die Kombination von Geruch und Geschmack ist besonders wichtig für das volle Geschmackserlebnis. Dieser multisensorische Aspekt unterscheidet die Nahrungsaufnahme deutlich von der Befriedigung anderer Grundbedürfnisse.
Schlüsselwörter
Nahrungsaufnahme, Primärbedürfnisse, Gesellschaft, Psychoanalyse, Gemeinschaftsgefühl, soziale Strukturen, Kulturgeschichte, Sinneswahrnehmung, Genusserlebnis, Überleben, Zusammenhalt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Die Verbindende Funktion der Nahrungsaufnahme
Was ist das zentrale Thema des Textes?
Der Text untersucht die verbindende Funktion der Nahrungsaufnahme in Gesellschaft aus psychologischer Perspektive. Er beleuchtet, warum und inwiefern Essen eine so bedeutende gesellschaftliche Rolle spielt und vergleicht dies mit anderen Primärbedürfnissen.
Welche Aspekte der Nahrungsaufnahme werden behandelt?
Der Text behandelt verschiedene Aspekte der Nahrungsaufnahme, darunter die Abgrenzung zu anderen Primärbedürfnissen (Schlaf, Atmung, Liebe), die historische Entwicklung gemeinschaftlicher Mahlzeiten in verschiedenen Kulturen, die Rolle der Sinne beim Essen, den Einfluss sozialer Strukturen und Hierarchien auf Essgewohnheiten sowie die gesellschaftliche Akzeptanz von Essverhalten und Konsummustern.
Wie wird die Nahrungsaufnahme mit anderen Primärbedürfnissen verglichen?
Der Text vergleicht die Nahrungsaufnahme mit anderen Primärbedürfnissen wie Atmen und Schlafen. Während Atmen ein unbewusster Reflex ist und Schlafgewohnheiten stark variieren, ist die Nahrungsaufnahme eine bewusste Handlung, die oft in Gesellschaft zelebriert wird, im Gegensatz zur meist allein vollzogenen Ausscheidung.
Welche Rolle spielt die Geschichte der Nahrungsaufnahme?
Der Text beleuchtet die historische Entwicklung der gemeinschaftlichen Nahrungsaufnahme, von den Neandertalern über die Entwicklung der Landwirtschaft bis hin zu modernen Gesellschaften. Gemeinsames Essen diente dem Überleben, stärkte den Gruppenzusammenhalt und spiegelte soziale Hierarchien wider.
Welche Bedeutung haben die Sinne beim Essen?
Der Text betont die multisensorische Natur des Essens. Die Nahrungsaufnahme wird mit allen Sinnen (Sehen, Riechen, Tasten, Hören, Schmecken) erlebt, wodurch die reine Bedürfnisbefriedigung zu einem Genusserlebnis erhoben wird.
Wie beeinflussen soziale Strukturen das Essverhalten?
Der Text untersucht den Einfluss sozialer Strukturen und Hierarchien auf Essgewohnheiten und die gesellschaftliche Akzeptanz von Essverhalten und Konsummustern.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text umfasst Kapitel zu Einleitung und Erkenntnisinteresse, Abgrenzung zu anderen Primärbedürfnissen, Geschichte der Nahrungsaufnahme in Gesellschaft, Sinnesübergreifender Aspekt des Essens, Unterschiedliche Geschmäcker, Essen in Gesellschaft im Alterungsprozess, Bedürfniserfüllung und -nichterfüllung in Gesellschaft, Konsumverhalten und gesellschaftliche Akzeptanz, Sinnerweiternde Lebensmittel und Zusammenfassung und Fazit.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind: Nahrungsaufnahme, Primärbedürfnisse, Gesellschaft, Psychoanalyse, Gemeinschaftsgefühl, soziale Strukturen, Kulturgeschichte, Sinneswahrnehmung, Genusserlebnis, Überleben, Zusammenhalt.
Wo finde ich eine detaillierte Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Der Text enthält eine detaillierte Zusammenfassung jedes Kapitels, welche die zentralen Aussagen und Argumentationslinien jedes Abschnitts zusammenfasst.
- Quote paper
- Henrike Wendt (Author), 2019, Nahrungsaufnahme aus psychologischer Sicht nach Sigmund Freuds "Totem und Tabu". Inwiefern hat Essen eine verbindende Funktion?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/542392