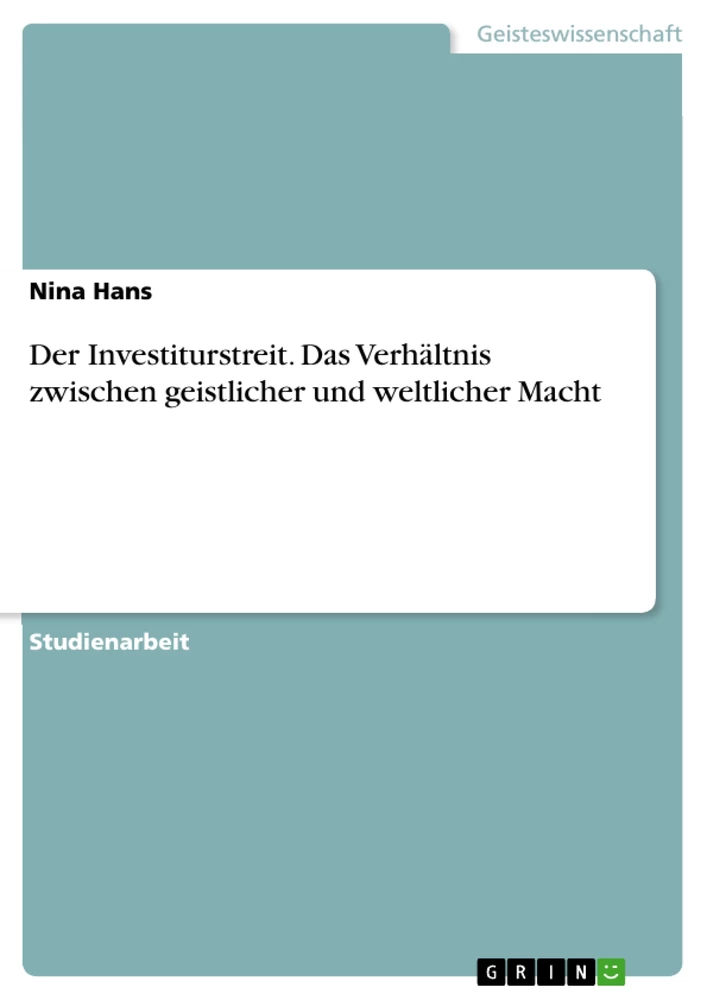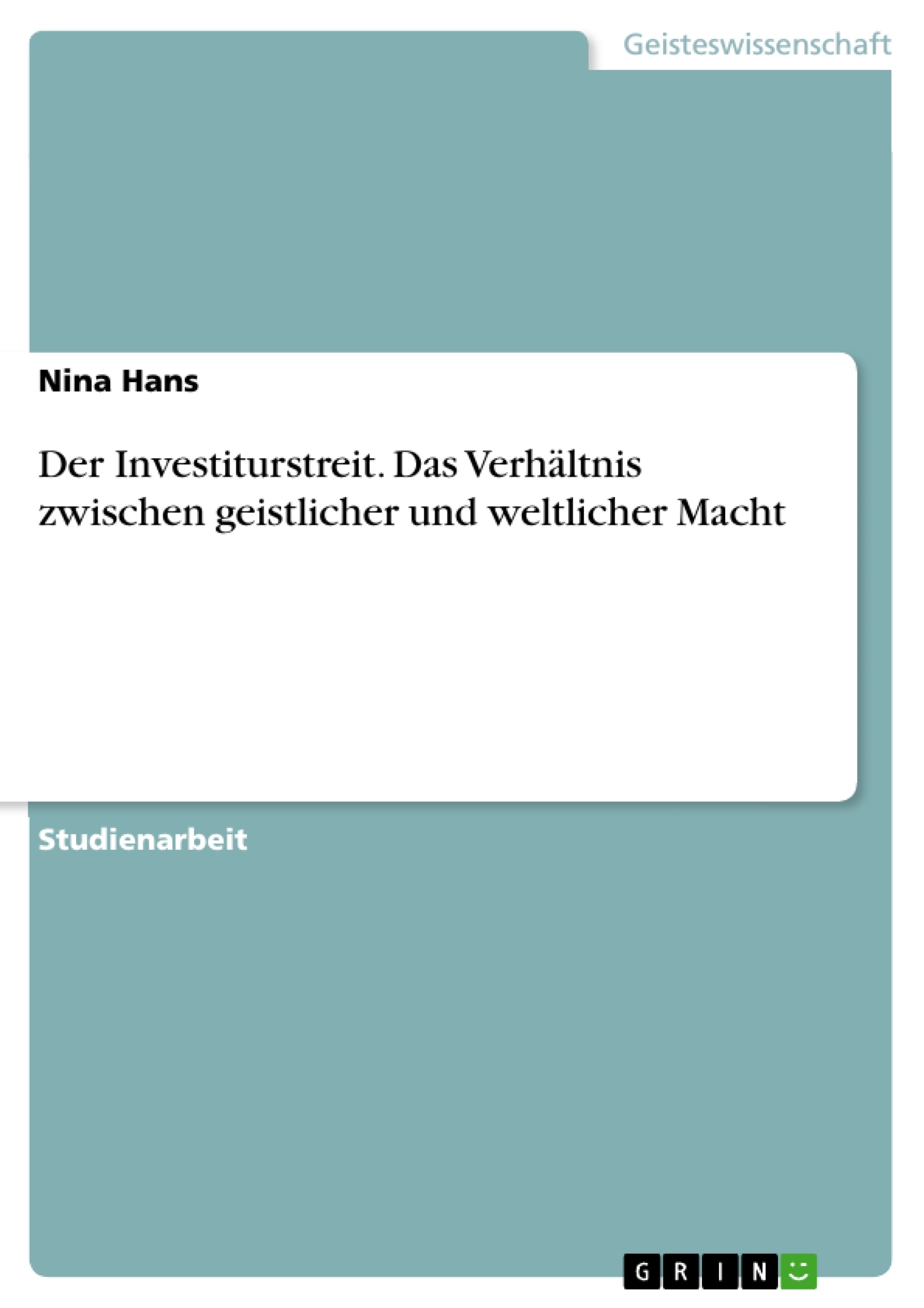Im 11. Jahrhundert wurden von der Kirchenreform drei Ziele angestrebt. Dazu zählten die Bekämpfung der Simonie, die Verringerung der Autorität von Laien im Bereich der Kirche sowie die Behauptung des Zölibats. Wichtig zu erwähnen ist hierbei, dass bereits seit dem 10. Jahrhundert der Gedanke der Kirchenfreiheit mit der Abfertigung von Simonie assoziiert wurde. Das Verbrechen, welches im folgenden Text kurz angesprochen wird, hatte als Strafe die Exkommunikation zur Folge.
Diese Idee stammt von Papst Gregor dem Großen, welcher 590 bis 604 im Amt war. Dieser diente einige Jahre später als eines der Vorbilder von Papst Gregor VII., welcher dieselbe Ansicht vertrat. Zu den Eigenschaften der römischen Kirche verfasste er im Jahre 1075 ein Diktat, welches als "Dictatus Papae" bekannt wurde. Dieses bildet ein wichtiges Fundament für die Beziehung zwischen Kirche und Staat, da hier die Meinung von Gregor VII. niedergeschrieben ist. Durch Provokationen vonseiten des Königs kommt es schließlich zum bekannten Investiturstreit, welcher die damalige und heutige Gesellschaft prägt.
Die Forschungslage über das Verhältnis von geistlicher und weltlicher Macht ist einheitlich und weist kaum Kontroverse auf. Bischof und Goez untersuchen das Verhältnis, indem sie auf die Zweischwerterlehre verweisen. Laut Hartmann entwickelt sich das zunächst freundschaftliche Verhältnis zu einem Negativen, was von Jedin bestärkt wird. Bagliani und Frank gehen nicht explizit auf die Beziehung der beiden Gewalten ein.
Um das genannte Thema genauer zu untersuchen, wird im Folgenden zunächst auf die Person Gregor VII. eingegangen, um dessen Werdegang besser nachvollziehen zu können. Im Anschluss daran wird der "Dictatus Papae" als Quelle verwendet und in Beziehung zum Verhältnis der beiden Mächte gesetzt. Danach folgt eine Diskussion über die Absichten des Diktats. Daraufhin wird der Verlauf des Investiturstreits umschrieben, damit man nachvollziehen kann, wie sich die Beziehung von Sacerdotium und Imperium entwickelte. Daran knüpft dann der letzte Punkt an, welcher sich ausschließlich mit dem eigentlichen Element, nämlich das Verhältnis zwischen geistlicher und weltlicher Macht, beschäftigt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Investiturstreit
- Gregor VII.
- Zur Person
- Der Dictatus Papae
- Entstehung und Verlauf unter Gregor VII. und Heinrich IV.
- Das Verhältnis von geistlicher und weltlicher Macht
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text beleuchtet den Investiturstreit, einen historischen Konflikt zwischen Papst Gregor VII. und Kaiser Heinrich IV. im 11. Jahrhundert, der um die Machtverteilung zwischen geistlicher und weltlicher Autorität kreiste. Der Fokus liegt auf der Analyse des Verhältnisses zwischen Kirche und Staat, insbesondere im Kontext der Kirchenreform des 11. Jahrhunderts. Der Text untersucht, wie der Streit entstand, welche Positionen von den Protagonisten eingenommen wurden und welche Auswirkungen der Konflikt auf die damalige und heutige Gesellschaft hat.
- Die Kirchenreform des 11. Jahrhunderts und ihre Ziele
- Die Person Gregor VII. und seine Rolle im Investiturstreit
- Der Dictatus Papae und seine Bedeutung für das Verhältnis von Papsttum und Kaisertum
- Der Verlauf des Investiturstreits
- Das Verhältnis von geistlicher und weltlicher Macht im 11. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung stellt die Kirchenreform des 11. Jahrhunderts und ihre drei Hauptziele vor: die Bekämpfung der Simonie, die Reduzierung des Einflusses von Laien in der Kirche und die Durchsetzung des Zölibats. Sie führt den Begriff der Kirchenfreiheit ein und verweist auf die Rolle des Papstes Gregor dem Großen in der Entwicklung dieser Idee.
2. Investiturstreit
2.1 Gregor VII.
2.1.1 Zur Person
Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über das Leben von Gregor VII. (Hildebrand), einschließlich seiner frühen Jahre, seiner Rolle in der Kirchenverwaltung und seiner Ernennung zum Papst. Er beleuchtet auch die unterschiedlichen Meinungen der Historiker über sein Geburtsdatum und seine Herkunft.
2.1.2 Der Dictatus Papae
Der Text bespricht den Dictatus Papae, eine Sammlung von 27 Sätzen, die von Gregor VII. verfasst wurde. Der Dictatus Papae präsentiert die Sonderrechte und Aufgaben der römischen Kirche, darunter die Unfehlbarkeit des Papstes und dessen Autorität über die weltliche Macht. Er beleuchtet die Kontroversen um die Absichten des Dictatus Papae und die unterschiedlichen Interpretationen seines Inhalts.
2.2 Entstehung und Verlauf unter Gregor VII. und Heinrich IV.
Dieser Abschnitt beschreibt die Entstehung und den Verlauf des Investiturstreits zwischen Gregor VII. und Heinrich IV. und beleuchtet die Konflikte und Ereignisse, die zu dem Streit führten.
2.3 Das Verhältnis von geistlicher und weltlicher Macht
Dieser Abschnitt untersucht das Verhältnis von geistlicher und weltlicher Macht im 11. Jahrhundert, insbesondere im Kontext des Investiturstreits. Er diskutiert die unterschiedlichen Auffassungen von Kirche und Staat in dieser Zeit und die Folgen des Konflikts.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter des Textes sind: Investiturstreit, Kirchenreform, Gregor VII., Heinrich IV., Dictatus Papae, geistliche Macht, weltliche Macht, Sacerdotium, Regnum, Simonie, Zölibat, Kirchenfreiheit, Papsttum, Kaisertum.
- Arbeit zitieren
- Nina Hans (Autor:in), 2017, Der Investiturstreit. Das Verhältnis zwischen geistlicher und weltlicher Macht, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/544355