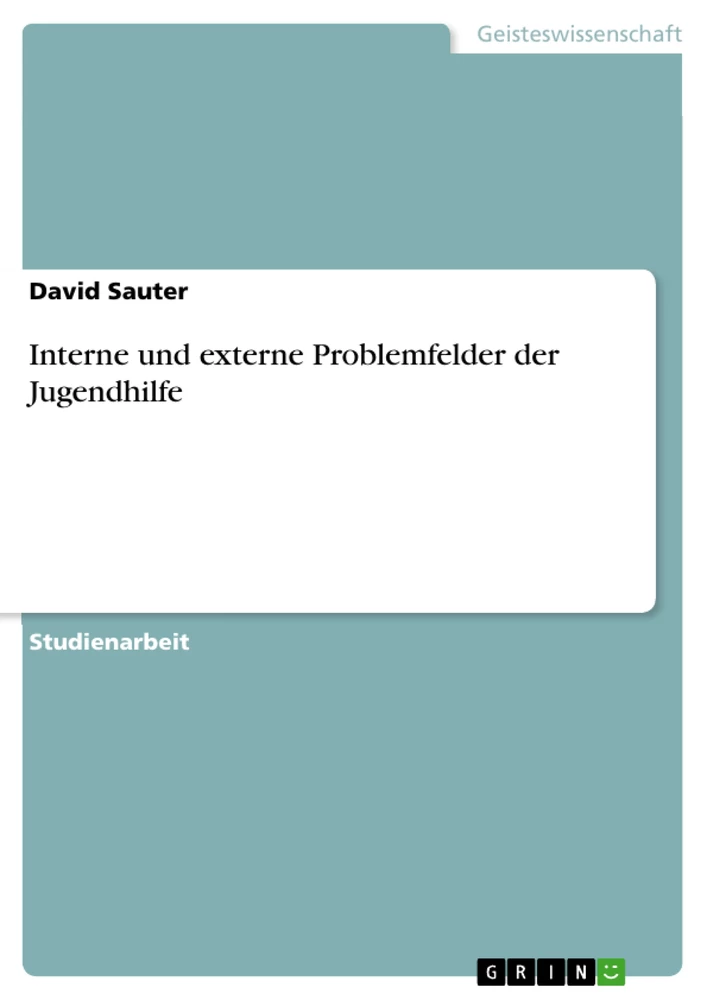Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den internen und externen Problemfeldern der Jugendhilfe. Dabei geht sie auch auf verschiedene Akteure und die Aufgaben und Ziele der Jugendhilfe ein.
Aus den Erkenntnissen und Ergebnissen aus dem Achten Jugendbericht der Bundesregierung 1990 rückte der Begriff der Lebensweltorientierung als damals neues Ziel in der Jugendhilfe in den Mittelpunkt. Um dies zu garantieren, wurden Standards für die ganzheitliche und effektive Aufgabenerfüllung der Jugendhilfe festgelegt - die sogenannten fünf Strukturmaximen. Dazu gehören die Prävention, Regionalisierung, Alltagsorientierung, Partizipation und Integration. Die Prävention orientiert sich an der Unterstützung zur Lebensbewältigung und an normalen, lebenswerten Maßstäben. Dezentralisierung/Regionalisierung meint örtliche Hilfe- und Förderungssysteme.
Inhaltsverzeichnis
1. Definitionen
1.1 Jugendhilfe
1.2 Erziehungsberatung
2. Akteure
2.1 Allgemein
2.2 Träger der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe
2.3 Träger der freien Kinder- und Jugendhilfe
3. Aufgaben
3.1 Allgemein
3.2 Fünf Aufgabenbereiche
3.3 Aufgaben der öffentlichen und freien Träger
4. Ziele
4.1 Allgemein
4.2 Strukturmaximen
5. Problemfelder der Jugendhilfe
5.1 Interne Probleme
5.1.1 Berufliche Ausgangslage und Rahmenbedingungen
5.1.2 Verwaltung
5.1.3 Innovation
5.1.4 Inklusion und Partizipation
5.1.5 Finanzen
5.2 Externe Probleme
5.2.1 Gesetz
5.2.2 Wirtschaft
5.2.3 Armut
5.2.4 Demografie
5.2.5 Interkulturalität und Internationalisierung
5.2.6 Mediatisierung
5.3 Problemfelder der Erziehungsberatung
5.3.1 Interne Probleme
5.3.2 Externe Probleme
Literaturverzeichnis
-
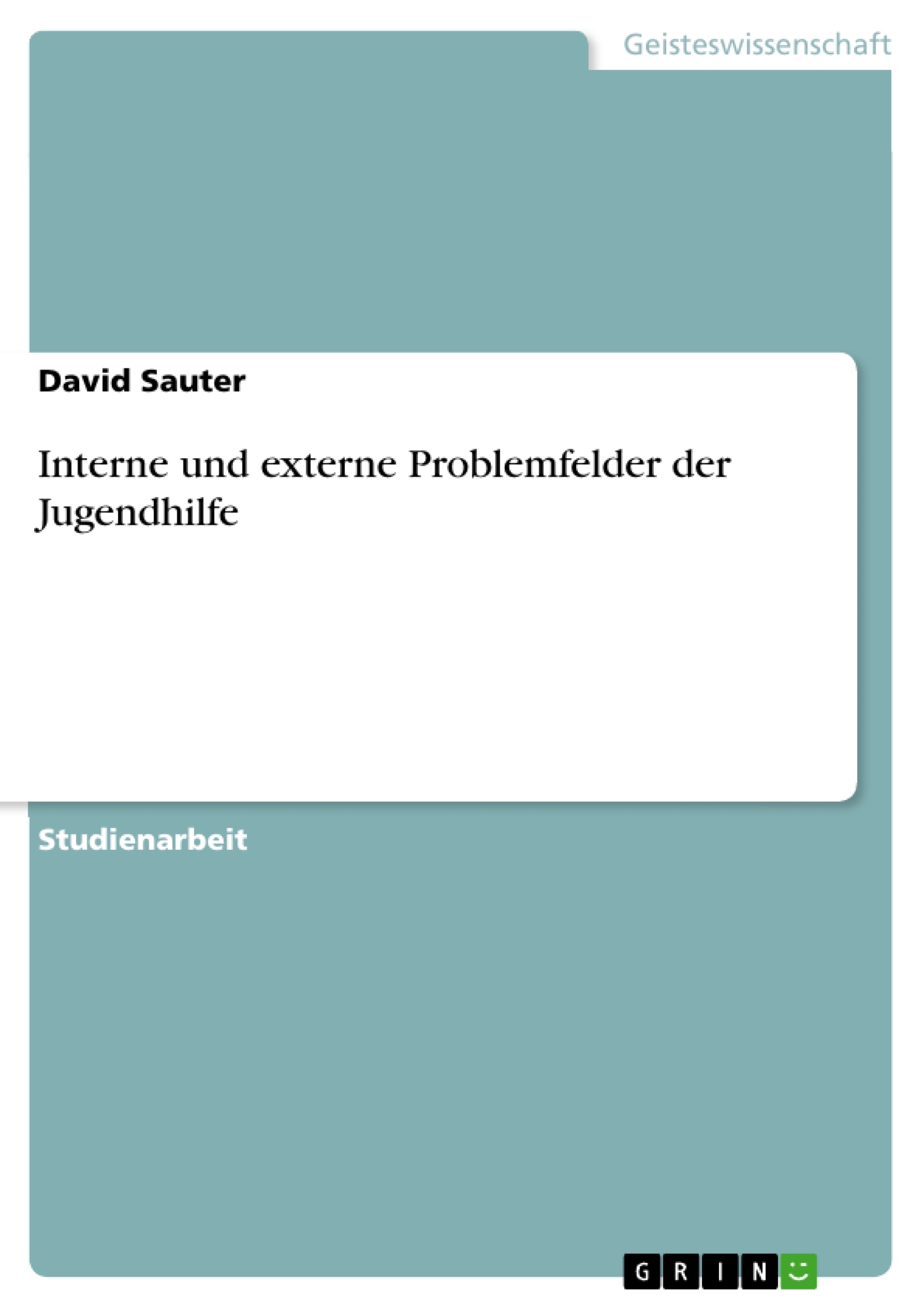
-

-

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen.