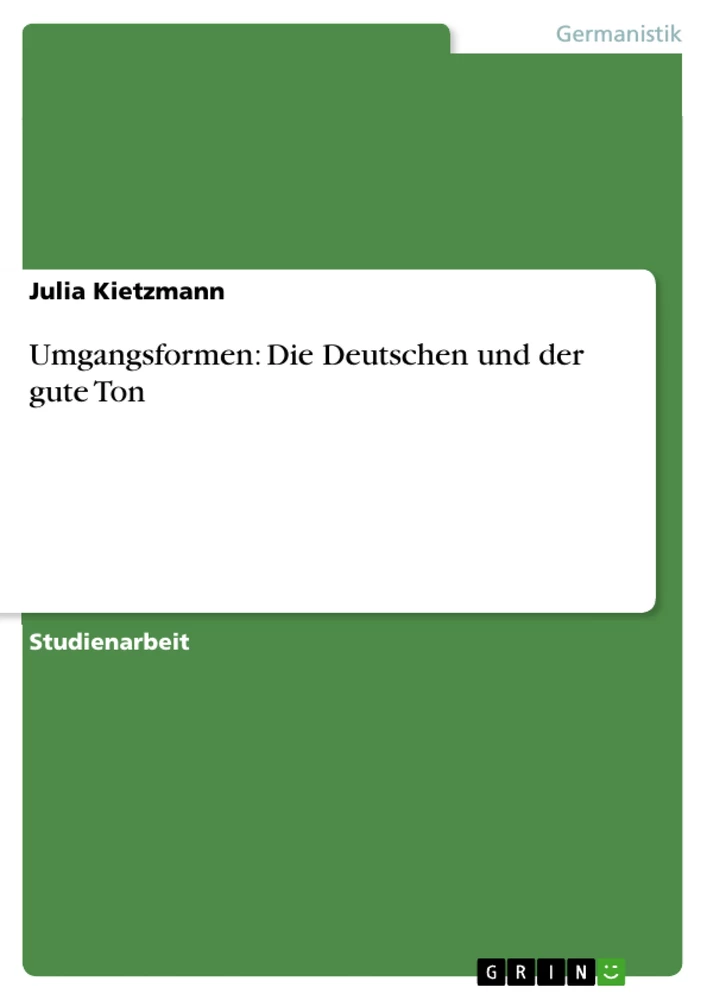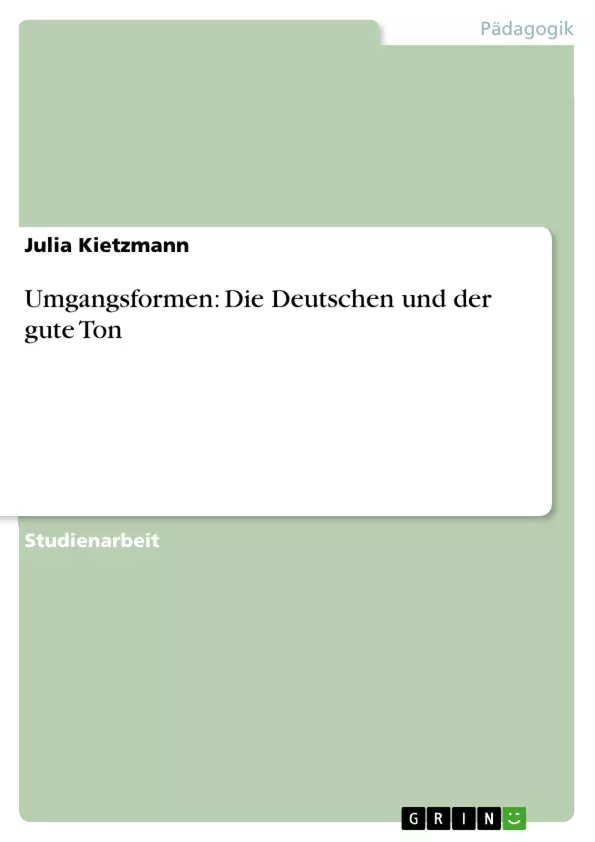In den Medien heißt es „Benimm ist wieder in“, doch war es jemals „out“? Höflichkeit war und ist zu jeder Zeit ein elementarer Teil des menschlichen Zusammenlebens. Was jedoch unter „gutem Benimm“ zu verstehen ist, wie es definiert wird, ist abhängig von Kulturkreis und Zeitgeist.
Die vorliegende Seminararbeit beschäftigt sich mit dem Thema „Umgangsformen – Die Deutschen und der gute Ton“.
In diesem Kontext fällt häufig der Begriff „Knigge“ . Aufgrund dessen wird zu Beginn des vorliegenden Textes ein Blick auf die Biografie von Adolph Freiherr von Knigge geworfen. Dazu wird sein wohl bekanntestes Werk „Über den Umgang mit Menschen“ vorgestellt, wobei sich zeigt, dass sein Gedankengut noch heute auf das Verständnis von Höflichkeit in Deutschland nachwirkt. Um dies zu verdeutlichen stellt die Autorin einen intertemporären Vergleich synonym verwendeter Begriffe für „gutes Benehmen“ auf.
Anschließend wird im Schwerpunkt dieser Arbeit die heutige Bedeutung von gesellschaftlichen Umgangsformen erörtert. Die Komplexität des zu behandelnden Themas erfordert eine Eingrenzung auf einige aussagekräftige Aspekte.
Insbesondere geht die Autorin auf den gegenwärtigen „guten Ton“ zwischen Muttersprachlern und Nicht-Muttersprachlern in der Bundesrepublik Deutschland ein, was gerade im Bereich der interkulturellen Germanistik ein zentrales Thema ist. Dabei werden Verhaltensweisen aufgegriffen, die als „typisch deutsch“ betitelt werden. Anhand von Beispielen wird dazu ein Vergleich zu anderen europäischen Ländern aufgestellt.
Zudem wird die vermeintlich richtige Anredeform als ein besonders beachtetes Charakteristikum von Höflichkeit thematisiert. So wird beispielsweise der Verwendung des pronominalen „Sie“ große Beachtung geschenkt. Gleichzeitig ergeben sich vor allem hier für Nicht-Muttersprachler Probleme.
Durch die 68er-Bewegung ergaben sich deutliche gesellschaftliche Veränderungen, wovon einige in der Ausarbeitung näher behandelt werden. Die kontrovers geführte Diskussion zwischen Konservativen und Anhängern der 68er-Generation, ob durch die anti-autoritären Erziehungsmethoden tatsächlich ein Werteverfall innerhalb Deutschlands eingetreten ist, ist nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. UMGANGSFORMEN - EINE HISTORISCHE EINFÜHRUNG
- 2.1 Das Leben des Freiherrn von Knigge
- 2.2 „Über den Umgang mit Menschen“ – Inhalt und Aufbau
- 2.3 Definitorischer Abriss
- 3. DER GUTE TON IN DEUTSCHLAND
- 3.1 Der gute Ton zwischen Muttersprachlern und Nicht-Muttersprachlern
- 3.2 Kommunikative Probleme für Nicht-Muttersprachler
- 3.2.1 Die,,richtige“ Anrede: Du oder Sie
- 3.2.2 Der gute Ton der (non-)verbalen Kommunikation
- 4. FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Thema „Umgangsformen – Der gute Ton in Deutschland“ und verfolgt das Ziel, die historische Entwicklung und die heutige Bedeutung von Höflichkeit in Deutschland zu beleuchten. Dabei wird insbesondere auf den „guten Ton“ zwischen Muttersprachlern und Nicht-Muttersprachlern eingegangen, was im Kontext der interkulturellen Germanistik von besonderer Bedeutung ist.
- Das Leben und Werk von Adolph Freiherr von Knigge als Begründer des „Knigge“ als Handbuch für gutes Benehmen.
- Die historische Entwicklung von Umgangsformen und ihre Bedeutung für das Verständnis von Höflichkeit in Deutschland.
- Die Herausforderungen der Kommunikation zwischen Muttersprachlern und Nicht-Muttersprachlern im deutschen Kontext.
- Die Bedeutung der Anredeform „Sie“ im deutschen Sprachraum und die damit verbundenen Probleme für Nicht-Muttersprachler.
- Die Rolle der 68er-Bewegung für den Wandel von gesellschaftlichen Umgangsformen in Deutschland.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel gibt eine Einführung in das Thema und erläutert die Relevanz von Höflichkeit im Kontext der interkulturellen Germanistik. Das zweite Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des „guten Tons“ in Deutschland, wobei der Fokus auf dem Leben und Werk von Adolph Freiherr von Knigge liegt. Es werden seine Biographie, seine zentralen Werke und die Relevanz seines Gedankenguts für das heutige Verständnis von Höflichkeit vorgestellt. Das dritte Kapitel analysiert die heutigen Umgangsformen in Deutschland, insbesondere im Kontext der Kommunikation zwischen Muttersprachlern und Nicht-Muttersprachlern. Es werden kommunikative Probleme, die für Nicht-Muttersprachler entstehen können, sowie die Bedeutung der Anredeform „Sie“ als charakteristisches Merkmal deutscher Höflichkeit behandelt.
Schlüsselwörter
Umgangsformen, guter Ton, Höflichkeit, Deutschland, Knigge, interkulturelle Kommunikation, Muttersprachler, Nicht-Muttersprachler, Anredeform, „Sie“, 68er-Bewegung.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Adolph Freiherr von Knigge?
Er war ein deutscher Schriftsteller der Aufklärung, dessen Werk „Über den Umgang mit Menschen“ (1788) zum Namensgeber für Benimmregeln wurde, obwohl er ursprünglich eher soziologische Ratschläge gab.
Was sind typische kommunikative Hürden für Nicht-Muttersprachler in Deutschland?
Besonders schwierig sind die Wahl zwischen „Du“ und „Sie“, die Nuancen der nonverbalen Kommunikation und spezifisch deutsche Höflichkeitskonventionen.
Welchen Einfluss hatte die 68er-Bewegung auf die Umgangsformen?
Die 68er-Bewegung führte zu einer Lockerung autoritärer Strukturen und veränderte die Erziehungsmethoden sowie das gesellschaftliche Verständnis von Etikette grundlegend.
Wann benutzt man in Deutschland das pronominale „Sie“?
Das „Sie“ wird in formalen Kontexten, gegenüber Fremden oder Respektspersonen verwendet und gilt als wichtiges Merkmal der Distanzwahrung und Höflichkeit.
Ist „guter Benimm“ heute wieder im Trend?
Medien behaupten oft, dass Benimm wieder „in“ sei, doch die Arbeit zeigt, dass Höflichkeit zu jeder Zeit ein elementarer Teil des Zusammenlebens war, sich nur ihre Definition wandelt.
- Citation du texte
- Julia Kietzmann (Auteur), 2005, Umgangsformen: Die Deutschen und der gute Ton, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55262