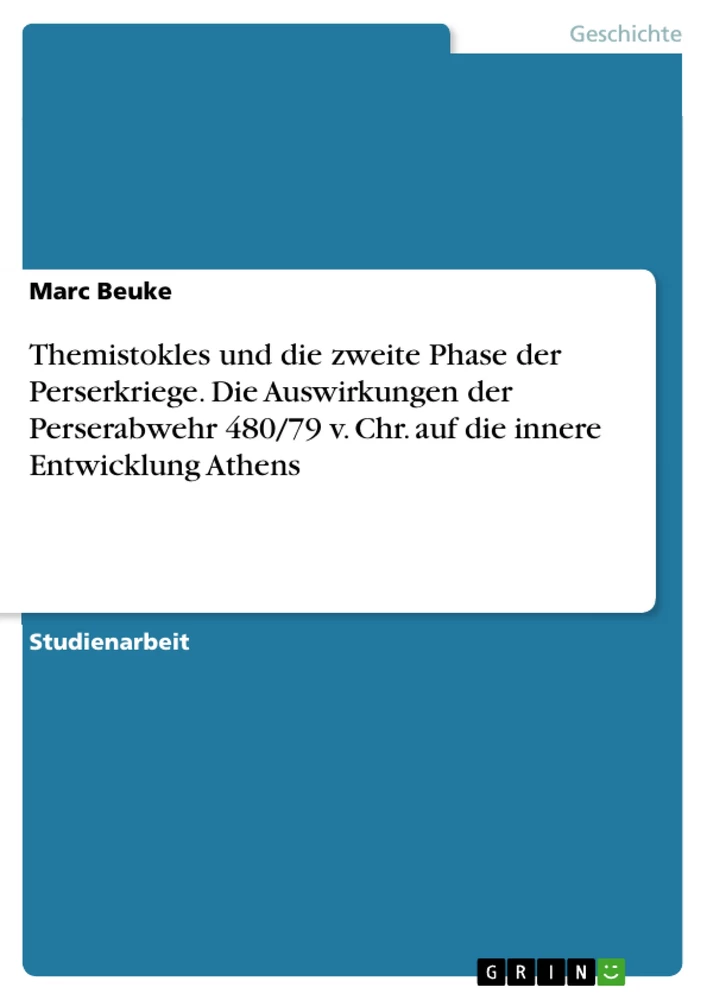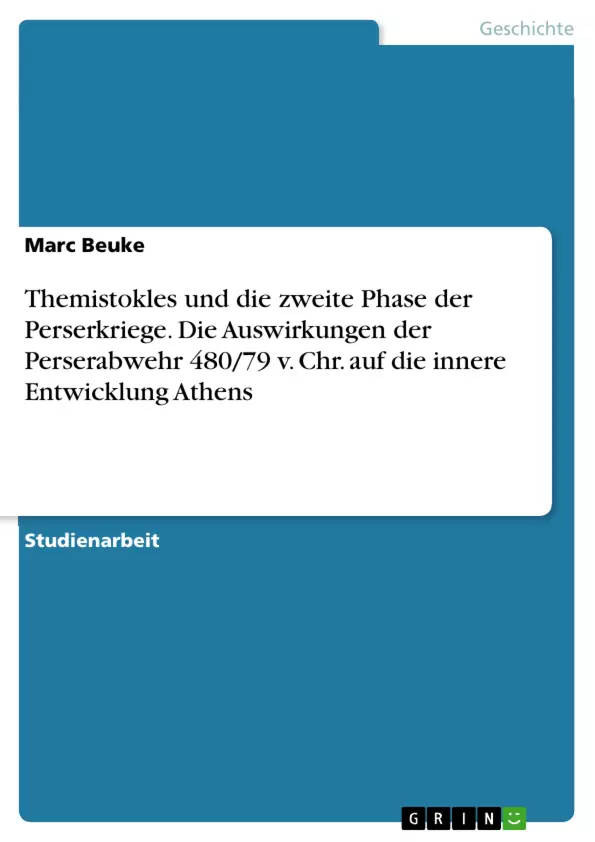Die vorliegende Seminararbeit untersucht den Perserkrieg von 480/79 im Hinblick auf seine Bedeutung für die Entwicklung der kleisthenischen isonomen Gesellschaftsordnung zur klassischen Demokratie, wie diese nach 462/61 in Erscheinung trat. Inwieweit war kann die Außenpolitik, die in Athen seit dem themistokleischen Flottenbauprogramm praktisch Flottenpolitik war, als entscheidende Triebkraft für die Entstehung der attischen Demokratie gewertet werden? Lassen sich dementsprechend die Perserkriege als Initialzündung der politischen Aktivierung der Massen und somit der Demokratie interpretieren?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Tendenzen der inneren Entwicklung Athens im Jahrzehnt nach Marathon
- Die attische Flottenrüstung
- Persien, Themistokles und das Flottenbauprogramm
- Das Kriegsschiff Triere: technische Eigenschaften, Besatzung und Kampfweise
- Die innenpolitische Komponente der Seerüstung: Ruderdienst als Instrument der Demokratisierung?
- Die Auswirkungen der Perserabwehr auf Athen
- Skizze des Kriegsverlaufs
- Die Auswirkungen des hellenischen Sieges auf die innere Entwicklung Athens
- Der Seebund und die Politisierung der Theten
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Auswirkungen der Perserkriege (480/79 v. Chr.) auf die innere Entwicklung Athens, insbesondere im Hinblick auf die Entstehung der attischen Demokratie. Es wird der Frage nachgegangen, inwieweit die Außenpolitik, geprägt durch das themistokleische Flottenbauprogramm, als treibende Kraft für die Demokratisierung diente und ob die Perserkriege als Initialzündung für die politische Aktivierung der Massen interpretiert werden können. Der Untersuchungszeitraum erstreckt sich von der Schlacht bei Marathon (490 v. Chr.) bis zu den Reformen des Ephialtes (462/61 v. Chr.).
- Die Bedeutung der Perserkriege für die Entwicklung der attischen Demokratie
- Der Einfluss des themistokleischen Flottenbauprogramms auf die politische Partizipation
- Die Rolle der attischen Flotte und des Ruderdienstes in der Demokratisierung
- Analyse der innenpolitischen Veränderungen in Athen nach den Perserkriegen
- Die Verbindung zwischen militärischer Entwicklung und politischer Transformation
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Perserkriege und deren Bedeutung für die Entwicklung der attischen Demokratie ein. Sie beschreibt den Kontext, in dem die Abwehr der persischen Angriffe als essentiell für das Überleben der kleisthenischen Verfassung angesehen wird. Die Arbeit fokussiert sich auf den Zeitraum von Marathon bis zu den Reformen des Ephialtes und benennt die wichtigsten Quellen, darunter Herodot, Thukydides, Aristoteles und Plutarch, sowie relevante Forschungsliteratur von Bleicken, Welwei und Martin. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Analyse des Zusammenhangs zwischen militärischer Entwicklung und innerer politischer Transformation.
Tendenzen der inneren Entwicklung Athens im Jahrzehnt nach Marathon: Dieses Kapitel legt die Grundlagen für das Verständnis der politischen und sozialen Strukturen Athens vor dem Beginn des groß angelegten Flottenbaus. Es analysiert die bereits vorhandenen Tendenzen der Entwicklung, die durch die Perserkriege dann verstärkt wurden. Der Fokus liegt wahrscheinlich auf der sozialen Zusammensetzung der Athener Bevölkerung und den bestehenden Machtstrukturen, die durch die Einführung der Flotte verändert werden.
Die attische Flottenrüstung: Dieses Kapitel behandelt ausführlich den Aufbau der attischen Flotte unter Themistokles. Es analysiert die strategischen Überlegungen, die technischen Aspekte der Trieren, die Besatzung und deren Kampfweise. Besonders wichtig ist die Analyse der innenpolitischen Konsequenzen, insbesondere die Einbindung der Theten in den Ruderdienst und die damit verbundene politische Partizipation. Das Kapitel zeigt den Übergang von einer Armee aus Hopliten zu einer starken Flotte als entscheidender Wendepunkt in der athenischen Entwicklung.
Die Auswirkungen der Perserabwehr auf Athen: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Folgen des hellenischen Sieges über die Perser. Es skizziert den Kriegsverlauf und analysiert die langfristigen Auswirkungen auf die innere Entwicklung Athens. Dabei werden sowohl die militärischen Erfolge als auch die daraus resultierenden politischen und sozialen Veränderungen beleuchtet, die den Weg zur Demokratie ebneten. Die Bedeutung der Nicht-Auflösung der Flotte nach den Kriegen wird im Kontext der folgenden Bündnispolitik eingeordnet.
Der Seebund und die Politisierung der Theten: Dieses Kapitel analysiert die Bildung des attischen Seebundes und dessen Auswirkungen auf die politische Macht der Theten. Der Fokus liegt auf der Beschreibung, wie die Beteiligung der Theten im Seebund ihre politische Partizipation und letztendlich die Demokratisierung der athenischen Gesellschaft beeinflusste. Der Seebund wird als Instrument zur Festigung der Macht und zum weiteren Ausbau der Demokratie dargestellt.
Schlüsselwörter
Perserkriege, attische Demokratie, Themistokles, Flottenbauprogramm, Triere, Theten, politische Partizipation, Kleisthenes, Ephialtes, Außenpolitik, Innenpolitik, isonome Verfassung, Seebund, Hopliten, Demokratisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Die Auswirkungen der Perserkriege auf die innere Entwicklung Athens"
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Auswirkungen der Perserkriege (480/79 v. Chr.) auf die innere Entwicklung Athens, insbesondere im Hinblick auf die Entstehung der attischen Demokratie. Der Fokus liegt auf dem Zusammenhang zwischen der Außenpolitik, dem themistokleischen Flottenbauprogramm, und der Demokratisierung. Der Zeitraum von der Schlacht bei Marathon (490 v. Chr.) bis zu den Reformen des Ephialtes (462/61 v. Chr.) steht im Mittelpunkt.
Welche zentralen Fragen werden behandelt?
Die Arbeit geht der Frage nach, inwieweit die Außenpolitik, insbesondere das Flottenbauprogramm unter Themistokles, die Demokratisierung vorantrieb. Es wird untersucht, ob die Perserkriege als Initialzündung für die politische Aktivierung der Massen interpretiert werden können und wie sich die militärische Entwicklung auf die politische Transformation auswirkte.
Welche Themenschwerpunkte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Bedeutung der Perserkriege für die Entwicklung der attischen Demokratie, den Einfluss des themistokleischen Flottenbauprogramms auf die politische Partizipation, die Rolle der attischen Flotte und des Ruderdienstes in der Demokratisierung, die Analyse der innenpolitischen Veränderungen nach den Perserkriegen und die Verbindung zwischen militärischer Entwicklung und politischer Transformation.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den Tendenzen der inneren Entwicklung Athens nach Marathon, ein Kapitel zur attischen Flottenrüstung (inkl. Persien, Themistokles, der Triere, und der innenpolitischen Komponente der Seerüstung), ein Kapitel zu den Auswirkungen der Perserabwehr auf Athen, ein Kapitel zum Seebund und der Politisierung der Theten und eine Schlussbetrachtung.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf klassische Quellen wie Herodot, Thukydides, Aristoteles und Plutarch, sowie auf relevante Forschungsliteratur von Bleicken, Welwei und Martin.
Was wird im Kapitel zur attischen Flottenrüstung behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt detailliert den Aufbau der attischen Flotte unter Themistokles, analysiert die strategischen Überlegungen, die technischen Aspekte der Trieren, die Besatzung und deren Kampfweise. Besonders wichtig ist die Analyse der innenpolitischen Konsequenzen, insbesondere die Einbindung der Theten im Ruderdienst und deren politische Partizipation.
Wie wird der Seebund in der Arbeit behandelt?
Das Kapitel zum Seebund analysiert dessen Auswirkungen auf die politische Macht der Theten und beschreibt, wie die Beteiligung der Theten im Seebund ihre politische Partizipation und die Demokratisierung der athenischen Gesellschaft beeinflusste. Der Seebund wird als Instrument zur Festigung der Macht und zum weiteren Ausbau der Demokratie dargestellt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Perserkriege, attische Demokratie, Themistokles, Flottenbauprogramm, Triere, Theten, politische Partizipation, Kleisthenes, Ephialtes, Außenpolitik, Innenpolitik, isonome Verfassung, Seebund, Hopliten, Demokratisierung.
Wie wird die Einleitung aufgebaut?
Die Einleitung führt in die Thematik der Perserkriege und deren Bedeutung für die Entwicklung der attischen Demokratie ein. Sie beschreibt den Kontext, in dem die Perserabwehr als essentiell für das Überleben der kleisthenischen Verfassung angesehen wird und benennt die wichtigsten Quellen und Forschungsliteratur. Der Schwerpunkt liegt auf dem Zusammenhang zwischen militärischer Entwicklung und innerer politischer Transformation.
Welche Zusammenfassung der Kapitel gibt es?
Die Zusammenfassung der Kapitel bietet einen Überblick über den Inhalt jedes Kapitels und hebt die zentralen Argumentationslinien hervor. Sie fasst die jeweiligen Schwerpunkte und Ergebnisse zusammen und zeigt die logische Abfolge der Argumentation auf.
- Quote paper
- Marc Beuke (Author), 2006, Themistokles und die zweite Phase der Perserkriege. Die Auswirkungen der Perserabwehr 480/79 v. Chr. auf die innere Entwicklung Athens , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55414