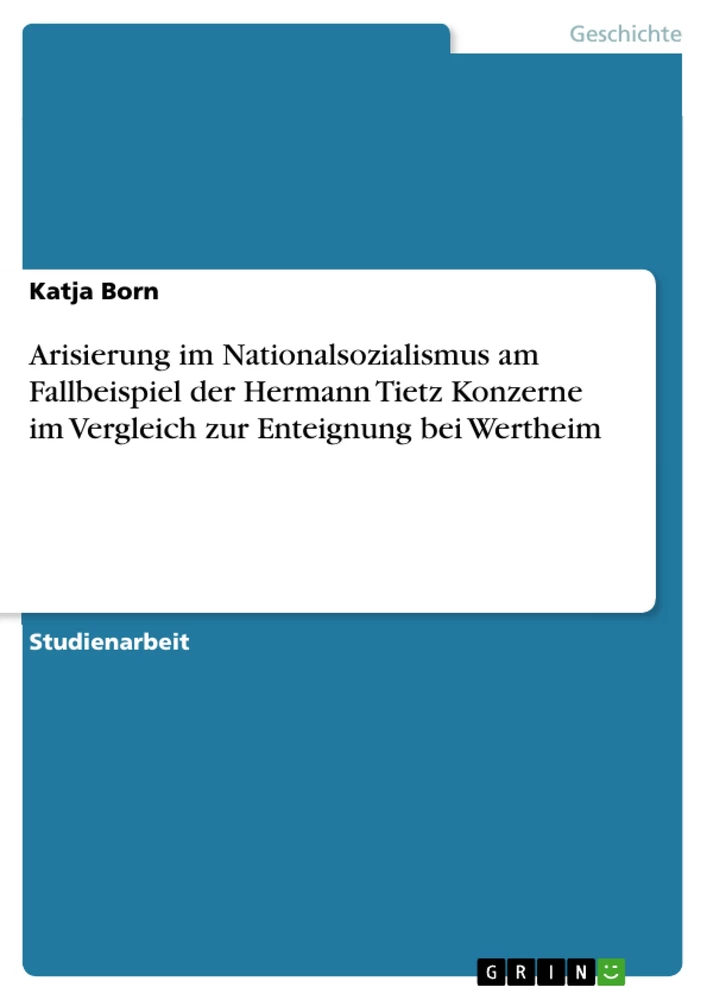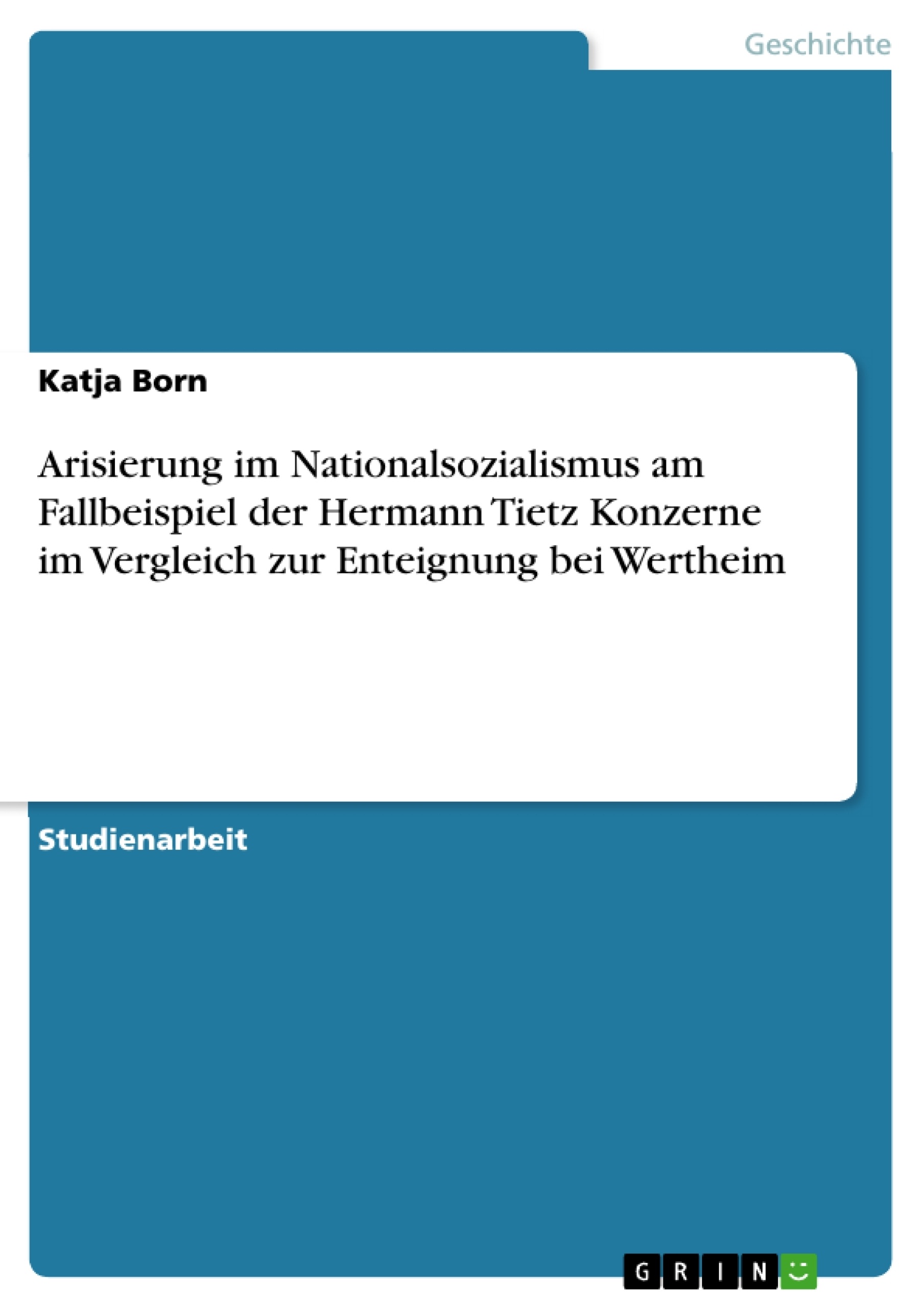Die Idee durch Boykott und Ausgrenzung jüdischer Unternehmen, um diese zum Aufgeben und schließlich zum Verlassen der Heimat zu bewegen, entstand und begann bereits einige Jahre vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten und fand 1933 ihren ersten Höhepunkt.
Der Handel war eine Domäne der Juden und sie besetzten wichtige Posten in allen Wirtschaftszweigen. Zahlenmäßig am stärksten war 1933 die Stellung der Juden nach wie vor im Waren- und Produkthandel. Seit der Machtübernahme Hitlers am 30. Januar 1933 setzten Diskriminierungsmaßnahmen ein, die einen besonderen Augenmerk auf die wirtschaftlichen Ausschaltung der Juden hatten. Schon in den Jahren zuvor waren im Mittelpunkt der NSDAP Propaganda wirtschaftliche Motive der antisemitischen „Judenhetze“ zu finden. Doch nun war die Gelegenheit günstig und die Rufe der alten Parteimitglieder nach Erfüllung der Wahlversprechen und somit der wirtschaftliche Ausschaltung der Juden wurden immer lauter. Ohne Zweifel entstanden durch die Enteignung jüdischen Besitzes eigene Vorteile und persönlicher Nutzen.
In dieser Arbeit soll nun ein Beispiel der Schaffens- und Schöpferkraft einer Kaufmannsfamilie gezeigt werden, die es verstand, der wirtschaftlichen Entwicklung neue Wege zu weisen. Aufstieg, Blüte und Untergang des Hermann Tietz Konzerns sind Leitfaden und Grundgedanke. Dabei soll die Verfahrensweise der 'Arisierungen'cim Nationalsozialismus verdeutlicht werden. Insbesondere auf dem Vergleich der 'Entjudung' zweier großer Warenhausunternehmen soll das Augenmerk gerichtet werden. Die Umstände und auch die politischen Begebenheiten in der Zeit des Nationalsozialismus werden unter besonderem Gesichtspunkt der wirtschaftlichen Ausschaltung der Juden näher betrachtet. Die Frage soll beantwortet werden: Inwieweit und mit welchen Mitteln die jüdischen Unternehmer gezwungen worden sind, ihre Existenzgrundlagen aufzugeben und in die Emigration zu flüchten? Nicht außer Acht gelassen werden soll dabei die Etablierung der Warenhäuser als „Judenhäuser“ und als Ergebnis „unersättlicher jüdischer Machtgier“, bis hin zur „Arisierung“ dieser.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung - Definition der Thematik
- Allgemeiner Einstieg – Die Anfänge der Warenhäuser in Europa
- Aufstieg - Vom Ladengeschäft bis zum Detailgeschäft
- Das erste Warenhaus in Berlin
- „Arisierung\" bei Hermann Tietz
- Boykott jüdischer Geschäfte
- „Arisierungsprozess“ bei Hertie im Vergleich zur Enteignung bei Wertheim
- Das Schicksal der Familie Tietz
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Aufstieg, der Blüte und dem Untergang des Hermann Tietz Konzerns. Sie beleuchtet die „Arisierung“ im Nationalsozialismus und analysiert die „Entjudung“ zweier großer Warenhausunternehmen. Dabei wird der Fokus auf die wirtschaftliche Ausschaltung der Juden und die Mittel gelegt, mit denen jüdische Unternehmer gezwungen wurden, ihre Existenzgrundlagen aufzugeben und in die Emigration zu flüchten.
- Die Entstehung und Entwicklung der Warenhäuser in Europa
- Die Rolle der Juden im Waren- und Produkthandel im 19. und frühen 20. Jahrhundert
- Die wirtschaftlichen und politischen Motive der „Arisierung“ von jüdischen Unternehmen
- Der Vergleich der „Arisierung“ bei Hertie und Wertheim
- Die Folgen der Enteignung für die Familie Tietz
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung - Definition der Thematik
Die Einleitung stellt den Kontext der „Arisierung“ von jüdischen Unternehmen dar, die bereits vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten begann und 1933 ihren ersten Höhepunkt erreichte. Der Fokus liegt auf der Rolle der Juden im Handel und der wirtschaftlichen Diskriminierung, die sie erlebten. Die Hausarbeit soll anhand des Hermann Tietz Konzerns die „Arisierung“ und deren Folgen aufzeigen.
Allgemeiner Einstieg – Die Anfänge der Warenhäuser in Europa
Dieses Kapitel befasst sich mit der Entstehung der Warenhäuser in Europa, die ihren Ursprung in Amerika haben. Die Warenhäuser revolutionierten den Handel, indem sie verschiedene Warengruppen unter einem Dach vereinten und niedrige Preise anboten. Es wird beschrieben, wie sich die Warenhäuser etablierten, von höheren Gesellschaftsschichten akzeptiert wurden und zu einem Ziel der nationalsozialistischen „Arisierung“ wurden.
Aufstieg - Vom Ladengeschäft bis zum Detailgeschäft
Dieses Kapitel erzählt die Geschichte des Hermann Tietz Konzerns, der als Familienunternehmen begann und zu einem großen Konzern heranwuchs. Die Entwicklung von einem kleinen Kurz- und Weißwarengeschäft zu einem Warenhauskonzern mit Filialen in verschiedenen Städten wird beschrieben. Die innovativen Geschäftsprinzipien von Oscar Tietz und die Herausforderungen, die er bewältigen musste, werden beleuchtet.
- Arbeit zitieren
- Katja Born (Autor:in), 2003, Arisierung im Nationalsozialismus am Fallbeispiel der Hermann Tietz Konzerne im Vergleich zur Enteignung bei Wertheim, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55422