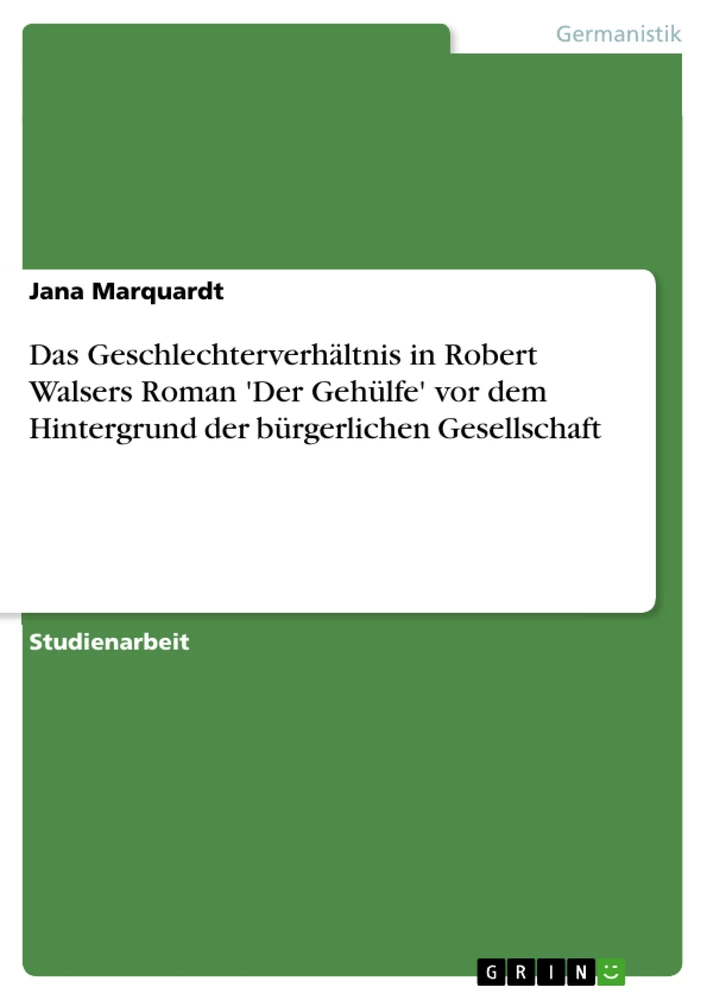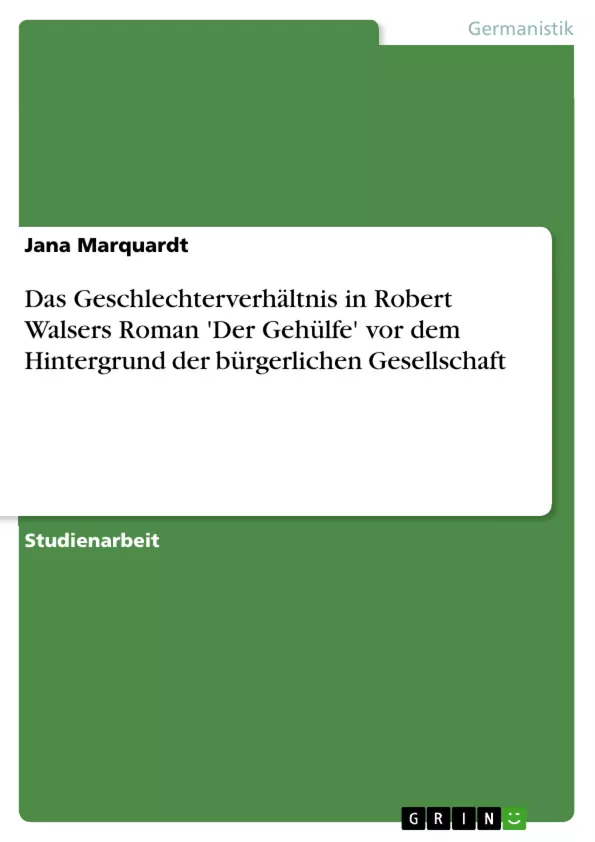Obgleich der Schweizer Schriftsteller Robert Walser in den vergangenen Jahren verstärkt in der Forschungsliteratur behandelt wurde, gehört er doch bis heute zu den am wenigsten beachteten großen Schriftstellern der Moderne.
Walsers Protagonisten sind Vagabunden, Schelme und rebellische Dienerfiguren, die die entfremdeten Arbeitsverhältnisse und Identitätsprobleme um die Jahrhundertwende offenbaren und dadurch zu ‚sozialen Grenzgängern’ werden.
Auch das Motiv der Liebe - beeinflusst von den Vorstellungen der bürgerlichen Gesellschaft - ist bei Robert Walser von Grenzüberschreitungen bestimmt. In den meisten anderen Romanen um die Jahrhundertwende werden traditionelle zwischengeschlechtliche Beziehungen thematisiert, die auf der Aufspaltung von männlichen und weiblichen Seinsbereichen beruhen.
Im Gegensatz dazu brechen Walsers Figuren jene scharfe Grenzziehung auf, lassen die Trennlinien verschwimmen und zeigen Möglichkeiten des flexiblen Rollenwechsels zwischen den Geschlechtern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Die bürgerliche Gesellschaft
- 2. Erzählperspektive
- 3. Figurenkonstellation
- 3.1 Joseph Marti
- 3.2 Herr Tobler
- 3.3 Frau Tobler
- 4. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der Darstellung des Geschlechterverhältnisses im Roman „Der Gehülfe“ von Robert Walser, und zwar vor dem Hintergrund der bürgerlichen Gesellschaft um die Jahrhundertwende.
- Die Rolle der bürgerlichen Gesellschaft und ihre Auswirkungen auf das Geschlechterverhältnis
- Die Erzählperspektive im Roman „Der Gehülfe“ und ihre Bedeutung für die Interpretation
- Die Analyse der Figuren Joseph Marti, Herr Tobler und Frau Tobler im Hinblick auf ihre Geschlechterrollen
- Die Darstellung der Liebe und die Grenzüberschreitungen im Roman
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt Robert Walser als einen der am wenigsten beachteten großen Schriftsteller der Moderne vor und beleuchtet seine Themenschwerpunkte.
1. Die bürgerliche Gesellschaft
Dieser Abschnitt beschreibt die bürgerliche Gesellschaft der Jahrhundertwende, mit Fokus auf das Ideal der bürgerlichen Familie und die Vorstellung von Liebe.
2. Erzählperspektive
Hier wird die problematische Erzählperspektive des Romans analysiert, die sich durch eine Mischung aus personaler, auktorialer, monologischer und reflexiver Erzählweise auszeichnet.
3. Figurenkonstellation
Dieser Abschnitt widmet sich der Analyse der Figuren Joseph Marti, Herr Tobler und Frau Tobler.
Häufig gestellte Fragen
Welches Hauptthema behandelt Robert Walsers Roman 'Der Gehülfe'?
Der Roman thematisiert das Geschlechterverhältnis vor dem Hintergrund der bürgerlichen Gesellschaft um die Jahrhundertwende, insbesondere durch die Figur des Joseph Marti.
Wie unterscheiden sich Walsers Figuren von traditionellen Romanfiguren dieser Zeit?
Während traditionelle Romane oft scharfe Trennlinien zwischen männlichen und weiblichen Seinsbereichen ziehen, brechen Walsers Figuren diese auf und zeigen Möglichkeiten eines flexiblen Rollenwechsels.
Welche Rolle spielt die bürgerliche Gesellschaft im Roman?
Die bürgerliche Gesellschaft bildet den Rahmen für die Vorstellungen von Liebe und Familie, wobei Walser zeigt, wie seine Protagonisten als 'soziale Grenzgänger' diese Normen überschreiten.
Wer sind die zentralen Figuren in der Analyse?
Die Analyse konzentriert sich auf die Figurenkonstellation zwischen Joseph Marti, Herrn Tobler und Frau Tobler.
Was ist das Besondere an der Erzählperspektive in 'Der Gehülfe'?
Die Erzählperspektive ist problematisch und komplex, da sie eine Mischung aus personaler, auktorialer, monologischer und reflexiver Erzählweise darstellt.
- Citation du texte
- Jana Marquardt (Auteur), 2003, Das Geschlechterverhältnis in Robert Walsers Roman 'Der Gehülfe' vor dem Hintergrund der bürgerlichen Gesellschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/56175