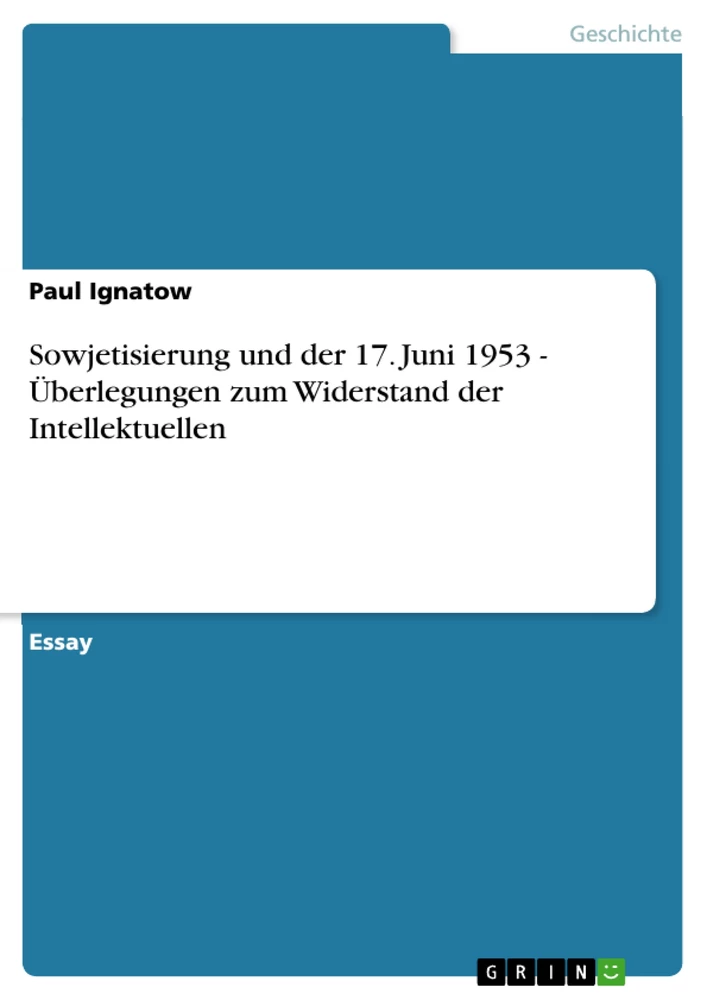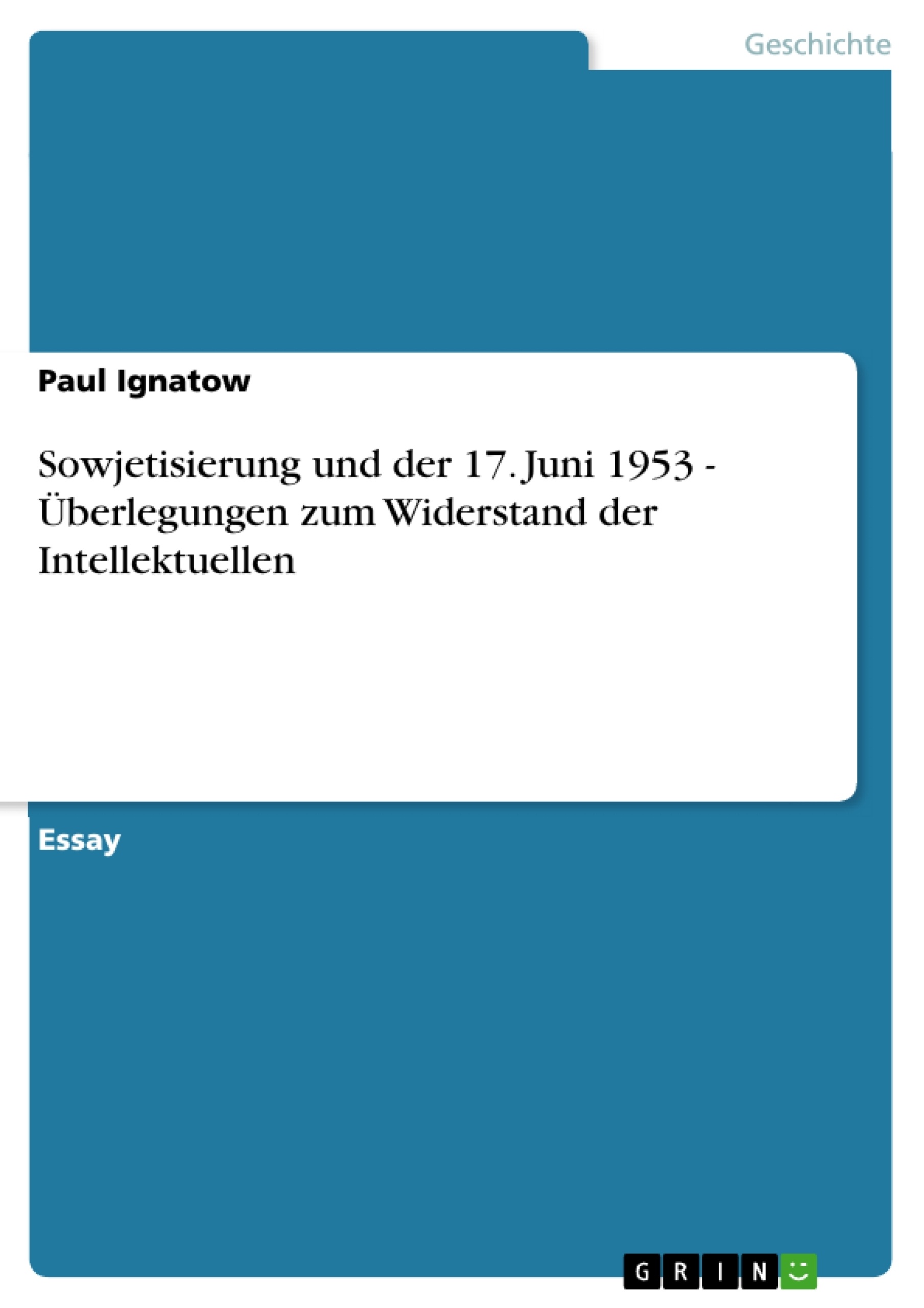Um sich dem Verhältnis der Intellektuellen zum SED-Regime und deren kritischen Reaktionen auf die Phase der „Sowjetisierung“ ab 1948/49 bis zum Arbeiteraufstand am 17. Juni 1953 zu nähern, erscheint es zunächst sinnvoll, die Begriffe Widerstand und Intellektuelle zu beleuchten und zu umreißen.
Insbesondere im Kontext des Widerstandsbegriffes lässt sich im Zusammenhang mit den beiden deutschen Diktaturen eine geradezu inflationäre Anwendung beobachten. Gerade für die Zeit des Nationalsozialismus wurden unzählige Bereiche nicht systemkonformen Verhaltens, wie etwa die Verweigerung einer Spende für das Winterhilfswerk während des Russlandfeldzuges, als Widerstand gegen das NS-Regime interpretiert, ohne die persönlichen Handlungsmotive und Auslöser zu hinterfragen. Martin Broszat hat mit der Einführung des
Resistenz-Begriffs einen Beitrag zur Auflösung dieses Dilemmas und zur Nuancierung widerständigen Verhaltens geleistet. So vielfältig und umstritten die Klassifizierung und Definition von nicht systemkonformem Verhalten auch sein mag, so nötig ist es, einen Maßstab bei der Beurteilung des Verhaltens
der Intellektuellen gegenüber der DDR-Obrigkeit anzulegen. Ich stütze mich auf die Dreiteilung Rainer Eckerts. Dieser unterscheidet Widerstand als prinzipiellen Kampf gegen die Herrschaft der SED, Opposition als relativ offene, zumeist zeitweilige und teilweise legale Ablehnung des Realsozialismus bzw. die Absicht zu seiner Reform sowie Resistenz als nicht
der Norm entsprechendes Verhalten im Alltag, passiver Widerstand, die Selbstbehauptung einzelner Personen und die Abweichung von der offiziellen Ideologie. [...]
Inhaltsverzeichnis
- „Sowjetisierung“ und der 17. Juni 1953
- Überlegungen zum Widerstand der Intellektuellen
- ,,Die Phase der gelockerten Zügel"
- Kulturpolitische Entwicklungen in der SBZ bis 1947/48
- Die Formalismus-Debatte und die Reaktion der Kulturschaffenden
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Essay zielt darauf ab, das Verhältnis von Intellektuellen zum SED-Regime in der frühen DDR zu analysieren, insbesondere im Kontext der „Sowjetisierung“ und dem Arbeiteraufstand vom 17. Juni 1953. Der Fokus liegt auf der kritischen Reaktion der Intellektuellen auf die sich verschärfenden politischen Rahmenbedingungen.
- Der Widerstand der Intellektuellen gegen die SED-Herrschaft und die verschiedenen Formen des Widerstands, wie prinzipieller Kampf, Opposition und Resistenz.
- Die Rolle der Intellektuellen in der Gesellschaft und die Herausforderungen, die sie im Kontext der „Sowjetisierung“ und der zunehmenden Kontrolle durch die SED-Führung zu bewältigen hatten.
- Die Entwicklung der Kulturpolitik in der SBZ bis 1947/48 und die sich wandelnden Machtverhältnisse zwischen den Intellektuellen und der sowjetischen Administration.
- Die Folgen der Formalismus-Debatte für die künstlerische Freiheit der Intellektuellen und die Reaktionen auf die Verdammung moderner Kunstformen.
- Die Bedeutung der intellektuellen Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und die Herausforderung, Kritik zu üben, ohne selbst manipulierbar zu sein.
Zusammenfassung der Kapitel
„Sowjetisierung“ und der 17. Juni 1953
Dieser Abschnitt führt den Begriff des „Widerstands“ und die Definition von Intellektuellen ein. Es wird die komplexe und vielschichtige Natur des Widerstands gegen die beiden deutschen Diktaturen, Nationalsozialismus und DDR, aufgezeigt. Der Essay verwendet die Dreiteilung Rainer Eckerts, um verschiedene Formen des Widerstands – prinzipieller Kampf, Opposition und Resistenz – zu unterscheiden.
,,Die Phase der gelockerten Zügel"
Dieser Abschnitt beschreibt die kulturpolitische Entwicklung in der SBZ bis 1947/48. Es wird die Hoffnung auf einen Neuanfang nach dem Zweiten Weltkrieg und die Rolle der aus dem sowjetischen Exil zurückgekehrten Kommunisten dargestellt. Der Kulturbund Demokratischer Erneuerung Deutschlands wurde als Integrationsorgan für Künstler gegründet, jedoch zeigt der Text auch die wachsende Kontrolle durch die Sowjets und die SED.
Die Formalismus-Debatte und die Reaktion der Kulturschaffenden
Dieser Abschnitt analysiert die zunehmende Einschränkung künstlerischer Freiheit in der frühen DDR im Kontext der Formalismus-Debatte. Die SED-Führung förderte den sowjetischen Realismus-Stil und verdammte moderne Kunst als „formalistisch“ und „dekadent“. Der Essay zeigt die Reaktionen der Intellektuellen auf diese Beschneidung ihrer künstlerischen Freiheit, von vorsichtiger Kritik bis hin zu offenem Widerstand.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Essays sind „Sowjetisierung“, „Widerstand“, „Intellektuelle“, „Kulturpolitik“, „Formalismus-Debatte“, „SED-Regime“ und „Künstlerische Freiheit“. Der Text befasst sich mit der Entwicklung des Widerstands der Intellektuellen gegen die politische und kulturelle Kontrolle durch die SED-Führung in der frühen DDR.
- Arbeit zitieren
- Paul Ignatow (Autor:in), 2005, Sowjetisierung und der 17. Juni 1953 - Überlegungen zum Widerstand der Intellektuellen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/56332