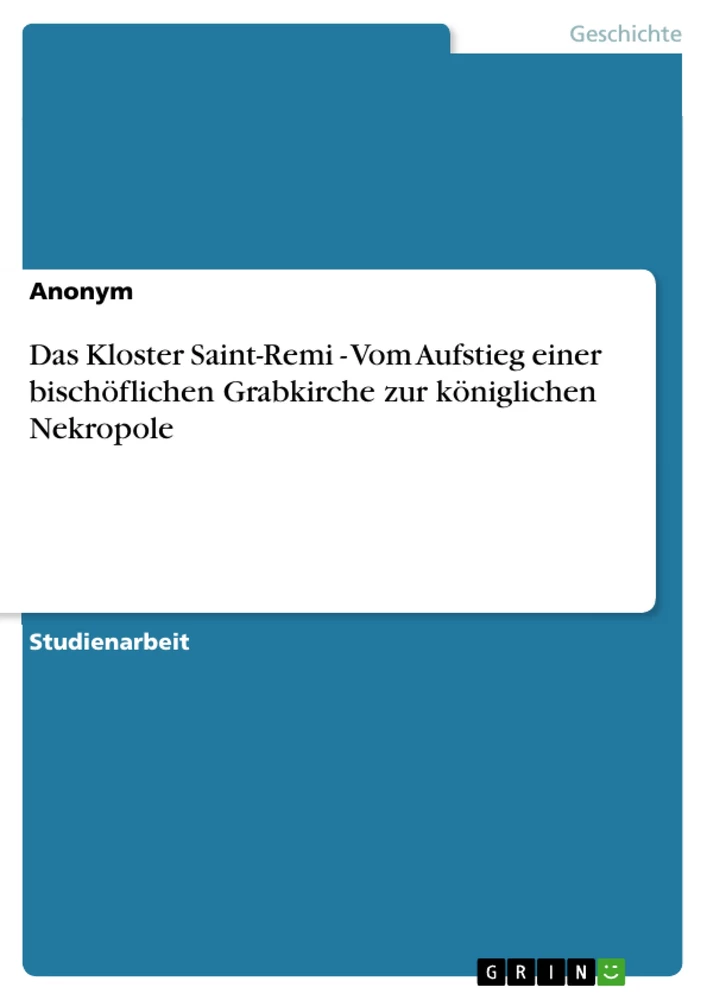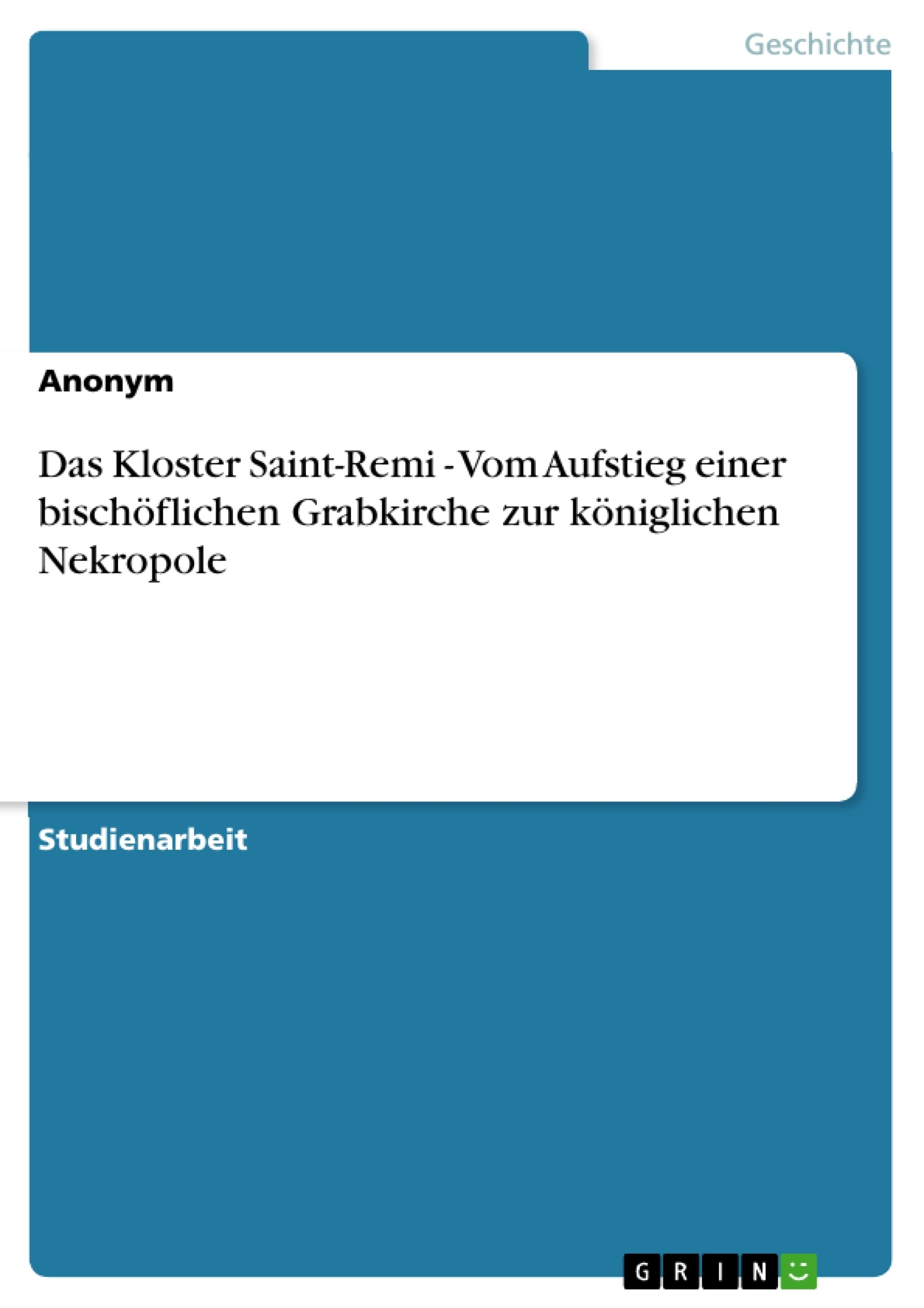Eines von 29 Kultur- und Naturdenkmälern in Frankreich, die die UNESCO für besonders erhaltenswert erachtet, ist das Kloster Saint-Remi in Reims. Es bildet zusammen mit der Kathedrale und dem Palais du Tau jenes Ensemble, welches die Völkergemeinschaft seit 1991 in seine Liste des Welterbes der Menschheit aufgenommen hat. So spiegeln sich in seiner Basilika nicht nur bedeutende Aspekte der französischen Geschichte wider, sondern die romanische Architektur aus der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts zeichnet sie zudem als exemplarisches Beispiel für diesen Baustil besonders aus. Früher vor den Toren der Stadt gelegen, ist das Kloster heute einen Kilometer südlich der Kathedrale auf einer Anhöhe innerhalb des Stadtgebietes zu finden. Die zum Kloster gehörende Kirche soll im Mittelpunkt der folgenden Ausführungen stehen.
Sie steht freilich im Lichte jener nordfranzösischen Stadt Reims und ihrer alles überragenden Kathedrale, die seit Jahrhunderten eine besondere Rolle gespielt hat und seit den Merowingern, dessen Königsresidenz sie unter anderem war, immer mehr in den Blickpunkt französischer Geschichte geriet. Bereits im 3. Jahrhundert Bischofs- und seit dem 8. Jahrhundert Erzbischofssitz erlangte Reims besonders als religiöses Zentrum eine immer größere Bedeutung und war mit ihrer Institutionalisierung zum Krönungsort der französischen Könige seit dem 11. Jahrhundert wohl eine der exponiertesten Stätten im frühen Frankreich. Um so mehr überrascht es dann, dass im Schatten der Stadt ein religiöser Ort, ausgehend von einer Kirche, einen eigenen Weg ging und nach Saint-Denis zur bedeutendsten Nekropole der französischen Könige wurde. Dies ist eine interessante Entwicklung, die mit dem Wirken des heiligen Remigius als Bischof von Reims begann und im Folgenden nur skizziert werden kann. Schwerpunkt der Betrachtungen soll die Herausstellung Saint-Remis im Sinne einer beabsichtigten Schaffung als königliche Grablege sein, die jedoch im Vergleich zu Saint-Denis einen anderen Charakter zeigt und zugleich die politischen Ereignisse des 10. Jahrhunderts, welche letztlich den Dynastiewechsel von den Karolingern zu den Kapetingern bewirkten, veranschaulicht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Anfänge einer Grabkirche
- 2.1 Saint-Remi als Grab des heiligen Remigius
- 2.2 Das Heiligengrab als Anziehungspunkt
- 2.3 Bevorzugte Bischofsgrablege
- 3. Reims als merowingische Residenz
- 4. Reims und Saint-Remi zur frühen Karolingerzeit
- 4.1 Erzbischöfliche Verwaltung und Umwandlung in ein benediktinisches Kloster
- 4.2 Letzte Ruhestätte Karlmanns
- 5. Das Wirken Erzbischof Hinkmars
- 5.1 Restitution und materielle Sicherung
- 5.2 Ideologische Verankerung
- 5.3 Saint-Remi ergeben
- 6. Reims und Saint-Remi zur späten Karolingerzeit
- 6.1 Politische Schlüsselrolle
- 6.2 Ludwig IV.
- 6.3 Lothar
- 6.4 Ludwig V.
- 6.5 Verlagerung der Krondomäne
- 6.6 Administrative Unabhängigkeit und deren Folgen
- 7. Saint-Remi im 12. Jahrhundert
- 7.1 Repräsentative Umgestaltung im Sinne einer königlichen Grablege
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des Klosters Saint-Remi in Reims von einer bischöflichen Grabkirche zu einer königlichen Nekropole. Die Zielsetzung besteht darin, den Prozess dieser Transformation aufzuzeigen und die Faktoren zu analysieren, die zu diesem Wandel beigetragen haben.
- Die Rolle des heiligen Remigius und die Anfänge von Saint-Remi als Grabstätte.
- Der Einfluss der merowingischen und karolingischen Dynastien auf die Entwicklung des Klosters.
- Die Bedeutung von Erzbischof Hinkmar für die Sicherung und ideologische Verankerung von Saint-Remi.
- Die politische Bedeutung von Reims und Saint-Remi im späten Mittelalter.
- Die Umgestaltung von Saint-Remi im 12. Jahrhundert als königliche Grablege.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt das Kloster Saint-Remi in Reims und seine Bedeutung als UNESCO-Welterbe vor. Sie hebt die historische und architektonische Bedeutung der Basilika hervor und skizziert den Fokus der Arbeit auf die Entwicklung Saint-Remis als königliche Grablege im Vergleich zu Saint-Denis. Die Einleitung nennt wichtige historische Quellen und Forschungsliteratur, die für die Arbeit relevant sind, und betont, dass die Arbeit von der Prämisse ausgeht, dass die Basilika als königliche Nekropole einzuschätzen ist, unabhängig von der Anzahl der dort bestatteten Könige.
2. Die Anfänge einer Grabkirche: Dieses Kapitel beleuchtet die Anfänge von Saint-Remi als Grabstätte, beginnend mit dem Tod des heiligen Remigius, des Bischofs von Reims, der im 6. Jahrhundert den Frankenkönig Chlodwig taufte. Es wird die Legende um das Begräbnis des Remigius und seine Bedeutung für die Entwicklung der Kirche erörtert, wobei Hinkmars Bericht über die Umstände des Begräbnisses im Mittelpunkt steht. Der Abschnitt unterstreicht die Bedeutung des Heiligengrabes als Anziehungspunkt und die allmähliche Entwicklung der Kirche zu einer bevorzugten Bischofsgrablege.
3. Reims als merowingische Residenz: Dieses Kapitel befasst sich mit der Bedeutung von Reims als merowingische Königsresidenz und dem Kontext, in dem sich Saint-Remi entwickelte. Es beleuchtet die politische und religiöse Bedeutung der Stadt in dieser Epoche und ihren Einfluss auf die Entwicklung des Klosters. Hier wird die Verflechtung von weltlicher und geistlicher Macht verdeutlicht und der Weg von Saint-Remi hin zur Grabkirche beschrieben.
4. Reims und Saint-Remi zur frühen Karolingerzeit: Das Kapitel analysiert die Entwicklung von Saint-Remi während der frühen Karolingerzeit. Es beschreibt die erzbischöfliche Verwaltung, die Umwandlung in ein benediktinisches Kloster und die Bestattung Karlmanns. Es werden die politischen und religiösen Veränderungen der Zeit und deren Einfluss auf das Kloster detailliert untersucht. Die Integration von Saint-Remi in das karolingische Herrschaftssystem und die daraus resultierenden Folgen werden analysiert.
5. Das Wirken Erzbischof Hinkmars: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Rolle Erzbischof Hinkmars von Reims für die Entwicklung von Saint-Remi. Es wird seine Bedeutung für die Restitution und materielle Sicherung des Klosters, sowie für dessen ideologische Verankerung dargelegt. Die Kapitel untersuchen Hinkmars Einfluss auf das Bild von Saint-Remi und die Stärkung seiner Bedeutung.
6. Reims und Saint-Remi zur späten Karolingerzeit: Das Kapitel beleuchtet die politische Schlüsselrolle von Reims und Saint-Remi im Kontext der späten Karolingerzeit. Es untersucht die Bestattungen wichtiger Persönlichkeiten wie Ludwig IV., Lothar und Ludwig V., die Verlagerung der Krondomäne und die administrative Unabhängigkeit des Klosters und deren Folgen. Es wird die politische Instabilität dieser Epoche und der Einfluss auf die Position von Saint-Remi analysiert.
7. Saint-Remi im 12. Jahrhundert: Dieses Kapitel behandelt die repräsentative Umgestaltung von Saint-Remi im 12. Jahrhundert im Sinne einer königlichen Grablege. Es wird der Prozess der Transformation und seine Bedeutung im Kontext der politischen und kulturellen Entwicklungen Frankreichs dieser Zeit erörtert. Der Wandel von Saint-Remi hin zu einer bedeutenden königlichen Grabstätte wird analysiert.
Schlüsselwörter
Saint-Remi, Reims, königliche Nekropole, Grabkirche, heiliger Remigius, Merowinger, Karolinger, Erzbischof Hinkmar, politische Geschichte Frankreichs, religiöse Geschichte Frankreichs, mittelalterliche Architektur, königliche Bestattung, Dynastiewechsel.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Saint-Remi in Reims: Von der bischöflichen Grabkirche zur königlichen Nekropole"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des Klosters Saint-Remi in Reims von einer bischöflichen Grabkirche zu einer königlichen Nekropole. Sie analysiert den Transformationsprozess und die dafür verantwortlichen Faktoren.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Rolle des heiligen Remigius und die Anfänge von Saint-Remi als Grabstätte, den Einfluss der merowingischen und karolingischen Dynastien, die Bedeutung Erzbischof Hinkmars, die politische Bedeutung von Reims und Saint-Remi im späten Mittelalter sowie die Umgestaltung von Saint-Remi im 12. Jahrhundert als königliche Grablege.
Welche Zeiträume werden untersucht?
Die Arbeit umfasst einen Zeitraum vom 6. Jahrhundert (Tod des heiligen Remigius) bis ins 12. Jahrhundert, umfassend die Merowingerzeit, die Karolingerzeit und den Übergang in das Hochmittelalter.
Welche Schlüsselpersonen werden betrachtet?
Eine zentrale Rolle spielt der heilige Remigius, der Gründer der Kirche. Besondere Aufmerksamkeit widmet die Arbeit Erzbischof Hinkmar, dessen Wirken maßgeblich zur Sicherung und ideologischen Verankerung von Saint-Remi beitrug. Die Arbeit analysiert auch die Bestattungen verschiedener karolingischer Könige wie Ludwig IV., Lothar und Ludwig V.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Einleitung nennt wichtige historische Quellen und Forschungsliteratur, die für die Arbeit relevant sind. Hinkmars Bericht über die Umstände des Begräbnisses des heiligen Remigius ist beispielsweise eine wichtige Quelle.
Welche These vertritt die Arbeit?
Die Arbeit geht von der Prämisse aus, dass die Basilika Saint-Remi als königliche Nekropole einzuschätzen ist, unabhängig von der Anzahl der dort bestatteten Könige.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sieben Kapitel gegliedert: Einleitung, die Anfänge einer Grabkirche, Reims als merowingische Residenz, Reims und Saint-Remi zur frühen Karolingerzeit, das Wirken Erzbischof Hinkmars, Reims und Saint-Remi zur späten Karolingerzeit und Saint-Remi im 12. Jahrhundert. Jedes Kapitel fasst seine Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Saint-Remi, Reims, königliche Nekropole, Grabkirche, heiliger Remigius, Merowinger, Karolinger, Erzbischof Hinkmar, politische Geschichte Frankreichs, religiöse Geschichte Frankreichs, mittelalterliche Architektur, königliche Bestattung, Dynastiewechsel.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit zeigt den Prozess der Transformation von Saint-Remi von einer bischöflichen Grabkirche zu einer bedeutenden königlichen Grabstätte auf und analysiert die Faktoren, die zu diesem Wandel beitrugen, unter Berücksichtigung politischer, religiöser und architektonischer Aspekte.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2004, Das Kloster Saint-Remi - Vom Aufstieg einer bischöflichen Grabkirche zur königlichen Nekropole , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/56387