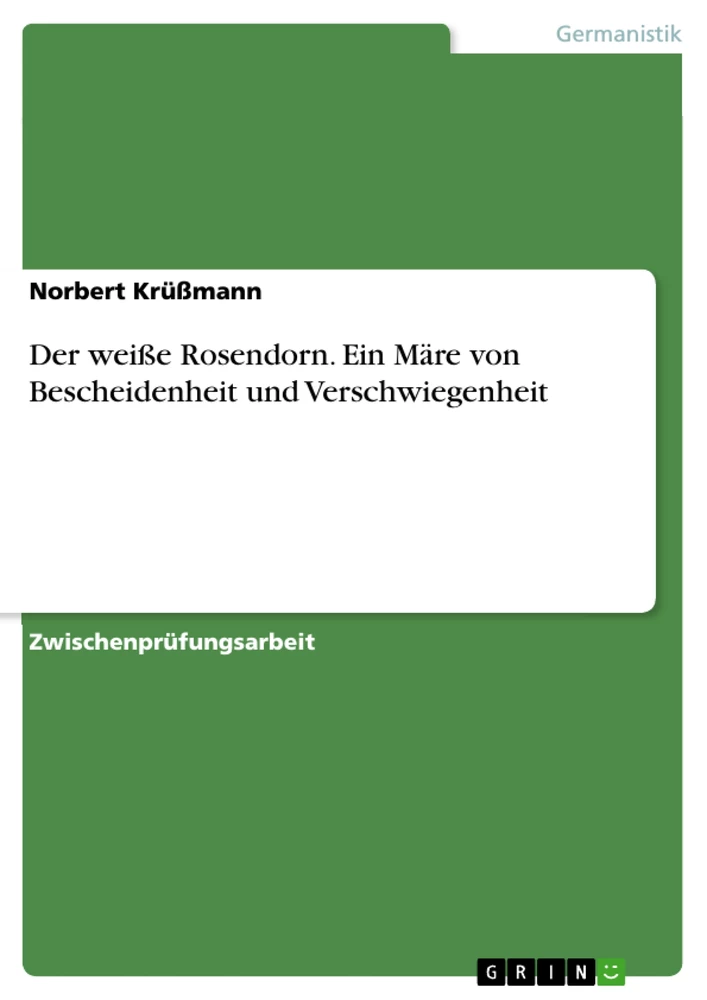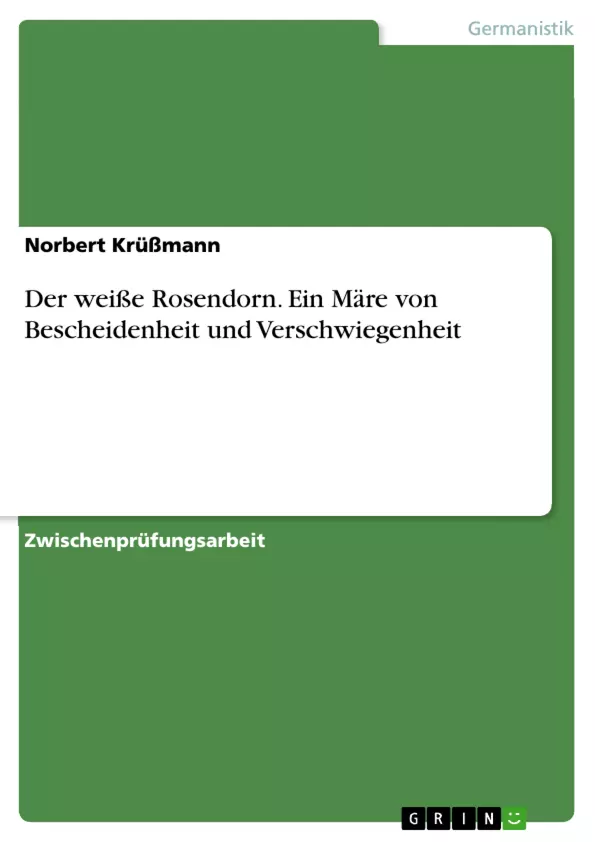Das Schwankmäre "Der Rosendorn", auch überliefert als "Vô den wurczgarten" und "Vô dem weissen rosen dorn", das in der Forschung bisher vor allem unter gattungsspezifischen Gesichtspunkten behandelt wurde, wird erstmals inhaltlich interpretiert. Dabei werden besonders die Metaphernfelder von Sexualität und Kommunikation erörtert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Inhalt
- Der Rahmenmonolog
- Das Exposé
- Das Streitgespräch
- Die Probe
- Das glückliche Ende
- Ausdeutung
- Hybris und Bescheidenheit
- Verschwiegenheit und Öffentlichkeit
- Die Moral
- Schluß
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die mittelhochdeutsche Märe „Der weiße Rosendorn“ (RO I), fokussiert auf die Rekonstruktion des Textes durch Hanns Fischer und analysiert dessen symbolische Sprache und Thematik. Ziel ist es, zwei neue thematische Ansätze zur Diskussion um dieses umstrittene Werk beizusteuern.
- Die Rolle des Ich-Erzählers und seine Interaktion mit dem Publikum.
- Die symbolische Bedeutung des Gartens und des weißen Rosendorns.
- Die Auseinandersetzung mit den Themen Hybris und Bescheidenheit.
- Der Gegensatz zwischen Verschwiegenheit und Öffentlichkeit.
- Die moralische Botschaft des Märe.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung präsentiert die älteste erhaltene Überlieferung der Märe „Der Rosendorn“, vergleicht sie mit einer späteren Bearbeitung (RO II) und kündigt den methodischen Ansatz der Arbeit an: Zunächst wird der Inhalt von RO I wiedergegeben und erläutert, anschließend erfolgt eine thematische Analyse anhand des Exposés (erste 50 Zeilen). Die Arbeit konzentriert sich auf RO I und lässt RO II weitgehend unberücksichtigt, da die Ergänzungen in RO II der eigentlichen Absicht des Märe widersprechen.
Inhalt: Der Rahmenmonolog: Dieser Abschnitt beschreibt den Rahmenmonolog des Ich-Erzählers, der die Authentizität der Geschichte betont und sich direkt an den Leser/Hörer wendet. Der Erzähler fungiert als beobachtende Nebenfigur, die aber am Ende der Handlung als Handlungsträger eingebunden wird. Die direkte Ansprache des Publikums dient der Steigerung der Spannung, der Erklärung des Geschehens und der Einbringung editorischer Anmerkungen. Die Bedeutung dieser direkten Ansprache und des Erzählers wird später näher untersucht.
Inhalt: Das Exposé: Die Zeilen 6-42 bilden das Exposé der Märe und beschreiben den Ort (ein Kräutergarten mit einem weissen Rosendorn) und die Atmosphäre. Die Symbolik des Gartens (zwischen locus amoenus und hortus conclusus) und des Rosendorns wird als zentral für die Handlung dargestellt. Der Ich-Erzähler wird als Beobachter eingeführt, der die Geschichte auslöst. Bevor die eigentliche Handlung beginnt, fragt der Erzähler das Publikum nach dessen Interesse, was sowohl die Spannung steigert als auch eine tiefer gehende Bedeutung haben könnte.
Schlüsselwörter
Mittelhochdeutsche Märe, Der weiße Rosendorn, Ich-Erzähler, Symbolanalyse, Hybris, Bescheidenheit, Verschwiegenheit, Öffentlichkeit, Exposé, Hanns Fischer, mittelhochdeutsche Literatur.
Häufig gestellte Fragen zu „Der weiße Rosendorn“
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die mittelhochdeutsche Märe „Der weiße Rosendorn“ (RO I), insbesondere die Rekonstruktion des Textes durch Hanns Fischer. Sie konzentriert sich auf die symbolische Sprache und Thematik des Werkes und trägt zwei neue thematische Ansätze zur Diskussion bei: die Rolle des Ich-Erzählers und seine Interaktion mit dem Publikum, sowie die symbolische Bedeutung des Gartens und des weißen Rosendorns. Zusätzlich werden die Themen Hybris und Bescheidenheit, der Gegensatz zwischen Verschwiegenheit und Öffentlichkeit und die moralische Botschaft des Märe untersucht.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Inhaltsteil (mit den Abschnitten „Der Rahmenmonolog“, „Das Exposé“, „Das Streitgespräch“, „Die Probe“, „Das glückliche Ende“), einen Ausdeutungsteil (mit den Abschnitten „Hybris und Bescheidenheit“, „Verschwiegenheit und Öffentlichkeit“, „Die Moral“) und einen Schluss. Der Fokus liegt auf RO I, wobei RO II weitgehend unberücksichtigt bleibt, da dessen Ergänzungen der ursprünglichen Absicht widersprechen.
Welche Methoden werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit verwendet eine methodische Herangehensweise, die zunächst den Inhalt von RO I wiedergibt und erläutert. Anschließend folgt eine thematische Analyse, die auf dem Exposé (erste 50 Zeilen) basiert. Es wird eine symbolische Analyse durchgeführt, wobei die Rolle des Ich-Erzählers und seine Interaktion mit dem Publikum besondere Beachtung finden.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Zentrale Themen sind die symbolische Bedeutung des Gartens und des weißen Rosendorns, die Auseinandersetzung mit Hybris und Bescheidenheit, der Gegensatz zwischen Verschwiegenheit und Öffentlichkeit und die moralische Botschaft der Märe. Die Arbeit untersucht auch die Funktion des Ich-Erzählers und seine direkte Ansprache des Publikums.
Was ist die Bedeutung des Ich-Erzählers?
Der Ich-Erzähler ist eine beobachtende Nebenfigur, die am Ende der Handlung als Handlungsträger eingebunden wird. Seine direkte Ansprache des Publikums dient der Steigerung der Spannung, der Erklärung des Geschehens und der Einbringung editorischer Anmerkungen. Die Arbeit analysiert die Bedeutung dieser direkten Ansprache und des Erzählers im Detail.
Welche Rolle spielt das Exposé?
Das Exposé (Zeilen 6-42) beschreibt den Ort (Kräutergarten mit weißem Rosendorn) und die Atmosphäre. Die Symbolik des Gartens (zwischen locus amoenus und hortus conclusus) und des Rosendorns wird als zentral für die Handlung dargestellt. Der Ich-Erzähler wird als Beobachter eingeführt, der die Geschichte auslöst. Die Frage des Erzählers nach dem Interesse des Publikums vor Beginn der eigentlichen Handlung steigert die Spannung und hat möglicherweise eine tiefere Bedeutung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Mittelhochdeutsche Märe, Der weiße Rosendorn, Ich-Erzähler, Symbolanalyse, Hybris, Bescheidenheit, Verschwiegenheit, Öffentlichkeit, Exposé, Hanns Fischer, mittelhochdeutsche Literatur.
Welche Version von „Der weiße Rosendorn“ steht im Mittelpunkt der Analyse?
Die Analyse konzentriert sich auf die älteste erhaltene Überlieferung der Märe „Der weiße Rosendorn“ (RO I) und berücksichtigt die Rekonstruktion durch Hanns Fischer. Die spätere Bearbeitung (RO II) wird weitgehend ignoriert, da deren Ergänzungen im Widerspruch zur ursprünglichen Absicht des Märe stehen.
- Arbeit zitieren
- Magister Artium Norbert Krüßmann (Autor:in), 2001, Der weiße Rosendorn. Ein Märe von Bescheidenheit und Verschwiegenheit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/56499