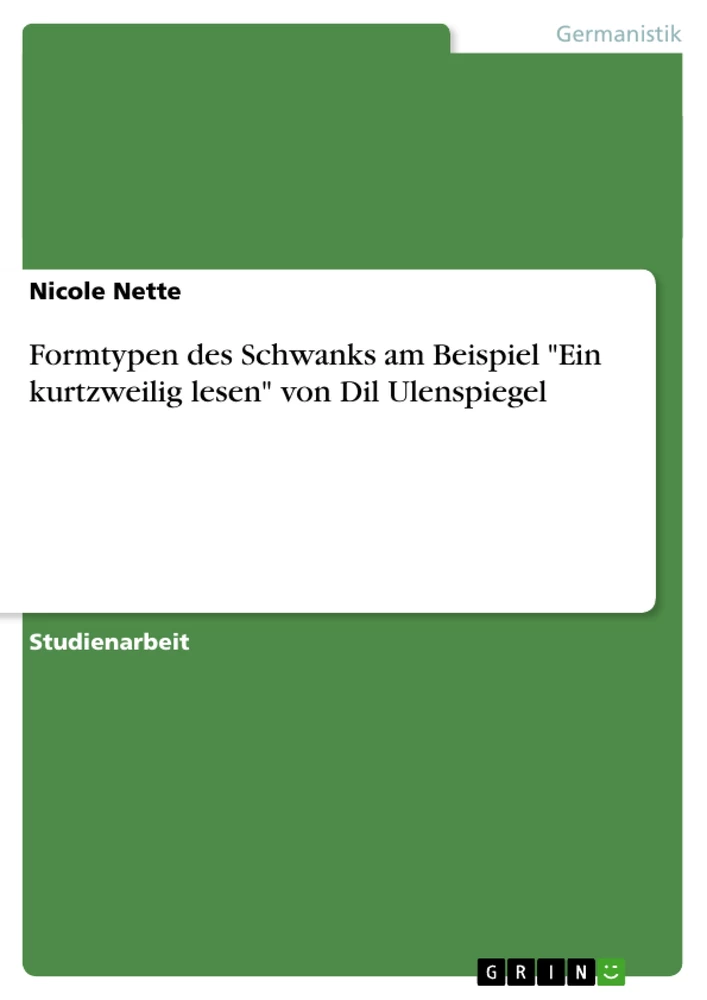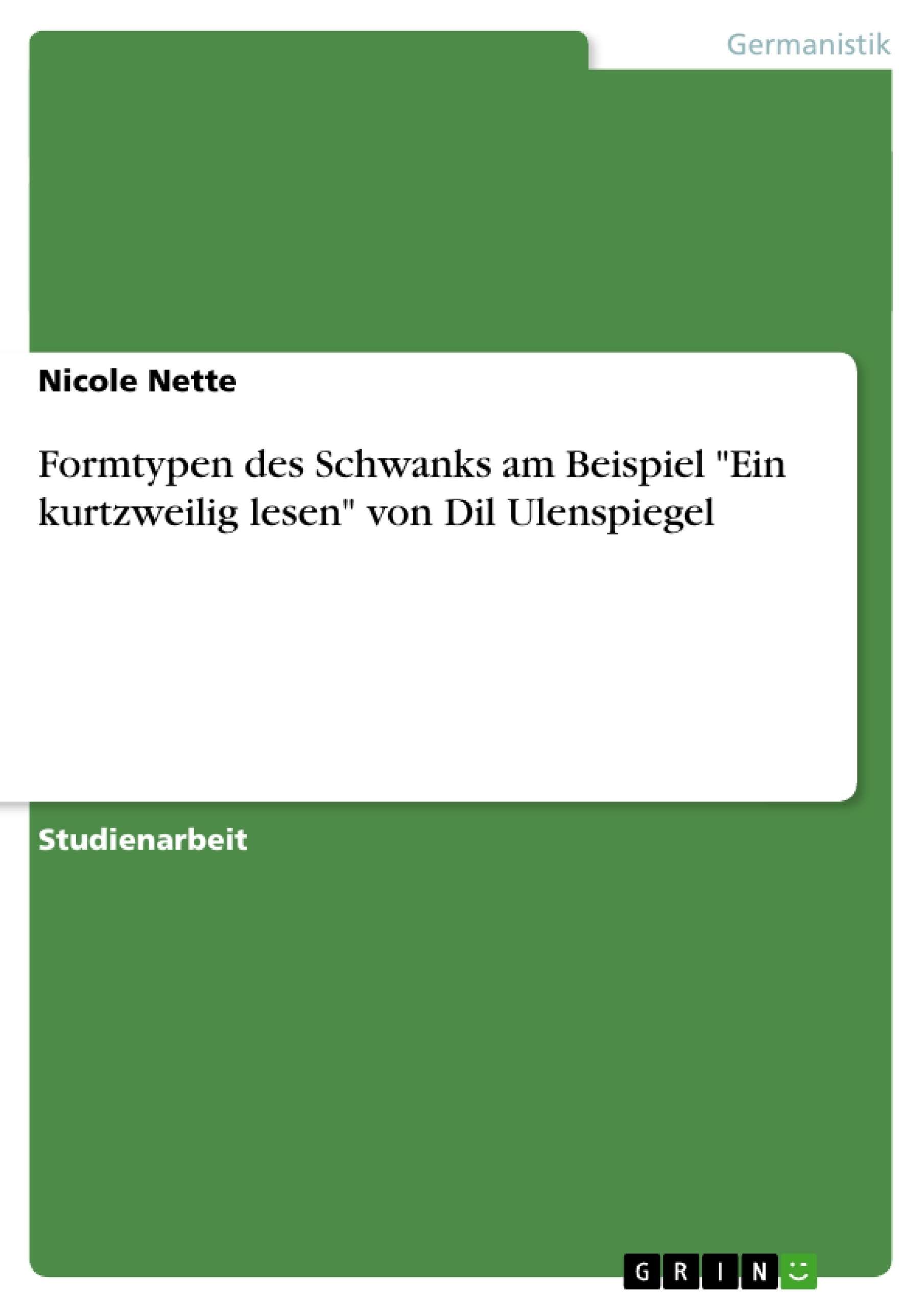Die vorliegende Arbeit gibt einen Überblick zu den Formtypen des Schwanks. Allerdings ist eine solche Kategorisierung problematisch, da der Schwank kein homogenes Genre ist. Um dieser besonderen Schwierigkeit Rechnung zu tragen, besteht die Arbeit aus zwei großen Kapiteln. Zum einen gliedert sie sich in den „Allgemeinen Teil“, welcher die grundlegenden Informationen zur Problematik „Formtypen des Schwank“ liefert und die aktuelle Forschungslage widerspiegelt und zum anderen in den „Anwendungsteil“, in welchem anhand von Hermann Botes „Dil Ulenspiegel“ versucht wird, die Zweckmäßigkeit der vorhandenen Kategorien zu verifizieren bzw. falsifizieren.
Im Allgemeinen Teil wird zunächst eine Gattungsdefinition gegeben, um eine Arbeitsgrundlage zu schaffen. Daraufhin folgt eine Darstellung der verschiedenen Versuche einer Formbeschreibung, wobei auf die Einteilung nach Bausinger ausführlicher eingegangen wird. Anschließend werden weitere Möglichkeiten zur Differenzierung der Form vorgestellt, die jedoch bislang nur als Ansatz formuliert wurden.
Im zweiten großen Abschnitt wird als erstes die gattungstypologische Einordnung des Schwankbuches von Hermann Bote vorgenommen, um die Auswahl dieses Schwanks zu begründen und überhaupt gültige Aussagen aus der Analyse des mittelalterlichen Schwankbuches vom Eulenspiegel ableiten zu können. Folgende Fragen stehen dabei im Mittelpunkt: Wieso eignet sich „Dil Ulenspiegel“ als Stellvertreter dieser Gattung? Gibt es Besonderheiten, welche Ihn gegenüber anderen Schwänken auszeichnet? Wie ist die Forschungslage diesbezüglich? Besteht Kohärenz zwischen den einzelnen Erzählungen, welche eine Verallgemeinerung für die gesamte Sammlung rechtfertigen würde? Erst im Anschluss daran können die allgemeinen Kriterien am Beispiel auf ihre Praktikabilität geprüft werden.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- Inhaltsangabe
- B. Der Schwank - Theorie
- 1. Gattungsproblematik
- 2. Versuche zur Bestimmung von Formtypen
- 2.1. Formbeschreibungen nach Peuckert
- 2.2. Formtypen nach Bausinger
- 2.3. Vorschläge nach Theiß
- C. Der Schwank - Anwendung
- 3. „Ulenspiegel“ im gattungstypologischen Kontext
- 4. Formtypen nach Bausinger im „Ulenspiegel“
- 4.1. Ausgleichstyp
- 4.2. Steigerungstyp
- 4.3. Spannungstyp und Schrumpftyp
- 4.4. Historie 21- ein Sonderfall
- D. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit zielt darauf ab, einen umfassenden Überblick über die Formtypen des Schwanks zu bieten. Sie untersucht die Schwierigkeit, den Schwank aufgrund seiner heterogenen Natur in feste Kategorien einzuteilen und analysiert verschiedene Ansätze zur Formtypenbestimmung.
- Gattungsproblematik des Schwanks
- Formtypenbestimmung nach Peuckert, Bausinger und Theiß
- Analyse der Formtypen im „Ulenspiegel“
- Verifizierung der Zweckmäßigkeit von Formtypenkategorien
- Bedeutung und Funktion von Formtypen im Rahmen der Schwankforschung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik der Formtypen des Schwanks vor und erläutert die Herausforderungen, die mit der Kategorisierung dieses Genres verbunden sind. Kapitel B widmet sich der Theorie des Schwanks, wobei es zunächst die Gattungsproblematik beleuchtet und die Definition des Begriffs „Schwank“ diskutiert. Anschließend analysiert es verschiedene Versuche zur Bestimmung von Formtypen, wobei der Schwerpunkt auf Bausingers Einteilung liegt. Kapitel C wendet die Erkenntnisse des theoretischen Teils auf das Beispiel des „Ulenspiegel“ an. Es untersucht die gattungstypologische Einordnung des Schwankbuches und analysiert verschiedene Formtypen nach Bausinger im „Ulenspiegel“.
Schlüsselwörter
Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Schwank, Gattung, Formtyp, Erzählstruktur, Gattungsgeschichte, Hermann Bote, „Ulenspiegel“, Bausinger, Theiß, Peuckert, mittelalterliche Literatur.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Schwank in der Literatur?
Ein Schwank ist eine kurze, oft komische Erzählung, die meist eine Pointe oder einen Streich beinhaltet. Er ist jedoch kein homogenes Genre, was die Kategorisierung erschwert.
Welche Formtypen des Schwanks unterscheidet Hermann Bausinger?
Bausinger unterscheidet unter anderem den Ausgleichstyp, den Steigerungstyp, den Spannungstyp und den Schrumpftyp basierend auf der Erzählstruktur.
Warum eignet sich „Dil Ulenspiegel“ zur Analyse von Schwanktypen?
Hermann Botes „Dil Ulenspiegel“ ist ein zentrales Werk der Gattung und bietet eine Vielzahl an Erzählungen, an denen sich theoretische Kategorien prüfen lassen.
Was ist die Gattungsproblematik beim Schwank?
Die Arbeit zeigt auf, dass der Schwank fließende Übergänge zu anderen Formen wie der Fabel oder dem Witz hat, was eine eindeutige Definition erschwert.
Welche Rolle spielen Peuckert und Theiß in der Schwankforschung?
Die Arbeit vergleicht Bausingers Modell mit den Formbeschreibungen von Peuckert und den Vorschlägen von Theiß, um die aktuelle Forschungslage abzubilden.
- Quote paper
- Nicole Nette (Author), 2006, Formtypen des Schwanks am Beispiel "Ein kurtzweilig lesen" von Dil Ulenspiegel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/57631