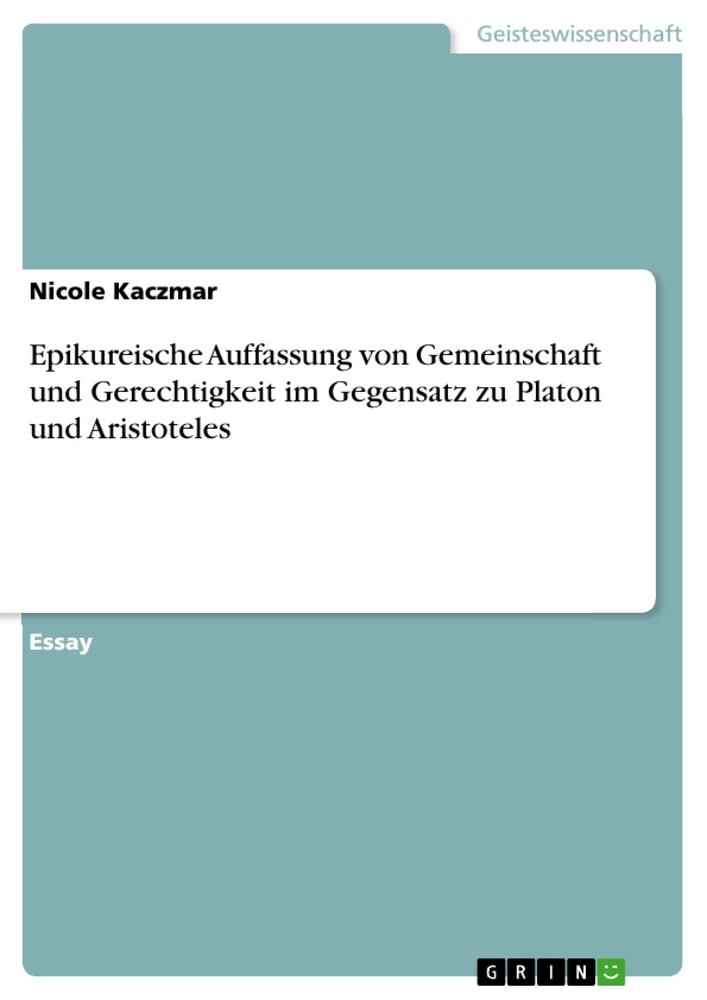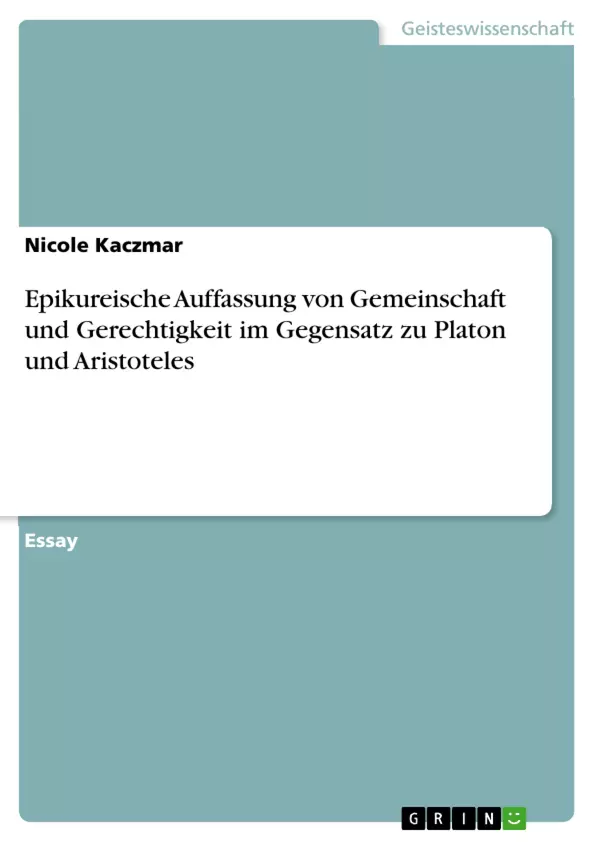Dieses Essay stellt Epikurs Auffassung von Gemeinschaft und Gerechtigkeit dar und diskutiert, inwieweit es als Gegenmodell zu den Auffassungen von Platon und Aristoteles gesehen werden kann. Die Unterschiede werden hinsichtlich des staatlichen Gemeinschaftsverständnisses, des Gerechtigkeitsansatzes und der natürlichen Bestimmung des Menschen diskutiert. In einem weiteren Punkt wird gezeigt, dass sich trotz der Unterschiede Gemeinsamkeiten aufzeigen lassen. Dabei wird auf den Nutzengedanken der Gerechtigkeit bei den Epikureern und Platon genauer eingegangen. Darüber hinaus wird das antike Argumentationsmuster, wie Städte schrittweise entstehen, welches sich sowohl bei den Epikureern als auch bei Platon und Aristoteles wiederfindet, als markantes Beispiel näher ausgeführt. Abschließend werden die Ergebnisse zusammengefasst.
1. Einleitung: Epikureische Auffassung von Gemeinschaft und Gerechtigkeit im Gegensatz zu Platon und Aristoteles
Die Epikureische Auffassung von Gemeinschaft und Gerechtigkeit wird oft als Gegenmodell zu den Auffassungen von Platon und Aristoteles gesehen. Im Folgenden wird die Epikureische Auffassung von Gemeinschaft und Gerechtigkeit aus LS 22 skizziert und anhand von drei Aspekten gezeigt, inwiefern sich diese zu den Auffassungen von Platon1 und Aristoteles unterscheidet. Die drei Unterschiede werden hinsichtlich des staatlichen Gemeinschaftsverständnisses, des Gerechtigkeitsansatzes und der natürlichen Bestimmung des Menschen diskutiert. In einem weiteren Punkt wird gezeigt, dass sich trotz der Unterschiede Gemeinsamkeiten aufzeigen lassen. Dabei wird auf den Nutzengedanken der Gerechtigkeit bei den Epikureern und Platon genauer eingegangen. Darüber hinaus wird das antike Argumentationsmuster, wie Städte schrittweise entstehen, welches sich sowohl bei den Epikureern als auch bei Platon und Aristoteles wiederfindet, als markantes Beispiel näher ausgeführt. Abschließend werden die Ergebnisse zusammengefasst.
2. Unterschiede im Gerechtigkeits- und Gemeinschaftsverständnis: Platon, Aristoteles und die Epikureer
Vorab ist zu bemerken, dass die Epikureer im Vergleich zu allgemeinen antiken Annahmen aufgrund der damaligen politischen Verhältnisse eine andere Sichtweise auf die Politik und das Individuum einnehmen (vgl. Bengtson, 1988). Bei den Epikureern wird weder der Fokus auf die Polis als natürliche Gemeinschaft gelegt noch das Leben in einer Polis als natürliche Entwicklung des Menschen angesehen wie es bei Platon und Aristoteles dargestellt ist.
Die Epikureer nehmen eine kritische Stellung zur Polis ein. Sie fordern, dass man sich nicht aktiv um politische Angelegenheiten kümmern sollte, denn ihrer Meinung nach bietet das Engagement um politische Ämter und öffentliches Ansehen kaum Aussicht auf Sicherheit, welche jedes Individuum aus hedonistischer Sicht anstrebt. Schließlich kann durch die Befriedigung des Sicherheitsbedürfnisses ein hohes Maß an Lust und Seelenruhe (ataraxia) generiert werden (vgl. LS 22 C (1), D (1) & Kommentar S. 159). In dieser Einstellung ist ein erster Unterschied zur Auffassung von Aristoteles zu erkennen. Aristoteles vertritt die These, dass man sich politisch engagieren sollte. Ein guter Bürger sollte sich aktiv um den Erhalt der Staatsgemeinschaft und der Verfassung kümmern. Dafür beschreibt Aristoteles in Pol. III 1-2, 4 ausführlich die Pflichten und die Tugend eines guten Staatsbürgers. Darüber hinaus vertritt Aristoteles die These, dass sich erst in der Polis der wesenseigene Sinn für Gerechtigkeit des Menschen verwirklicht und er nur in dieser ein glückliches Leben führen kann (vgl. Pol. I 2 / Pol. III 7). Für Aristoteles besteht also ein gutes Leben darin, „in Aktion zu sein“ und seine Tugenden auszuführen, während für die Epikureer ein gutes Leben durch Seelenruhe gekennzeichnet ist.
Ein zweiter Unterschied ist, dass die Epikureer von anderen Hintergrundannahmen über die Gerechtigkeit ausgehen als Platon und Aristoteles. Man kann sagen, dass die Epikureer einen positivistischen Gerechtigkeitsansatz vertreten. Aristoteles und Platon hingegen befürworten einen nicht positivistischen Gerechtigkeitsansatz. Allgemein gesprochen, beruht der Positivismus auf Erkenntnissen durch Beobachtungen, die den Charakter von Wissen haben. Für die Epikureer sind Beobachtungen hinreichend dafür zu sehen, was schädlich oder nützlich ist, um darauf aufbauend Gesetze zu formulieren (vgl. LS 22 M (4)). Weiterhin betonen die Epikureer, dass die Gesetzgebung zum Vorteil sozialer Gruppierungen dient und es nur regelhafte Gründe gibt, Gesetze zu erlassen (vgl. LS 22 N (4) – (6)). Epikurs Auffassung von Gerechtigkeit wird in LS 22 in den Abschnitten A-D diskutiert. Für Epikur existiert Gerechtigkeit nicht per se, sondern kann als Vertrag, als eine Übereinkunft über das Zuträgliche bezeichnet werden, sich nicht gegenseitig zu schaden und schaden zu lassen (vgl. LS 22 A (1)). Gerechtigkeit kann also nur zwischen Lebewesen entstehen, wenn man mit ihnen einen Vertrag schließen kann. So stellt für Epikur die Ungerechtigkeit auch nicht per se ein Übel dar. Ungerechtigkeit liegt vor, wenn ein Vertrag gebrochen wird. Wenn ein Vertrag gebrochen wird, so wird dies bestraft. Dieses Vorgehen soll als Abschreckungsmaßnahme dienen, Verträge nicht zu brechen (vgl. LS 22 A (4) – (5)). In Abschnitt B erläutert Epikur, dass es eine allgemeine Gerechtigkeit für das Gemeinwesen gibt. Bei der allgemeinen Gerechtigkeit ist das Gerechte für alle dasselbe, weil es für alle nützlich in sozialen Beziehungen ist. Epikur beschreibt auch eine spezielle Gerechtigkeit, die besagt, dass es an unterschiedlichen Orten verschiedene Übereinkünfte darüber gibt über das was nützlich ist. Somit gibt es unterschiedliche Übereinkünfte über die Gerechtigkeit (vgl. LS 22 B (1) – (2)). Gerechtigkeit ist für Epikur Mittel zum Zweck, da die Gerechtigkeit Sicherheit bietet und dadurch die Seelenruhe fördert. So ist für Epikur das gerechte Leben am freiesten von Unruhe (vgl. LS 22 A (3)). Nach der epikureischen Auffassung wird man bestraft, wenn man den Vertrag und die dadurch entstandene Gerechtigkeit bricht. Man trägt also einen Schaden davon, wenn man sich nicht gerecht verhält. Die Theorie der Epikureer kann als „Sanktionentheorie der Gerechtigkeit“ bezeichnet werden. Der Grund nicht ungerecht zu sein ist die Angst vor der Strafe, während der Grund gerecht zu sein das Bedürfnis nach Sicherheit ist. Diese Sicherheit ist dadurch gegeben, sich durch den Vertragsabschluss nicht gegenseitig zu schaden (vgl. LS 22 A, C, N). Wenn ein Mensch nicht einsieht, dass ihn gerechtes Verhalten zur angestrebten Seelenruhe verhilft, dann muss er zumindest einsehen, dass er durch das Gesetz bestraft wird und dass er dadurch einen Schaden davonträgt (vgl. LS 22 M (2) – (3) / (7)). Dabei fällt auf, dass sich in der epikureischen Gerechtigkeitsauffassung moralisches Verhalten an Nutzenkalkülen orientiert. Dies erinnert stark an einen utilitaristischen Gerechtigkeitsansatz. Zu bemerken ist auch, dass durch diesen Ansatz der Gerechtigkeit kein intrinsischer Wert zukommt. Sowohl Platon als auch Aristoteles vertreten eine andere Auffassung von Gerechtigkeit, da sie Gerechtigkeit in Verbindung von Tugendhaftigkeit sehen und dadurch der Gerechtigkeit einen intrinsischen Wert beimessen. Nach Platon ist es gut gerecht zu sein, weil es gesund für die Seele ist. Die Gerechtigkeit ist also eine Funktion der Seele. Eine gerechte Seele führt zu einem glücklichen Leben (vgl. Politeia 353d). Gerechtigkeit wird bei Platon also nicht durch einen Vertrag „von außen“ erzeugt, sondern durch eine innere Haltung der Seele gelebt. Aristoteles hingegen vertritt unter anderem den Ansatz einer Verteilungsgerechtigkeit. Gerecht ist für ihn, wenn „Gleiche Gleiches“ und „Ungleiche Ungleiches“ erhalten. Er stellt dies in Bezug auf die Zuteilung von politischen Ämtern. Die Tugendhaftigkeit des Staatsbürgers ist dabei ausschlaggebend für die Zuteilung von Ämtern (vgl. Pol. III, 4, 9). So betont auch Aristoteles den Zusammenhang von Gerechtigkeit und Tugendhaftigkeit.
Ein dritter Unterschied bezieht sich auf die verschiedenen Auffassungen der natürlichen Bestimmung des Menschen. Vorab ist zu erwähnen, dass die Epikureer die Auffassung eines motivationalen Hedonismus vertreten. Der Hedonismus besagt, dass Lust das einzige Gut und Schmerz das einzige Schlechte im Leben ist. Das was einen anregt etwas zu tun, ist rein das Streben nach Lust und die Vermeidung von Schmerz, im weiteren Sinne vor allem durch Angst (vgl. Bengtson, 1988). Der Mensch lebt nach der Epikureischen Auffassung nur in Gemeinschaften und in einem Staat, da er durch technische Erfindungen verweichlicht und nun schutzbedürftig ist. Durch Gemeinschaftsverträge ist ihm Sicherheit gegeben und das mindert seine Angst (vgl. LS 22 B, C). Im ursprünglichen Zustand waren die Menschen stark und „wußten im Umgang untereinander noch nicht, von Sitten und Gesetzen Gebrauch zu machen“ (LS 22 J (4)). Die Epikureer vertreten also nicht die Meinung, dass der Mensch von Natur aus danach strebt, in Gemeinschaften zu leben. Platon hingegen ist der Meinung, dass der Mensch von Natur aus aufgrund seiner Bedürftigkeit und Endlichkeit nicht autark sein kann, sondern von vornherein als ein soziales Wesen aufgefasst werden muss. Gemeinschaften entstehen nach ihm zwangsläufig, da man sich selbst nicht genügt, sondern viele braucht (vgl. Politeia, 368b). Auch Aristoteles befürwortet die These, dass der Mensch von Natur dazu bestimmt ist in einer Gemeinschaft zu leben. Das Ziel des Menschen ist es in einer Polis zu leben, da nur durch die Gemeinschaft sein höchstes Lebensziel, nämlich die Führung eines selbstgenügsamen Lebens, erreicht werden kann (vgl. Pol. I 1-2).
3. Gemeinsamkeiten im Gerechtigkeits- und Gemeinschaftsverständnis: Platon, Aristoteles und die Epikureer
Festzuhalten ist, dass das Lebensziel der Epikureer das Erreichen der Seelenruhe ist. Die Seelenruhe kann man nur erreichen, wenn man gerecht ist und Gerechtigkeit kann nur entstehen, wenn man Verträge darüber abschließt, sich nicht gegenseitig zu schaden (vgl. LS 22, A-D). Der Nutzen der Gerechtigkeit wird dabei klar hervorgehoben. Auch Platon verbindet Gerechtigkeit mit einem Nutzengedanken. Denn Gerechtigkeit ist seiner Meinung nach gegeben, wenn jeder das Seinige tut und zwar das, was er von Natur aus am besten kann (433a-b). Das Gerechtigkeitsverständnis, das in der Politeia beschrieben wird, beschreibt den Ansatz einer „effektiven Arbeitsteilung“, sodass hier auch der Nutzengedanken der Gerechtigkeit erkennbar ist.
Eine weitere Gemeinsamkeit kann hinsichtlich des Argumentationsaufbaus wie Gemeinschaften/Städte entstehen, erkannt werden. Die genetische Entwicklung einer Stadt kann als typisches antikes Argumentationsmuster angesehen werden. So beschreiben die Epikureer den Entwicklungsprozess wie folgt: Am Anfang des Menschengeschlechts lebt der Mensch abgehärtet und stark wie ein wildes Tier. Durch technische Erfindungen wie zum Beispiel den Hausbau oder das Feuermachen wird der Mensch faul und verweichlicht. Er beginnt soziale Beziehungen einzugehen. Ehen werden geschlossen und Familien gegründet. Daraus entwickelt sich ein gewisses Bedürfnis nach Schutz. Deswegen schließt der Mensch mit seinen Nachbarn Verträge, um sich nicht gegenseitig zu schaden. Dies bietet Schutz vor den Nachbarn. Schließlich entstehen ganze Städte mit einer Organisation. Die Städte werden von Königen regiert und es entsteht Reichtum und Luxus. Durch Reichtum wiederum entsteht Neid. Dies führt zur Unruhe in der Stadtgemeinschaft. Deswegen müssen Gesetze erlassen und Sanktionen eingeführt werden, damit die Menschen ein Leben in Sicherheit und Ruhe führen können. Durch Gesetze und Sanktionen ist der einfache Mensch dazu gezwungen ein gerechtes Leben zu führen, weil er Angst vor Bestrafung hat (vgl. LS 22 J-L). Auch Platon beschreibt in einem genetischen Ansatz wie Städte entstehen. Er unterscheidet dabei vier „Phasen“: In der ersten Phase wird beschrieben, dass Gemeinschaften aus einem Bedürfnis beziehungsweise aus einem gewissen Eigeninteresse entstehen, da der Mensch von Natur aus andere braucht um zu überleben. In der zweiten Phase wird das Modell der „einfachen Stadt“ erörtert. In einer einfachen Stadt werden die notwendigen Bedürfnisse, die das reine Überleben der Einzelnen betreffen, gestillt. Folglich herrscht in der einfachen Stadt das Prinzip der Mäßigkeit. Als dritte Phase beschreibt Platon die „aufgeschwemmte Stadt“. Diese muss entstehen, da die menschlichen Bedürfnisse über die Bedürfnisse, die das reine Überleben betreffen, hinausgehen, wie zum Beispiel das Bedürfnis nach üppigen Speisen oder das Vergnügen durch die Künste (vgl. 372e, 373a-b). Je mehr Bedürfnisse der Mensch hat, desto mehr Besitz braucht er, um diese Bedürfnisse befriedigen zu können. Da die Bedürfnisse immer weiterwachsen, braucht man immer mehr unangemessenen Besitz. Dieser zusätzliche Besitz steht einem nicht zu und muss erobert werden. Deshalb werden auch Wächter notwendig, die die Stadt verteidigen und für Stabilität sorgen. Der Wächterstaat kann als vierte Phase bezeichnet werden (vgl. 369b-373e). Auch Aristoteles beschreibt in Pol. I 1-2 einen natürlichen „Wachstumsprozess“ von Gemeinschaften. Aristoteles unterscheidet in Buch I 2 fünf Gemeinschaftsformen, die „von Natur aus bestehen“ müssen, da sie sich aufgrund menschlicher Bedürfnisse bilden. Die kleinste Gemeinschaft ist die zwischen Mann und Frau, die notwendigerweise bestehen muss, da sie aus dem Zweck der Fortpflanzung entsteht. Anschließend folgt die Gemeinschaft von Herr und Sklave, die sich aus dem Zweck des Überlebens heraus ergibt. An dritter Stelle folgt die Gemeinschaft des Hauses, die sich aus dem Zweck des täglichen Lebens der Mitglieder ergibt. An vierter Stelle steht das Dorf, das aus mehreren Häusern besteht. Das Dorf entwickelt sich als Gemeinschaft, da der Mensch Bedürfnisse hat, die über das tägliche Leben hinausgehen. Diese können durch die Gemeinschaft in einem Dorf gestillt werden. An fünfter und letzter Stelle steht die Polis, die sich aus mehreren Dörfern bildet. Diese Form der Gemeinschaft entsteht, da alle Menschen von Natur aus den Zweck verfolgen, ein selbstgenügsames und gutes, das heißt glückliches Leben zu führen.
Auffallend bei allen drei Erklärungen, warum Gemeinschaften/Städte entstehen, ist, dass es immer eine Phase gibt, in der die Menschen ein Level erreichen, bei dem mehr als die Grundbedürfnisse des Menschen gestillt werden. Durch Reichtum und Luxus entstehen Gemeinschaftsgebilde mit Herausforderungen, die es durch eine städtische Organisationsform zu regulieren gilt.
4. Zusammenfassung
In der vorliegenden Arbeit wurde die epikureische Auffassung von Gemeinschaft und Gerechtigkeit aus LS 22 dargestellt und gezeigt, inwiefern sich die Instrumentalisierung von Gerechtigkeit bei den Epikureern zu der Auffassung von Platon und Aristoteles unterscheidet. Die drei Unterscheidungen wurden hinsichtlich des staatlichen Gemeinschaftsverständnisses, des Gerechtigkeitsansatzes und der natürlichen Bestimmung des Menschen diskutiert. Dabei wurde deutlich, dass die Epikureer in einer anderen Art und Weise über die Natur des Menschen sprechen. Das oberste Ziel aller Handlungen im Leben für die Epikureer ist es, Seelenruhe zu erreichen. In einem weiteren Punkt wurde skizziert, dass sich trotz der Unterschiede Gemeinsamkeiten aufzeigen lassen. Dabei wurde auf den Nutzengedanken der Gerechtigkeit bei den Epikureern und Platon genauer eingegangen. Darüber hinaus wurde das antike Argumentationsmuster, wie Städte schrittweise entstehen, als markantes Beispiel näher ausgeführt. Dieses Argumentationsmuster ist sowohl bei den Epikureern, bei Platon als auch bei Aristoteles zu erkennen.
Literaturverzeichnis:
Bengtson, H. (1988). Die hellenistische Weltkultur . Wiesbaden: Franz Steiner Verlag.
Long, A.A. & Sedley, D.N. (2000). Die hellenistischen Philosophen. Stuttgart/Weimar: Verlag. (Text wurde im Seminar zur Verfügung gestellt)
Wolf, U. (1994). Aristoteles. Politik. (4. Aufl.). Reinbek: Rowohlt Taschenbuch Verlag. (Text wurde im Seminar zur Verfügung gestellt)
Wolf, U. (2004). Platon. Sämtliche Werke. Band 2 . Reinbek: Rowohlt Taschenbuch. (Text wurde im Seminar zur Verfügung gestellt)
[...]
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Einleitung des Textes?
Die Einleitung behandelt die epikureische Auffassung von Gemeinschaft und Gerechtigkeit im Gegensatz zu den Auffassungen von Platon und Aristoteles. Es wird die epikureische Sichtweise aus LS 22 skizziert und anhand von drei Aspekten die Unterschiede zu Platon und Aristoteles aufgezeigt: staatliches Gemeinschaftsverständnis, Gerechtigkeitsansatz und natürliche Bestimmung des Menschen.
Welche Unterschiede im Gerechtigkeits- und Gemeinschaftsverständnis werden zwischen Platon, Aristoteles und den Epikureern diskutiert?
Die Unterschiede liegen im staatlichen Gemeinschaftsverständnis, dem Gerechtigkeitsansatz und der natürlichen Bestimmung des Menschen. Die Epikureer nehmen eine kritische Haltung zur Polis ein, vertreten einen positivistischen Gerechtigkeitsansatz (im Gegensatz zu Platon und Aristoteles) und haben eine andere Auffassung von der natürlichen Bestimmung des Menschen, basierend auf motivationalem Hedonismus.
Was ist der positivistische Gerechtigkeitsansatz der Epikureer?
Die Epikureer betonen, dass Gesetze aufgrund von Beobachtungen dessen, was schädlich oder nützlich ist, formuliert werden. Gerechtigkeit ist für sie ein Vertrag, eine Übereinkunft, sich nicht gegenseitig zu schaden. Es ist ein Mittel zum Zweck, da Gerechtigkeit Sicherheit bietet und dadurch Seelenruhe fördert. Moral ist an Nutzenkalkülen orientiert.
Wie unterscheidet sich die Auffassung der natürlichen Bestimmung des Menschen bei den Epikureern von der bei Platon und Aristoteles?
Die Epikureer glauben nicht, dass der Mensch von Natur aus danach strebt, in Gemeinschaften zu leben. Sie argumentieren, dass Menschen nur in Gemeinschaften und Staaten leben, weil sie durch technische Erfindungen verweichlicht und schutzbedürftig geworden sind. Platon und Aristoteles hingegen sehen den Menschen als von Natur aus soziales bzw. politisches Wesen.
Welche Gemeinsamkeiten im Gerechtigkeits- und Gemeinschaftsverständnis lassen sich zwischen Platon, Aristoteles und den Epikureern feststellen?
Eine Gemeinsamkeit ist der Nutzengedanke der Gerechtigkeit. Die Epikureer verbinden Gerechtigkeit mit dem Nutzen, Seelenruhe zu erlangen, während Platon Gerechtigkeit mit der effektiven Arbeitsteilung in Verbindung bringt. Auch das Argumentationsmuster der schrittweisen Entstehung von Städten findet sich bei allen drei Philosophen wieder.
Wie beschreiben die Epikureer, Platon und Aristoteles die Entstehung von Gemeinschaften/Städten?
Alle drei beschreiben eine Art von genetischer Entwicklung, bei der Gemeinschaften aus Bedürfnissen entstehen und sich weiterentwickeln. Es gibt eine Phase, in der mehr als die Grundbedürfnisse gestillt werden, was zu Herausforderungen führt, die durch städtische Organisationen reguliert werden müssen.
Was ist die Zusammenfassung der Arbeit?
Die Arbeit hat die epikureische Auffassung von Gemeinschaft und Gerechtigkeit dargestellt und die Unterschiede zur Auffassung von Platon und Aristoteles hinsichtlich des staatlichen Gemeinschaftsverständnisses, des Gerechtigkeitsansatzes und der natürlichen Bestimmung des Menschen hervorgehoben. Trotz Unterschiede wurden Gemeinsamkeiten, wie der Nutzengedanke der Gerechtigkeit und das Argumentationsmuster der Entstehung von Städten, aufgezeigt.
Welche Literatur wird in dem Text verwendet?
Die verwendete Literatur umfasst Werke von Bengtson (Die hellenistische Weltkultur), Long & Sedley (Die hellenistischen Philosophen), Wolf (Aristoteles. Politik.) und Wolf (Platon. Sämtliche Werke. Band 2).
- Arbeit zitieren
- Nicole Kaczmar (Autor:in), 2018, Epikureische Auffassung von Gemeinschaft und Gerechtigkeit im Gegensatz zu Platon und Aristoteles, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/585091