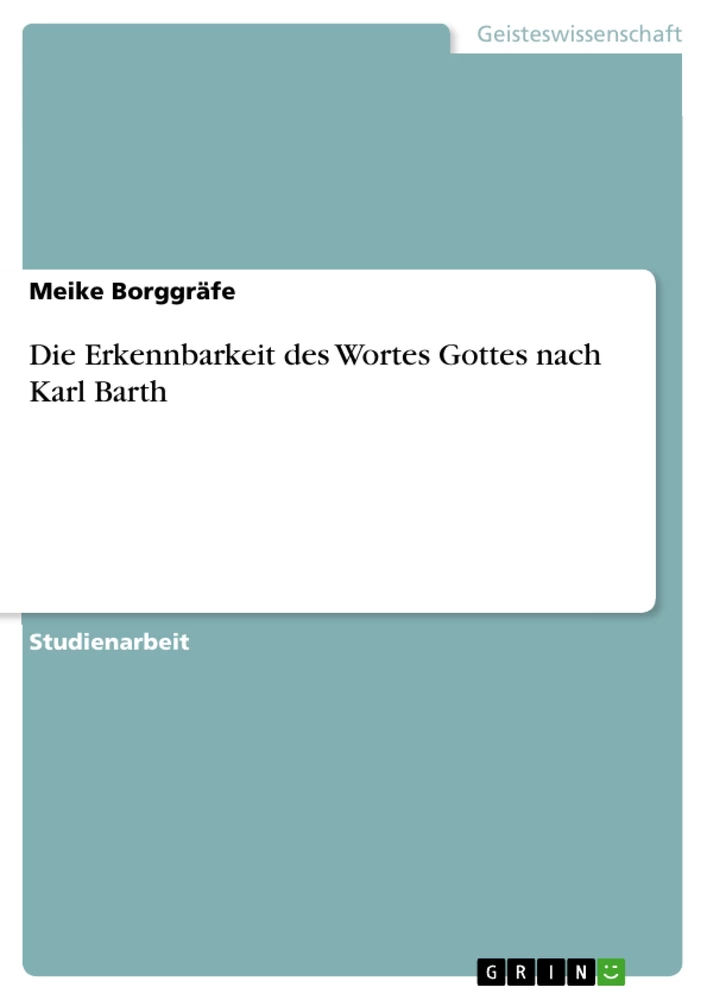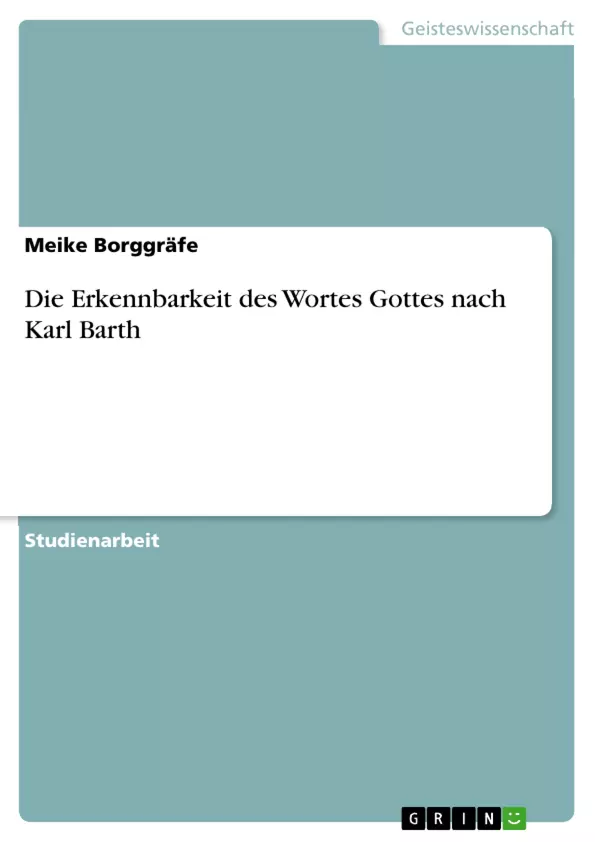Die kirchliche Dogmatik beschäftigt sich mit der wissenschaftlichen Überprüfung der kirchlichen Verkündigung. Das Wort Gottes ist der Inhalt und der Auftrag für die kirchliche Verkündigung. Aus diesem Grund bedeutet die Bearbeitung der Frage nach der Erkennbarkeit des Wortes Gottes für die Dogmatik eine herausragende Aufgabe.
Karl Barth stellt heraus, dass der Begriff der kirchlichen Verkündigung und somit zugleich die Dogmatik bereits implizieren, dass es Menschen ermöglicht wird, das Wort Gottes wahrzunehmen und auch es zu äußern.
Die Bedingungen und die Umstände für die Erkennbarkeit des Wortes Gottes können aber erst dann ergründet werden, wenn die Fragestellung richtig formuliert ist. Denn eine falsch formulierte Ausgangsfrage setzt mitunter fehlgeleitete Prämissen für eine Beantwortung, die jegliche Bearbeitung des problematisierten Gegenstandes unmöglich machen, weil jede Bemühung in eine falsche Richtung führen würde.
Der Autor hält in seinen Ausführungen fest, dass „Menschen – nicht alle Menschen, aber bestimmte Menschen, auch diese bestimmten Menschen nicht immer und überall, aber in bestimmter Situation – das Wort Gottes erkennen“. So allgemein und unbestimmt diese Aussage gehalten ist, so betont sie aber die grundsätzliche Möglichkeit dieser Erkenntnis, denn ansonsten wäre der Inhalt der Verkündigung ohne Inhalt, also eine leere Hülle. Die Notwendigkeit der Existenz dieses Erkenntnisinhaltes wird im Zusammenhang mit der Erläuterung des Begriffs der Erkenntnis in Kapitel 3 begründet.
Grundsätzlich muss eine hypothetische Fragestellung gewählt werden, wenn es um die Erkennbarkeit des Wortes Gottes geht. Wenn nämlich danach gefragt würde, wie Menschen das Wort Gottes erkennen, dann würde diese Formulierung eine Frage nach der Wirklichkeit dieser Erkenntnis bedeuten und somit zu ihrer Beantwortung das Wort Gottes selbst verlangen. Deswegen lautet die richtig gewählte Fragestellung: „Wie können Menschen das Wort Gottes erkennen?“, um nach der potentiellen Möglichkeit dieser Erkenntnis zu fragen.
Inhaltsverzeichnis
- Die Bedeutung einer richtig formulierten Fragestellung in Bezug auf die Erkennbarkeit des Wortes Gottes
- Die Beziehung zwischen dem Wort Gottes und dem Menschen
- Erörterung der grundlegenden Begriffe Erkenntnis, Erfahrung, Anerkennung
- Problematische Aspekte im Hinblick auf das Ereignis der Erkenntnis des Wortes Gottes
- Das Wort Gottes und der Glaube
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Buch analysiert die Erkennbarkeit des Wortes Gottes in der kirchlichen Dogmatik. Es stellt die Frage, wie Menschen das Wort Gottes erkennen können und welche Bedingungen und Umstände dafür notwendig sind. Der Autor beleuchtet verschiedene Perspektiven auf die Beziehung zwischen dem Wort Gottes und dem Menschen, insbesondere im Kontext der protestantischen Theologie und der Religionsphilosophie.
- Die Bedeutung einer präzisen Fragestellung für die Erkennbarkeit des Wortes Gottes
- Die Beziehung zwischen dem Wort Gottes und dem Menschen als Adressat und Träger
- Die Rolle des Menschen als Subjekt in der Erkenntnis des Wortes Gottes
- Die Auseinandersetzung mit verschiedenen theologischen Positionen zur Erkenntnis des Wortes Gottes
- Die Bedeutung der Gnade Gottes für die Möglichkeit der Erkenntnis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Bedeutung einer richtig formulierten Fragestellung in Bezug auf die Erkennbarkeit des Wortes Gottes
Dieses Kapitel betont die entscheidende Rolle einer präzisen Fragestellung für die Analyse der Erkennbarkeit des Wortes Gottes. Der Autor argumentiert, dass eine falsch formulierte Frage zu falschen Prämissen und somit zu einer unmöglichen Bearbeitung des Themas führt. Er stellt die Frage „Wie können Menschen das Wort Gottes erkennen?“ als die korrekte Fragestellung, die nach der potentiellen Möglichkeit der Erkenntnis fragt. Die Erkennbarkeit des Wortes Gottes wird als ein Akt der Gnade Gottes verstanden, der sich an auserwählte Menschen richtet.
Die Beziehung zwischen dem Wort Gottes und dem Menschen
Dieses Kapitel untersucht die Beziehung zwischen dem Wort Gottes und dem Menschen. Der Autor beleuchtet die Rolle des Menschen als Adressat und Träger des Wortes Gottes und die Schwierigkeiten, die sich aus dieser Beziehung ergeben. Er kritisiert den subjektivistischen Ansatz der protestantischen Theologie, der die Erkennbarkeit des Wortes Gottes auf eine allgemeine anthropologische Fähigkeit reduziert. Die Erkenntnis des Wortes Gottes wird als ein Ereignis betrachtet, das die menschliche Existenz durch die Gnade Gottes erneuert.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Buches sind: Wort Gottes, Erkennbarkeit, Erkenntnis, Dogmatik, Kirche, Verkündigung, Gnade, Mensch, Subjekt, Objekt, Beziehung, Offenbarung, Schrift, Predigt, Theologie, Religionsphilosophie.
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wort Gottes nach Karl Barth erkennbar?
Die Erkennbarkeit des Wortes Gottes wird als ein Akt der Gnade verstanden, der sich an bestimmte Menschen in bestimmten Situationen richtet.
Warum ist die richtige Fragestellung in der Dogmatik so wichtig?
Barth betont, dass eine falsche Frage (nach der Wirklichkeit statt der Möglichkeit) zu falschen Prämissen führt. Die korrekte Frage lautet: „Wie können Menschen das Wort Gottes erkennen?“
Welche Rolle spielt der Mensch als Subjekt in diesem Prozess?
Der Mensch ist zwar das Subjekt, das erkennt, aber diese Erkenntnis ist kein allgemeines anthropologisches Vermögen, sondern wird durch Gott ermöglicht.
Was kritisiert Barth an der subjektivistischen protestantischen Theologie?
Er kritisiert Ansätze, die die Erkennbarkeit Gottes auf eine rein menschliche Fähigkeit oder Erfahrung reduzieren, ohne die Souveränität Gottes zu berücksichtigen.
Was versteht man unter kirchlicher Verkündigung in diesem Kontext?
Die Verkündigung ist der Auftrag der Kirche, das Wort Gottes weiterzugeben. Die Dogmatik dient dazu, den Inhalt dieser Verkündigung wissenschaftlich zu prüfen.
- Quote paper
- Meike Borggräfe (Author), 2002, Die Erkennbarkeit des Wortes Gottes nach Karl Barth, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/585128