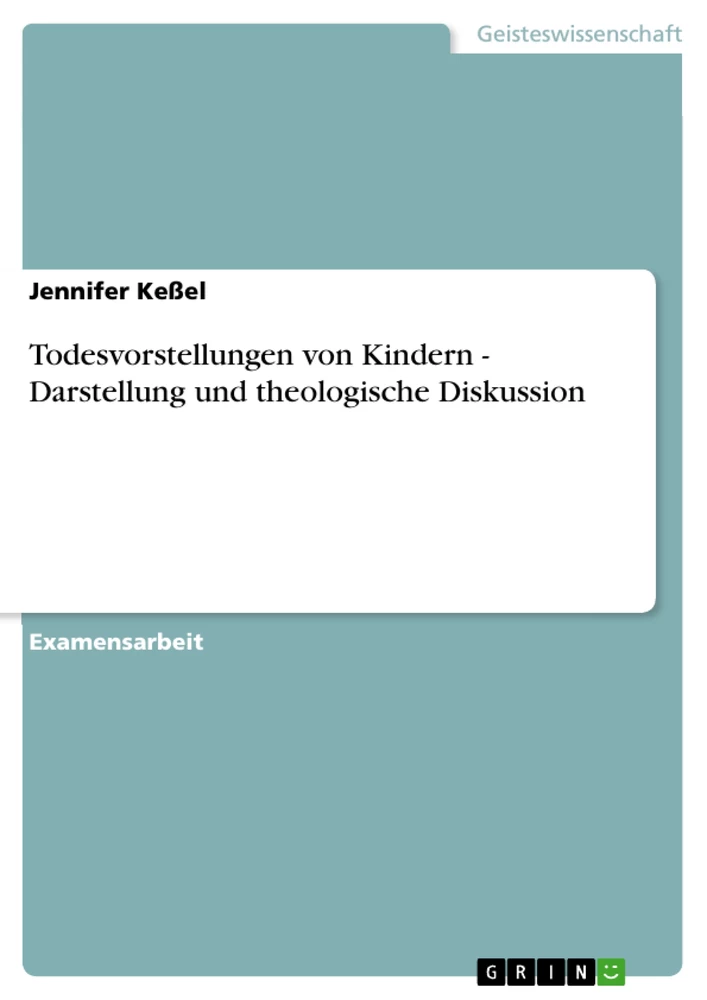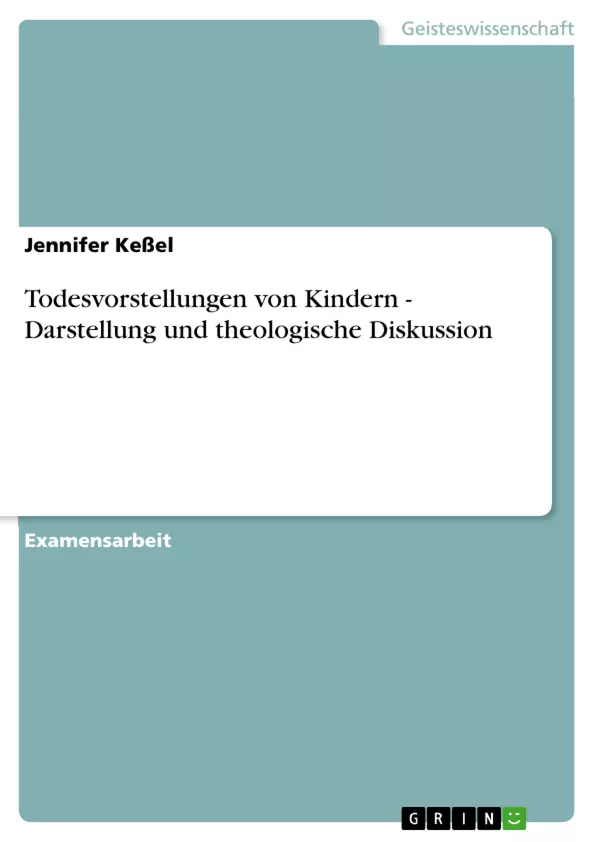Das Thema meiner Arbeit lautet: ‚Todesvorstellungen von Kindern. Darstellung und theologische Diskussion’. Ich selbst habe noch kaum Erfahrungen im Umgang mit dem Tod und mich bisher auch nicht mit diesem Thema beschäftigt. Ich bekam umso größere Reaktionen aus meinem Umfeld: ‚Oh, das ist aber kein schönes Thema!’, ‚Wie schrecklich.’ und ‚Kannst du das Thema nicht wechseln?’. Vereinzelt kamen aber auch Aussagen wie: ‚Das ist aber ein interessantes Thema.’. Die meisten Reaktionen auf mein Thema spiegeln die allgemeine Tabuisierung, Verdrängung und Privatisierung des Todes in der Gesellschaft wieder. Der Anfang des Lebens wird gefeiert und die Neugeborenen herzlich empfangen, das Ende, der Tod, wird aus der Gesellschaft ausgegrenzt und verdrängt. Die Menschen meiden die Konfrontation mit Sterbenden und damit einhergehend häufig auch mit Kranken und Alten, sie gehen diesen Lebenssituationen aus dem Weg. Dadurch erleben sie immer seltener eine direkte Konfrontation mit dem Tod und die Angst vor diesem Abschnitt des Lebens wird immer größer. Man kann fast sagen, die Menschen wollen die Todeswirklichkeit nicht mehr annehmen und manchmal auch nicht mehr hinnehmen. Sie wehren sich und versuchen mit allen Mitteln ihr Leben zu verlängern und dem Tod aus dem Weg zu gehen. Eine gewagte These meinerseits ist, sogar der heute vorherrschende Gesundheits- und Fitnesswahn ist eine anscheinende Möglichkeit der Verlängerung. Ob dies allerdings die Qualität des Lebens und somit auch des Todes steigert ist fraglich. Die Todesthematik ist also für Erwachsene schwierig und problembelastet, aber verbinden auch Kinder solch große Schwierigkeiten und Ängste damit? Um dies herauszufinden, möchte ich in meiner Arbeit die Todesvorstellungen von Kindern in den Mittelpunkt stellen. Das Ziel dieser Arbeit soll sein, durch einen Vergleich zwischen den Kindertheologien und der katholischen Theologie herauszufinden, ob die Vorstellungen ähnlich sind oder völlig widersprüchlich. Gibt es eine gemeinsame Basis oder stammen die Vorstellungen der Kinder heutzutage aus einer anderen Welt, die z.B. stark durch Medien geprägt ist? Aus diesen Ergebnissen möchte ich ein Resümee für den Religionsunterricht ziehen, das eventuell aufzeigt, wo es schon Anknüpfungspunkte zur Korrelation gibt. Wie möchte ich vorgehen? Zuerst stelle ich die ‚Kindertheologie’ vor, die ich im zweiten Schritt als Methode verwende, um die Todesvorstellungen der Kinder zu erfahren. [...]
Inhaltsverzeichnis
- I. EINLEITUNG
- II. KINDERTHEOLOGIE
- A. Begriffsklärung
- B. Entstehungsgeschichte
- C. Theorie der Kindertheologie:
- D. Kritik
- III. TODESVORSTELLUNGEN VON KINDERN
- A. Einleitung
- B. Kindliche Todesvorstellungen
- C. Praktischer Teil
- D. Kindertheologien zum Tod
- IV. THEOLOGIE DES TODES
- A. Verbindung von Leben und Tod
- B. Der natürliche Tod
- C. Leib-Seele- Trennung
- D. Endentscheidungshypothese
- E. Tod und Sünde
- F. Tod und Auferstehung Jesu Christi
- G. Gott- Mensch- Beziehung im Tod
- H.Die Vorstellung des ewigen Lebens als Vollendung im Zustand des „Bei- Gott- Seins❝
- V. AUSWERTUNG DER ARBEIT
- VI. SCHLUSSBETRACHTUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Todesvorstellungen von Kindern und untersucht deren Vergleichbarkeit mit der katholischen Theologie. Ziel ist es, herauszufinden, ob die Vorstellungen von Kindern und der katholischen Theologie übereinstimmen oder divergieren und ob es eine gemeinsame Grundlage für die Auseinandersetzung mit dem Tod gibt.
- Kindliche Todesvorstellungen und deren Entwicklung
- Einflussfaktoren auf die Todesvorstellungen von Kindern
- Theologische Konzepte zum Tod in der katholischen Theologie
- Vergleich der Kindertheologien mit der katholischen Theologie
- Potenzial der Todestheologie im Religionsunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
- I. Einleitung: Diese Einleitung erläutert das Thema der Arbeit, die allgemeine Tabuisierung des Todes in der Gesellschaft und die daraus resultierenden Ängste. Sie stellt die Forschungsfrage, ob Kinder ähnliche Schwierigkeiten und Ängste im Zusammenhang mit dem Tod haben und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit.
- II. Kindertheologie: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Kindertheologie und beleuchtet deren Entstehung und Entwicklung. Es erläutert verschiedene Theorien der Kindertheologie, darunter die „Theologie mit Kindern“, die „Theologie für Kinder“ und die „Theologie über Kinder“.
- III. Todesvorstellungen von Kindern: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Entwicklung von Todesvorstellungen bei Kindern, deren Bedingungsfaktoren und der empirischen Untersuchung der Todesvorstellungen von Kindern durch Bilder und Interviews.
- IV. Theologie des Todes: Dieses Kapitel behandelt die Verbindung von Leben und Tod in der katholischen Theologie, die Bedeutung des Todes im Leben des Menschen und die theologischen Konzepte zum natürlichen Tod, der Leib-Seele-Trennung, der Endentscheidungshypothese und Tod und Sünde.
- V. Auswertung der Arbeit: Dieses Kapitel vergleicht die Ergebnisse der empirischen Untersuchung der Todesvorstellungen von Kindern mit den Konzepten der katholischen Theologie und untersucht das Potenzial der Todestheologie im Religionsunterricht.
Schlüsselwörter
Kindertheologie, Todesvorstellungen, Tod, katholische Theologie, Religionsunterricht, Empirische Untersuchung, Bilder, Interviews.
- Quote paper
- Jennifer Keßel (Author), 2006, Todesvorstellungen von Kindern - Darstellung und theologische Diskussion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58541