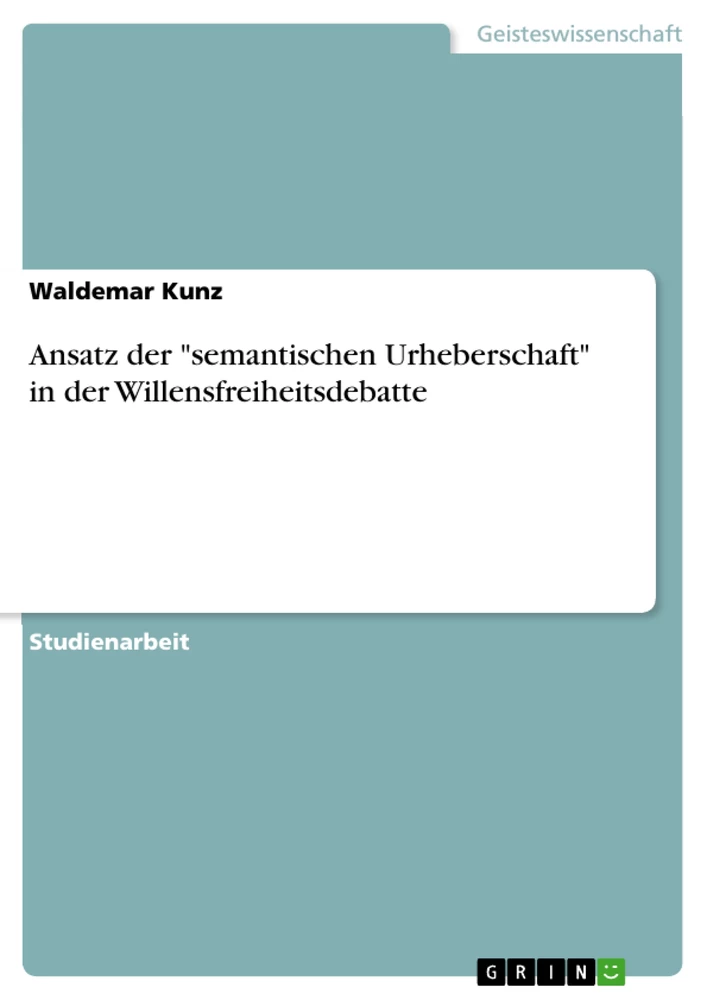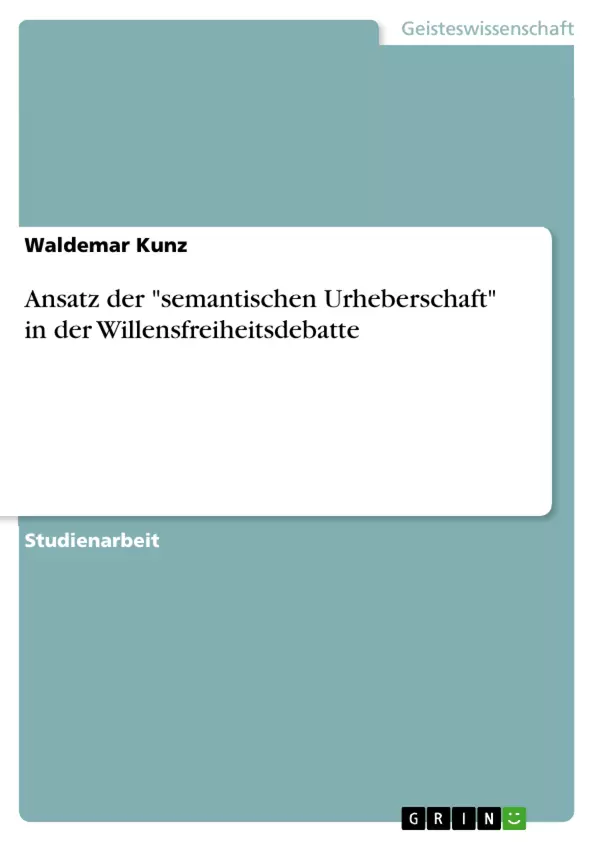Die gegenwärtige philosophische Diskussion über das Phänomen der Willensfreiheit wird vor allem von zwei Positionen dominiert, in deren Zentrum die Frage nach der Vereinbarkeit der Willensfreiheit mit dem Determinismus steht. Während die so genannten Kompatibilisten den Standpunkt zu verteidigen versuchen, dass Willensfreiheit mit dem Determinismus verträglich ist, verneinen dies die Inkompatibilisten. Der in dieser Hausarbeit behandelte Ansatz, den man als „semantische Urheberschaft“ bezeichnen könnte, und der von Jürgen Schröder in seinem Buch “Einführung in die Philosophie des Geistes“ dargestellt wurde, versucht der Diskussion über die Willensfreiheit eine völlig neue Perspektive zu verleihen, indem in ihm dafür argumentiert wird, dass für die Willensfreiheit nicht die alternativen Willensmöglichkeiten, sondern die Urheberschaft wesentlich ist. Diese soll dabei nicht kausal verstanden werden, sondern als eine Sache richtiger semantischen Beziehungen zwischen den Inhalten des Selbst einer Person und ihrer Überlegungen und dem Inhalt ihrer Entscheidungen, wobei sich „daseigentlicheProblem der Willensfreiheit auf die Frage reduzieren lässt, unter welchen Bedingungen ein Wille mein eigener Wille ist“. In dieser Arbeit möchte ich eine kritische Beurteilung einiger Aspekte dieses Ansatzes vornehmen. Dafür werde ich ihn zunächst mit seinen Thesen und seiner Argumentation im Kapitel 2 darstellen. Im Anschluss darauf werde ich im Kapitel 3 in mehreren Unterkapiteln auf einige Aspekte dieses Ansatzes kritisch eingehen. Im vierten und letzten Kapitel werde ich dann zusammenfassend meine Sicht der Leistung, der Mängel und der möglichen Weiterentwicklung dieses Ansatzes schildern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Semantische Urheberschaft: Thesen und Argumentation
- Kritische Prüfung
- Vereinbarkeit mit dem Indeterminismus?
- Wann ist ein Wille mein Wille?
- Relevanz von routinierten Handlungen für die Willensfreiheit
- Schluss: Kritische Würdigung, mögliche Weiterentwicklung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Ansatz der „semantischen Urheberschaft“ in der Willensfreiheitsdebatte, der von Jürgen Schröder vorgestellt wurde. Der Ansatz argumentiert, dass die Willensfreiheit nicht von kausalen Beziehungen abhängt, sondern von der richtigen semantischen Beziehung zwischen dem Selbst einer Person und ihren Überlegungen und Entscheidungen. Ziel der Arbeit ist eine kritische Beurteilung dieses Ansatzes.
- Kritik an der Kausalitätsdeutung der Urheberschaft
- Die Bedeutung der semantischen Beziehung für die Willensfreiheit
- Die Vereinbarkeit der semantischen Urheberschaft mit dem Indeterminismus
- Die Rolle von routinierten Handlungen für die Willensfreiheit
- Mögliche Weiterentwicklungen des Ansatzes
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2: Konzept der semantischen Urheberschaft
Kapitel 2 stellt den Ansatz der semantischen Urheberschaft vor. Es wird argumentiert, dass die Urheberschaft nicht kausal verstanden werden sollte und dass sie unabhängig von kausalen Beziehungen oder Determinismus ist. Schröder argumentiert mit Ereignis- und Agenskausalität, um zu zeigen, dass keine dieser beiden Kausalitätskonzepte die Urheberschaft ausreichend begründen kann. Durch ein Gedankenexperiment wird die Vereinbarkeit der semantischen Urheberschaft mit dem Indeterminismus verdeutlicht.
Kapitel 3: Kritische Prüfung
Kapitel 3 widmet sich einer kritischen Betrachtung des Ansatzes der semantischen Urheberschaft. Es werden verschiedene Aspekte des Ansatzes beleuchtet, unter anderem seine Vereinbarkeit mit dem Indeterminismus, die Frage nach dem eigenen Willen und die Relevanz von routinierten Handlungen für die Willensfreiheit.
Schlüsselwörter
Willensfreiheit, Determinismus, Indeterminismus, semantische Urheberschaft, Kausalität, Selbst, Entscheidung, Überlegung, routinierte Handlungen.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „semantische Urheberschaft“ in der Philosophie?
Dieser Ansatz von Jürgen Schröder besagt, dass Willensfreiheit nicht durch kausale Ketten, sondern durch die richtige semantische Beziehung zwischen den Inhalten des Selbst und den Entscheidungen einer Person definiert wird.
Wie unterscheidet sich dieser Ansatz vom klassischen Kompatibilismus?
Während klassische Ansätze oft über die Vereinbarkeit von Determinismus und Kausalität streiten, reduziert die semantische Urheberschaft das Problem auf die Frage: Unter welchen Bedingungen ist ein Wille mein eigener Wille?
Ist die semantische Urheberschaft mit dem Indeterminismus vereinbar?
Ja, Schröder argumentiert, dass Urheberschaft unabhängig von kausalen Beziehungen ist und verdeutlicht dies durch Gedankenexperimente zur Vereinbarkeit mit indeterministichen Abläufen.
Welche Rolle spielen routinierte Handlungen für die Willensfreiheit?
Die Arbeit prüft kritisch, inwieweit automatisierte oder routinierte Handlungen noch als Ausdruck der semantischen Urheberschaft und somit als „frei“ angesehen werden können.
Was ist das Kernproblem der Willensfreiheit laut Jürgen Schröder?
Das Problem lässt sich auf die Frage reduzieren, unter welchen Bedingungen ein Wille tatsächlich als der eigene Wille einer Person identifiziert werden kann, basierend auf internen semantischen Bezügen.
- Citar trabajo
- Waldemar Kunz (Autor), 2005, Ansatz der "semantischen Urheberschaft" in der Willensfreiheitsdebatte, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58763