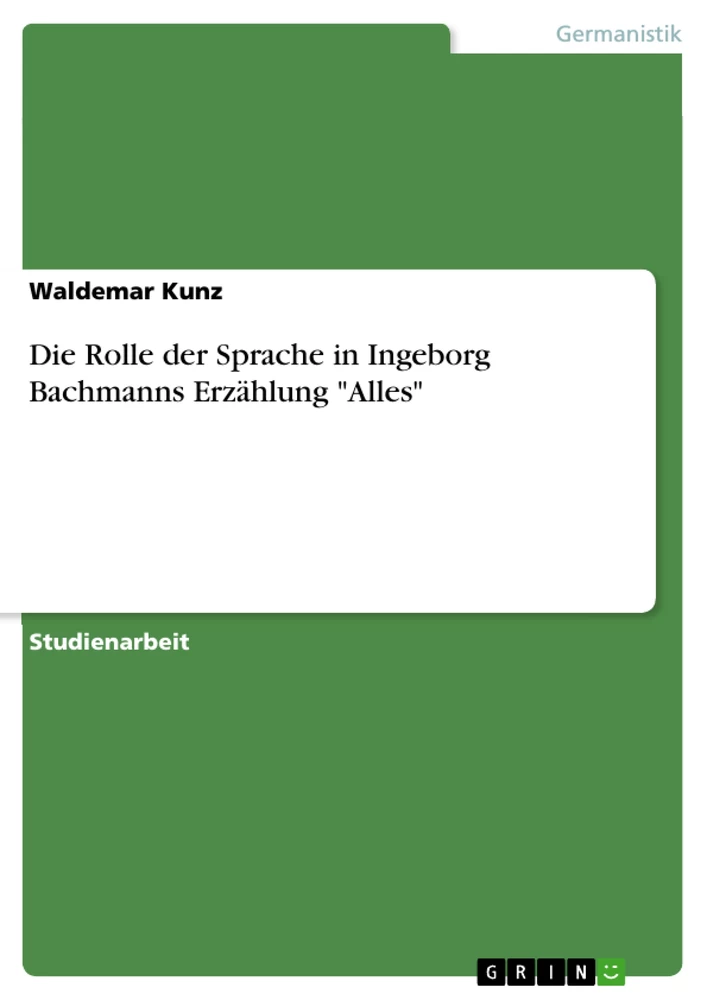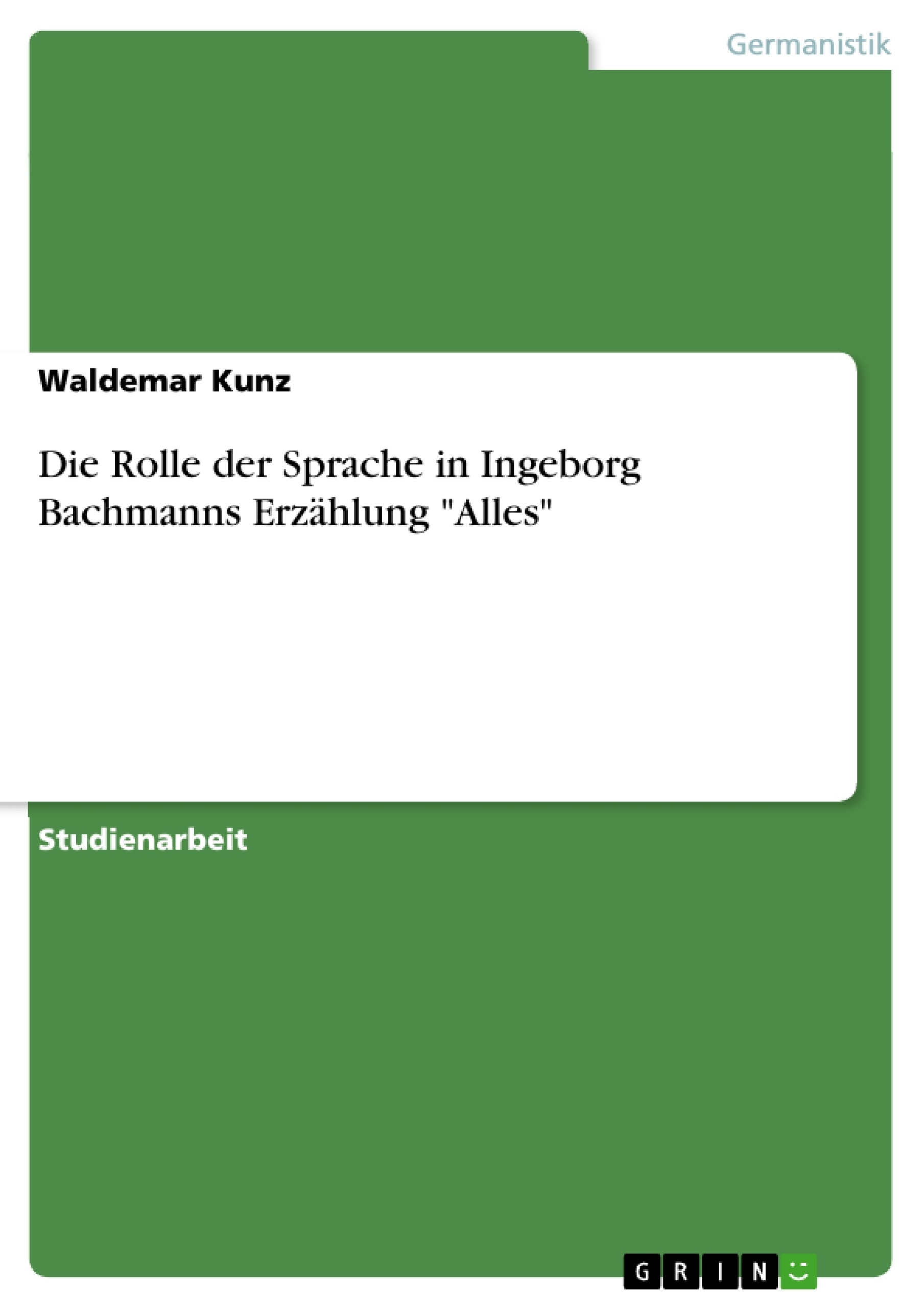In der ErzählungAlles1von Ingeborg Bachmann aus dem zwischen 1956 und 1957 entstandenem Zyklus Das dreißigste Jahr,mit der sich diese Hausarbeit beschäftigt, wird eine Geschichte „von Vater und Sohn, einer Schuld und einem Tod“ (S. 153) erzählt - eine Familiengeschichte, in deren Zentrum ein Vater-Sohn-Verhältnis steht, und die mit einem tragischen Tod des Kindes endet. In Form eines retrospektiven Berichts wird vom Erzähler sowohl die Wirkung dieses Ereignisses auf beide Eltern dargestellt als auch eine retrospektive Rekonstruktion der Ereignisse geleistet, die zum Tod geführt hatten. Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der Rolle der Sprache in der Erzählung, die unter zwei unterschiedlichen Gesichtspunkten betrachtet werden kann. Zum einen bildet das Phänomen der Sprache - die Vorstellungen von ihrem Wesen, ihren Funktionen und ihren Grenzen - ein konstitutives inhaltliches Motiv der Erzählung. Zum anderen spielt aber auch die sprachliche Gestaltung der Erzählung wie bei einem jedem sprachlichen Kunstwerk eine Funktion bei der Konstruktion der Gesamtbedeutung. Ich werde im Folgenden meine Betrachtungen auf den ersten Aspekt beschränken.
Inhaltsverzeichnis
- Unterwegs zur Sprache
- Dichterin und Theoretikerin Ingeborg Bachmann
- Utopie der Sprache
- Abschied von der Utopie?
- Sprachphilosophie als Ideologie und Rationalisierung?
- Literatur und Philosophie
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Rolle der Sprache in Ingeborg Bachmanns Erzählung "Alles" aus dem Zyklus "Das dreißigste Jahr". Sie analysiert, wie das Phänomen der Sprache in der Erzählung zum einen ein konstitutives inhaltliches Motiv bildet und zum anderen die sprachliche Gestaltung der Erzählung beeinflusst.
- Die Bedeutung der Sprache als zentrales Motiv im Werk von Ingeborg Bachmann.
- Die Utopie der Sprache als Motiv der Erneuerung und der Suche nach einer neuen Sicht auf die Welt.
- Die Grenzen der Sprache und das Scheitern der Spracherneuerung in "Alles".
- Der Einfluss von philosophischen Strömungen wie dem Wiener Kreis und Ludwig Wittgenstein auf Bachmanns Werk.
- Die Darstellung von Schuld und Tod in einem Vater-Sohn-Verhältnis.
Zusammenfassung der Kapitel
- Unterwegs zur Sprache: Dieses Kapitel stellt die Erzählung "Alles" vor und führt in die Thematik der Sprache in der Erzählung ein. Die Geschichte von Vater und Sohn, die durch den Tod des Kindes geprägt ist, wird als Ausgangspunkt für die Analyse der Rolle der Sprache in der Erzählung verwendet.
- Dichterin und Theoretikerin Ingeborg Bachmann: Dieses Kapitel befasst sich mit Ingeborg Bachmanns Werk und ihrer Beschäftigung mit der Sprache. Die Analyse fokussiert auf ihre philosophischen Reflexionen und ihre poetischen Entwürfe zur Sprache.
- Utopie der Sprache: In diesem Kapitel wird die Utopie der Sprache als zentrales Motiv in "Alles" beleuchtet. Der Erzähler versucht, dem Kind neue Sprachen zu lehren, die eine bessere Welt ermöglichen sollen, scheitert jedoch an den Grenzen der Sprache.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Hausarbeit sind: Sprache, Utopie, Ingeborg Bachmann, "Alles", "Das dreißigste Jahr", Vater-Sohn-Verhältnis, Schuld, Tod, Wiener Kreis, Ludwig Wittgenstein, Sprachphilosophie.
- Citar trabajo
- Waldemar Kunz (Autor), 2006, Die Rolle der Sprache in Ingeborg Bachmanns Erzählung "Alles", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58769